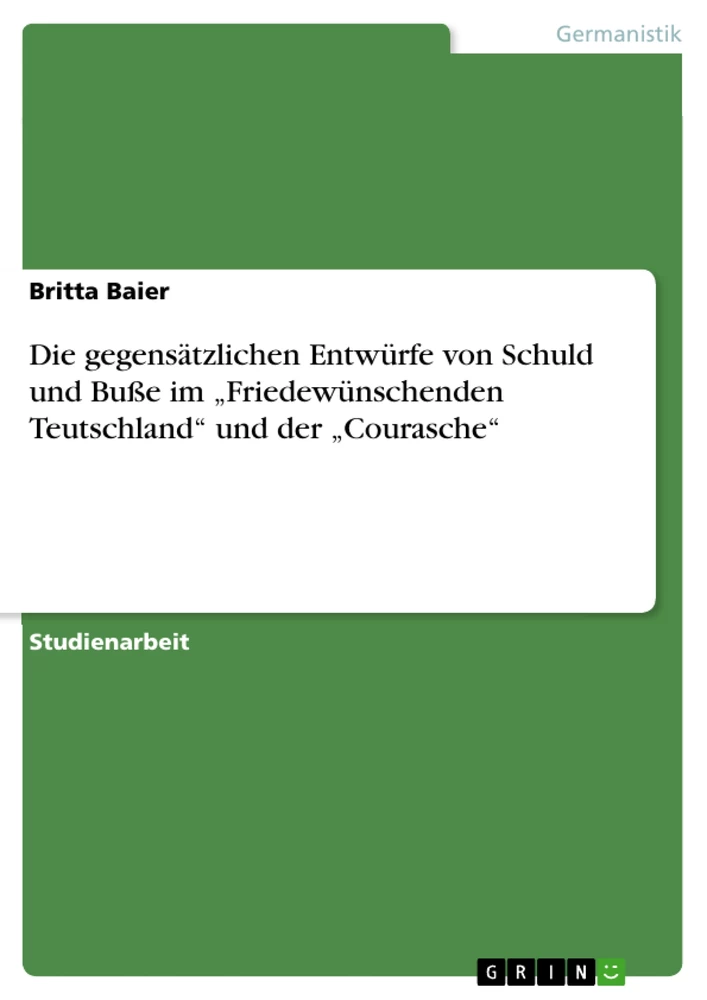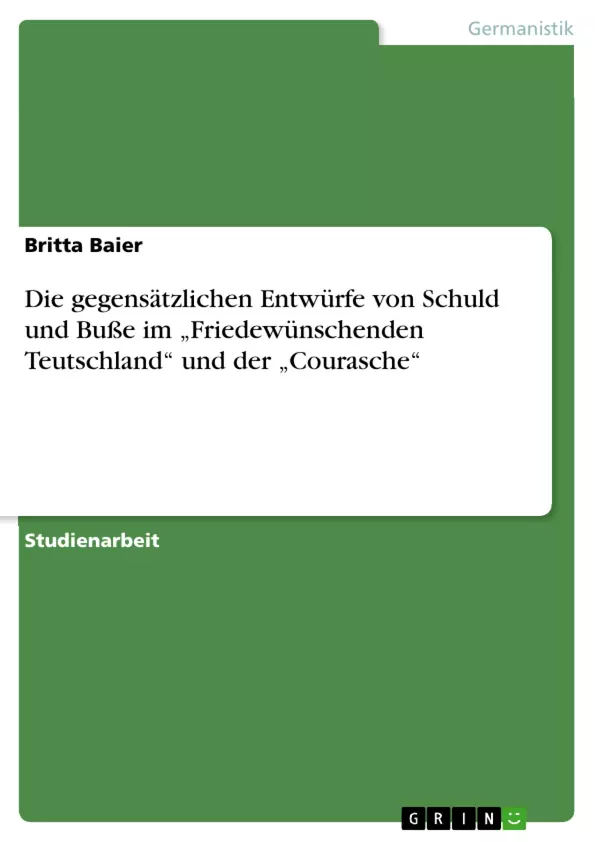Die Frage nach der Schuldigkeit des Menschen und dem zur Vergebung durch Gott zu durchlaufenden Bußeweg durchzieht die christliche Theologie von ihren Anfängen an. Bereits im dritten Kapitel der Genesis wird vom Sündenfall des Urpaares Adam und Eva berichtet, deren Fehltritt als „Erbsünde“ auf alle kommenden Generationen übertragen wird. In Religion in Geschichte und Gegenwart wird das christliche Schuldverständnis darauf zurückgeführt, dass „in den Universalreligionen […] ein zentrales Hemmnis der religiösen Einheit des Menschen mit der Wirklichkeit des Heiligen erlebt“ wird. Der Gläubige nimmt also eine Diskrepanz zwischen der eigenen Fehlerhaftigkeit und der in der Vorstellung existierenden Vollkommenheit alles Göttlichen wahr. Während im Alten Testament die verschiedenen Begriffe für Schuld zahlreich sind und sündiges Handeln vielfach definiert ist, zeichnet sich das Neue Testament dadurch aus, dass keine feste Terminologie für Schuld besteht und Synonyme für Schuldigkeit nur sparsam vorkommen. Abschnitte im Neuen Testament, in denen Schuld oder Sünde zur Sprache kommen, haben häufig den Zweck, den positiven Umgang Jesus‘ mit den Sündern zu verteidigen. Die Möglichkeit des Sündigens ist also zwar eine ständige Gefahr für den Christen, im Neuen Testament überwiegt jedoch „die Freude über die Sündenvergebung den Eifer, ein tiefes S.nbewusstsein hervorzurufen.“
Im Barock erreicht die Beschäftigung mit dem Thema des wahren Glaubens und der Buße durch die Zustände während des 30- jährigen Krieges einen Höhepunkt. Bei den von 1618 bis 1648 andauernden kriegerischen Handlungen ist zum ersten Mal im deutschen Raum die Zivilbevölkerung massiv betroffen. Sekundäre Folgen der Plünderungen durch die verschiedenen Heere sind Hunger, Epidemien und eine brachliegende Landwirtschaft. Die Literatur der Zeit beschreibt nicht nur, sondern greift sowohl kritisch als auch propagandistisch ein. Die Autoren der Zeit bemühen sich, Begründungen für die furchtbaren Leiden zu finden, die große Teile der Bevölkerung erdulden. In ihrer diametralen Anlage eines Entwurfs von Sündenfall und Erkenntnis mit dem Hintergrund des 30-jährigen Krieges faszinieren die beiden für den Barock programmatischen Schriften Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche von Hans Jakob Grimmelshausen und Das friedewünschende Teutschland von Johann Rist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Hinführung zur zentralen Fragestellung
- II. Hauptteil
- 2.1 Zu den Autoren
- 2.2 Die Handlungsverläufe
- 2.3 Gattungstraditionen Komödie und Schelmenroman
- 2.4 Struktureller Aufbau
- 2.5 Sprachliche Besonderheiten
- 2.6 Darstellung des Krieges
- 2.7 Figurengestaltung
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung von Schuld und Buße im Kontext des Dreißigjährigen Krieges anhand der Werke „Das friedewünschende Teutschland“ von Johann Rist und „Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche“ von Hans Jakob Grimmelshausen. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der beiden Werke, der Aufschluss über die unterschiedlichen Entwürfe von Sündenfall und Erkenntnis in der Barockliteratur geben soll.
- Vergleich der Werke hinsichtlich Schuld und Buße
- Gattungstheoretische Einordnung der Werke
- Analyse der Figuren und Handlungsverläufe
- Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges für die Werke
- Die Rolle von Theologie und Moral in der Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Hinführung zur zentralen Fragestellung
Die Einleitung führt in das Thema Schuld und Buße im Kontext der christlichen Theologie und des Dreißigjährigen Krieges ein. Es werden die grundlegenden Konzepte von Schuld und Sünde im christlichen Verständnis beleuchtet und die Relevanz des Krieges für die Entwicklung des Bußgedankens im Barock dargestellt. Der Vergleich der Werke „Das friedewünschende Teutschland“ und „Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche“ wird als Ausgangspunkt für die weitere Analyse vorgestellt.
II. Hauptteil
2.1 Zu den Autoren
Dieser Abschnitt präsentiert biographische Informationen über Johann Rist und Hans Jakob Grimmelshausen, die für das Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven auf Schuld und Buße in ihren Werken relevant sind. Rists Lebensweg als Theologe und Dichter wird im Kontext seiner produktiven schriftstellerischen Tätigkeit dargestellt, während Grimmelshausens Erfahrungen als Kriegsteilnehmer und seine mangelnde akademische Bildung hervorgehoben werden.
2.2 Die Handlungsverläufe
Der Vergleich der Handlungsverläufe in den beiden Werken zeigt, dass die Protagonistinnen in beiden Fällen durch ihr Handeln nach außen hin in moralischen Verfall geraten. Die Werke zeichnen dabei unterschiedliche Perspektiven auf Schuld und Verfehlung auf, die im Teutschland durch die Figuren des Merkutio und des Friedens, in der Courasche durch den Erzähler und den Autor selbst repräsentiert werden.
2.3 Gattungstraditionen Komödie und Schelmenroman
Dieser Abschnitt beleuchtet die gattungstheoretischen Besonderheiten der beiden Werke und verortet sie im Kontext von Komödie und Schelmenroman. Die Gattungstraditionen beeinflussen die Darstellung von Schuld und Buße und tragen zur Entwicklung der spezifischen Figurenkonzepte bei.
2.4 Struktureller Aufbau
Der Vergleich der strukturellen Aufbauten der beiden Werke soll Aufschluss über die unterschiedlichen Strategien der Darstellung von Schuld und Buße geben. Die Analyse des Handlungsaufbaus, der Figurenkonstellation und der Sprache der Werke soll zu einem besseren Verständnis der jeweiligen Intentionen der Autoren beitragen.
2.5 Sprachliche Besonderheiten
Dieser Abschnitt analysiert die sprachlichen Besonderheiten der beiden Werke und untersucht den Einfluss der Sprache auf die Darstellung von Schuld und Buße. Der Vergleich der Schreibstile, der Verwendung von rhetorischen Mitteln und der sprachlichen Bildlichkeit soll die unterschiedlichen Intentionen der Autoren beleuchten.
2.6 Darstellung des Krieges
Die Analyse der Darstellung des Dreißigjährigen Krieges in den beiden Werken soll zeigen, inwieweit der Krieg als Ursache für Schuld und Buße, aber auch als Schauplatz für die Entwicklung von Moral und Erkenntnis angesehen wird. Die Werke setzen sich jeweils auf unterschiedliche Weise mit den Folgen des Krieges auseinander und präsentieren unterschiedliche Perspektiven auf den Zusammenhang zwischen Krieg und Sündhaftigkeit.
2.7 Figurengestaltung
Die Figurengestaltung in den beiden Werken steht im Mittelpunkt dieses Abschnitts. Die Analyse der Protagonisten und Nebenfiguren soll Aufschluss über die unterschiedlichen Konzepte von Schuld und Buße in den Werken geben. Die Figuren fungieren als Repräsentanten verschiedener moralischen Positionen und tragen zur Entwicklung der jeweiligen Handlungslogik bei.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit umfassen die Themen Schuld und Buße im Kontext des Dreißigjährigen Krieges, die Barockliteratur, die Werke „Das friedewünschende Teutschland“ von Johann Rist und „Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche“ von Hans Jakob Grimmelshausen, sowie die gattungstheoretischen Aspekte Komödie und Schelmenroman.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der 30-jährige Krieg in der Barockliteratur dargestellt?
Der Krieg wird als Strafe Gottes, Ort moralischen Verfalls, aber auch als Anlass zur Buße und Umkehr beschrieben.
Worin unterscheiden sich Rist und Grimmelshausen in ihrem Werk?
Rist nähert sich dem Thema als Theologe und Dichter, während Grimmelshausen seine Erfahrungen als Kriegsteilnehmer in einen Schelmenroman einfließen lässt.
Was ist das zentrale Motiv der „Courasche“?
Es ist die Lebensbeschreibung einer Frau, die durch Betrug und Sündhaftigkeit im Krieg überlebt, ohne den Weg zur Buße zu finden.
Welche Rolle spielt die „Erbsünde“ in diesen Werken?
Die Arbeit beleuchtet das christliche Verständnis von Schuld, das auf dem Sündenfall basiert und die menschliche Fehlerhaftigkeit gegenüber göttlicher Vollkommenheit betont.
Was ist das Ziel von Johann Rists „Friedewünschendem Teutschland“?
Das Werk nutzt allegorische Figuren, um die Leiden des Krieges zu beklagen und zur moralischen Erneuerung und zum Frieden aufzurufen.
- Arbeit zitieren
- Britta Baier (Autor:in), 2011, Die gegensätzlichen Entwürfe von Schuld und Buße im „Friedewünschenden Teutschland“ und der „Courasche“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189940