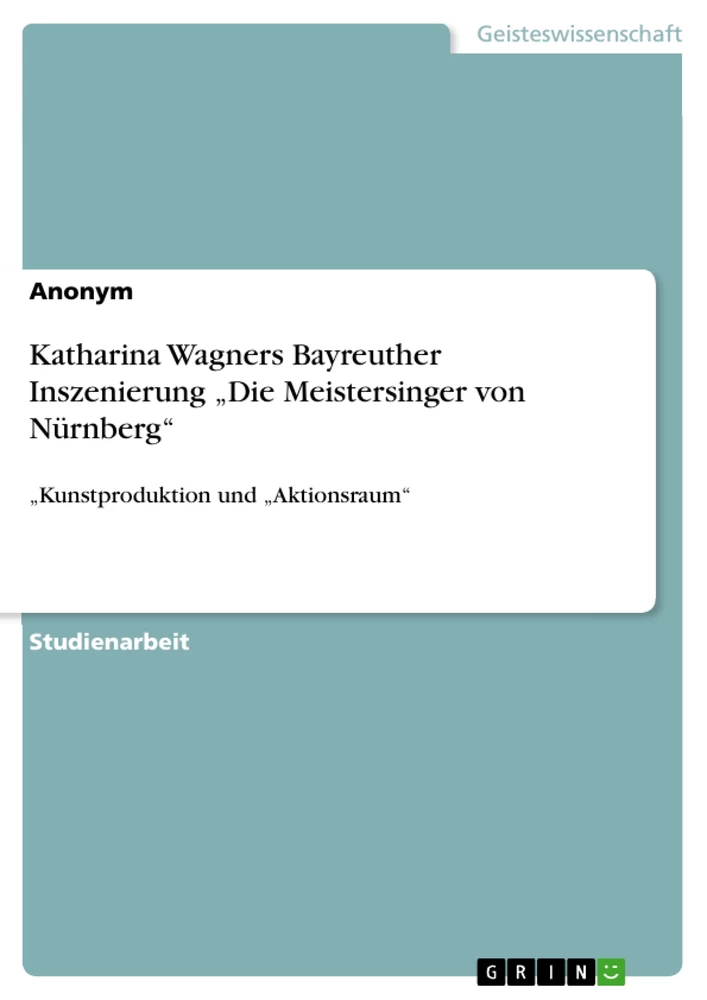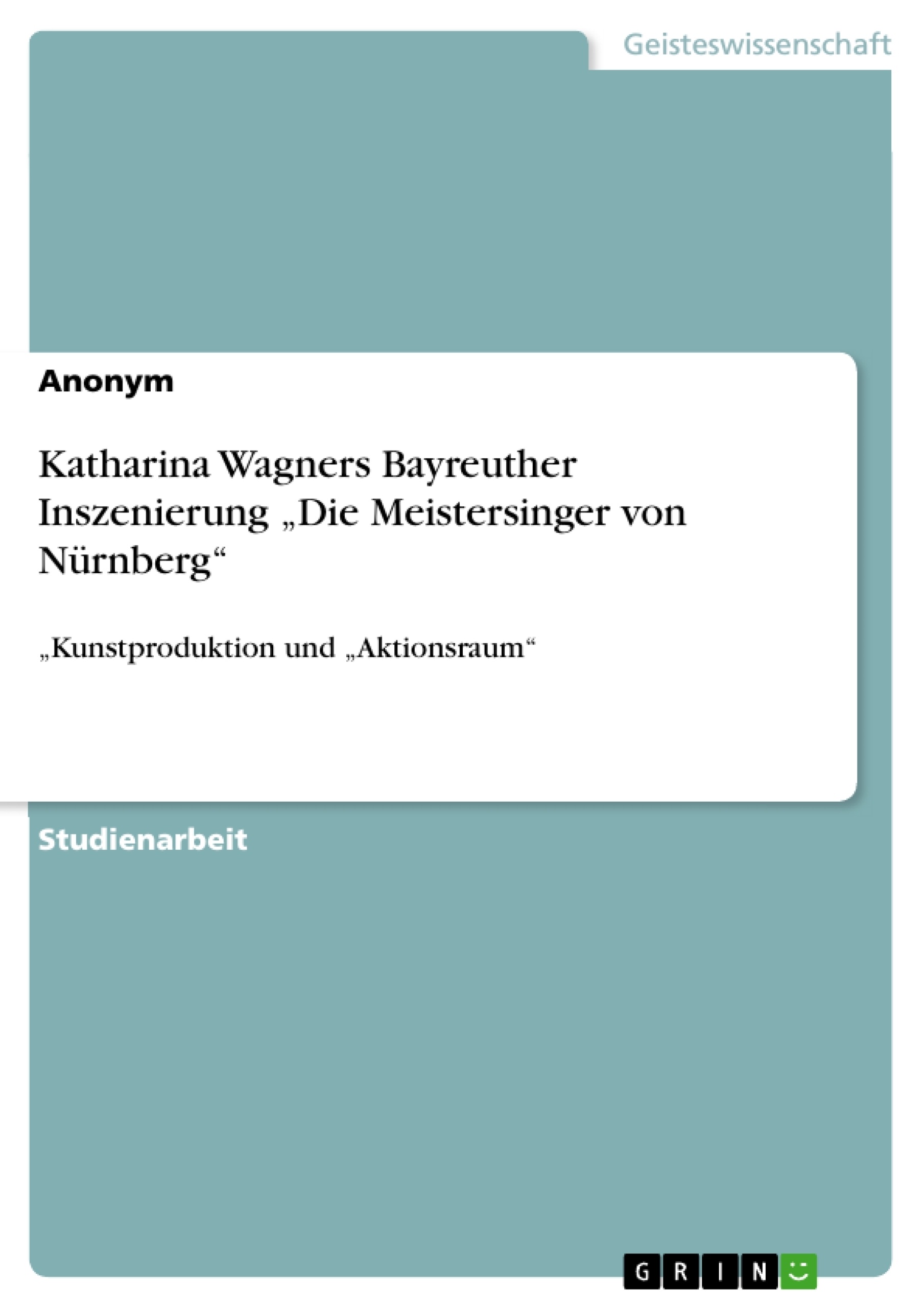Katharina Wagner (geb. 1978), Ur-Enkelin von Richard Wagner und seit 2009 Festspielleiterin der Bayreuther Festspiele1, gibt im Jahre 2007 ihr Regie-Debüt bei den Bayreuther Festspielen mit einer Neuinszenierung der Oper Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Ihr Team setzt sich aus weiteren Musiktheaterschaffenden, wie dem Dramaturgen Robert Sollich, dem Bühnenbilder Thilo Reinhardt und der Kostümbildnerin Michaela Barth zusammen, die musikalische Leitung hat Sebastian Weigl inne. Kaum eine andere Oper von Richard Wagner thematisiert explizit die Kreativität des Singens wie die Meistersinger von Nürnberg.2 Aus diesem Sujet schafft Katharina Wagner zusammen mit ihrem Dramaturgen Robert Sollich für die Bayreuther Inszenierung 2007 das dramaturgische Konzept der Inszenierung: die Aufführung eröffnet einen permanent hermeneutisch fortlaufenden Kunstdiskurs, der sich am „Kunstschaffen“ materiell abarbeitet. Diverse Referenzen etablieren zeichenhafte Erscheinungen wie Objekte, Gemälde, Skulpturen etc., die von zwei „Künstertypen“ unterschiedlich bespielt und verhandelt werden. Wie ist das genau zu verstehen? Zwei künstlerische Haltungen treten in den Fokus der Untersuchung, die durch die Figuren Walther von Stolzing und Sixtus Beckmesser vermittelt werden. Ihr Umgang mit den Objekten bzw. die Veränderung in Qualität und Beschaffenheit, ist für die Darstellung einer kognitiven Form und künstlerischen Haltung repräsentativ zu verstehen. Offenkundig werden mit diesem Regieeinfall Haltungen der „Archivierung u. Reproduktion“, sowie der „Erneuerung u. Produktion“ thematisiert. Dieser Vorgang (Werk u. Umgang = Haltung) zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Erzählstrang der Inszenierung und begründet in den Meistersinger von Nürnberg diametrale Positionen: die dramaturgische Spannungskurve zwischen den Polen „Archiv“ und „Erneuerung“.
Den analytischen Ansatz bietet die Methode der Aufführungsanalyse der Inszenierung in essayistischer Form, da der Kunstdiskurs, welcher die Beobachtung diametral gesetzter Positionen künstlerischen Schaffens ermöglicht, permanent stattfindet und sich unentwegt weiter entwickelt. [...]
==
1 Diese Position teilt sie mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier.
2 Einen dramatischen Kontrapunkt dieser Thematik schafft Wagner mit Tannhäuser. Die ästhetische Differenz obliegt der Form, da es sich bei den Meistersingern von Nürnberg um Wagners einzige Opéra comique handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersicht: der Raum
- Methodik: extreme Haltungen zu Kunst, Archiv und Zerstörung
- Blicke des Publikums in eine Raumchimäre
- Konzept und Struktur
- Übersicht: der erste Aufzug
- Kunsthistorische Referenzen im ersten Aufzug: Dürer der Zerstörte
- Walther von Stolzing - Ist das Kunst oder kann das weg?
- „Aktionsraum“ und Räumlichkeit
- Nürnberger Eklektizismus
- Leges Tubulaturae
- Eva
- Übersicht: der zweite Aufzug
- Handgemachte Umkehrung
- Eva IV.
- Vernissage oder Finisage?
- Übersicht: der dritte Aufzug
- Die Figur des Dritten
- Transformation dramatis personae
- Beckmesser
- Einzug der Schwellköpfe und Entsorgung performativer Künste
- Zwei Performances für das Volk
- Beckmessers Performance
- Walthers Performance
- Sachs' neue Ära
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Katharina Wagners Inszenierung der Meistersinger von Nürnberg (Bayreuth 2007) unter dem Aspekt der Aufführungsanalyse. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Wagners Inszenierung die Kreativität des Singens im Kontext von Kunstproduktion und Aktionsraum darstellt.
- Die zwei künstlerischen Haltungen von Walther von Stolzing und Sixtus Beckmesser im Umgang mit Kunstobjekten
- Die Rolle von Kunstobjekten und Referenzen als Träger von Bedeutung und symbolischer Aussagekraft
- Die Beziehung zwischen Archiv und Erneuerung in der künstlerischen Produktion
- Das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Normen und individueller künstlerischer Freiheit
- Die Inszenierung als Kunstdiskurs und die Analyse des künstlerischen Schaffens
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der Raum der Inszenierung als mediale Bedingung der Aufführung analysiert. Dabei werden die verschiedenen Blicke des Publikums auf die Bühnenlandschaft und die konzeptionellen Besonderheiten der Inszenierung beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden die kunsthistorischen Referenzen im ersten Aufzug der Oper betrachtet, insbesondere die Figur des Dürer, der als ein Zerstörtes dargestellt wird. Weiterhin wird analysiert, wie die Figuren Walther von Stolzing und Sixtus Beckmesser mit Kunstobjekten umgehen und welche künstlerischen Haltungen diese vermitteln. Der „Aktionsraum“ und die Räumlichkeit des ersten Aufzugs werden ebenfalls in den Blick genommen.
Im dritten Kapitel wird die Handgemachte Umkehrung im zweiten Aufzug der Oper analysiert. Weiterhin werden die Figuren Eva IV. und die Frage nach einer Vernissage oder Finisage in diesem Kontext untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen der Kunstproduktion, Aktionsraum, Aufführungsanalyse, Inszenierung, Katharina Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Bayreuth, Richard Wagner, Walther von Stolzing, Sixtus Beckmesser, Kunstdiskurs, Archiv, Erneuerung, Referenzen, Objekte, Symbolismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Katharina Wagners „Meistersinger“-Inszenierung (2007)?
Die Inszenierung thematisiert einen permanenten Kunstdiskurs, der sich am Spannungsverhältnis zwischen „Archivierung/Reproduktion“ und „Erneuerung/Produktion“ abarbeitet.
Wie werden die Figuren Walther von Stolzing und Sixtus Beckmesser dargestellt?
Sie fungieren als Repräsentanten zweier unterschiedlicher Künstertypen: Walther steht für die Erneuerung („Ist das Kunst oder kann das weg?“), während Beckmesser mit dem Archiv und der Bewahrung assoziiert wird.
Welche Rolle spielen kunsthistorische Referenzen in der Aufführung?
Die Inszenierung nutzt zeichenhafte Erscheinungen wie Gemälde und Skulpturen (z. B. Dürer-Referenzen), um den kognitiven Prozess künstlerischen Schaffens materiell darzustellen.
Was versteht man unter dem „Aktionsraum“ in dieser Inszenierung?
Der Aktionsraum beschreibt die mediale Bedingung der Bühne, in der die Akteure mit Objekten interagieren und dadurch ihre künstlerische Haltung vermitteln.
Wie wird das Ende der Oper in dieser Version interpretiert?
Die Arbeit analysiert den „Einzug der Schwellköpfe“ und die Entsorgung performativer Künste als Zeichen für Sachs' neue Ära und die Transformation der dramatis personae.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2011, Katharina Wagners Bayreuther Inszenierung „Die Meistersinger von Nürnberg“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190027