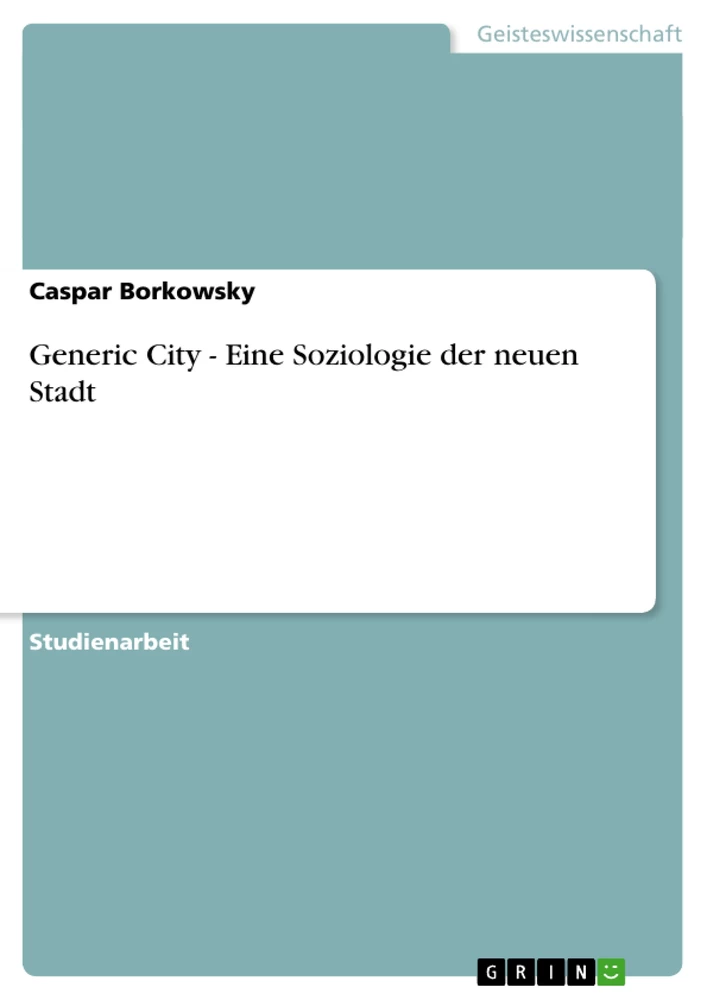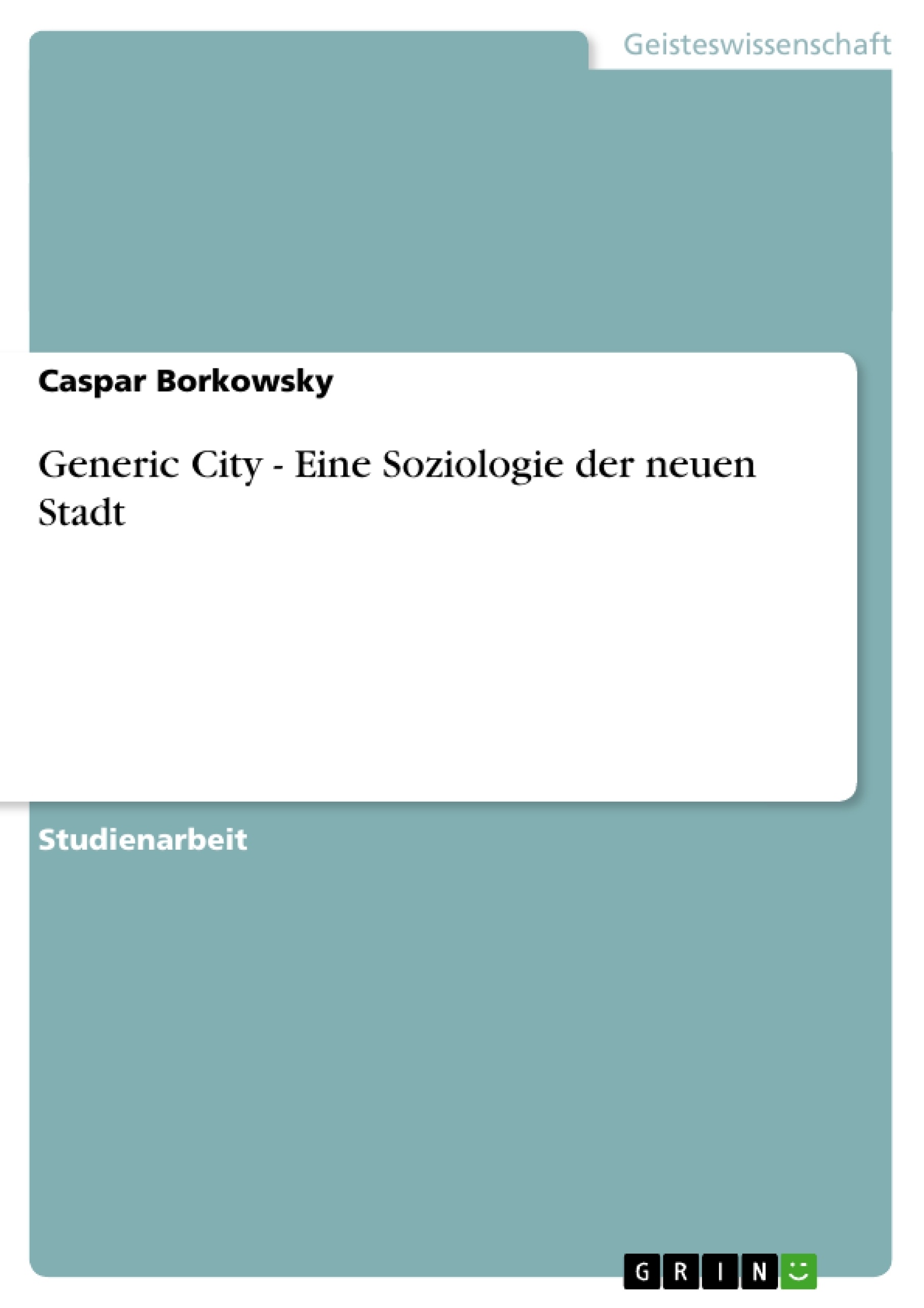Ziel dieser Arbeit ist eine Darstellung und Diskussion der Generic City. Die generische Stadt ist ein neuer Stadttypus, der auf ein von Rem Koolhaas entwickeltes Konzept rekurriert. Die verwendete deutsche Übersetzung, in der Architekturzeitschrift Arch+ erschienen, übersetzt "The Generic City" mit "Die eigenschaftslose Stadt". Ich werde allerdings die englische Originalbezeichnung beibehalten (und auch mit der Wortkreation generisch sogar "eindeutschen") und möchte dies kurz begründen. Ich halte die deutsche Übersetzung für unzureichend und eventuell sogar falsch. Unzureichend, weil sie nur auf einen möglichen Aspekt von "generic" fokussiert. Hier zeigt sich in meinen Augen bereits die ablehnende Haltung gegenüber dem Konzept der Generic City, wie sie in Europa wohl vorherrschend sein dürfte. Eventuell sogar falsch, weil der Begriff "generic" verschiedene Bedeutungen haben kann. So könnte man generic beispielsweise auch im Sinne der pharmazeutischen Verwendung verstehen. Generika sind Medikamente, die die exakten Eigenschaften eines Markenpräparats haben, dabei aber billiger sind (bekanntestes Beispiel: Aspirin vs. ASS ratiopharm). Ein derartiges Verständnis von generic würde insbesondere das Effizienzmoment der Generic City adäquat wiederspiegeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- The Generic City
- Die Identitätsproblematik
- Funktionsweisen der GC
- Houston, TX
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Diskussion der „Generic City“, einem neuen Stadttypus, der auf das Konzept von Rem Koolhaas zurückgreift. Der Autor dieser Arbeit analysiert die Entstehung und Funktionsweise der „Generic City“ im Vergleich zu traditionellen Stadtstrukturen und diskutiert die Relevanz des Konzepts im Kontext von Urbanisierungsprozessen.
- Die „Generic City“ als neuer Stadttypus
- Identitätsproblematik der traditionellen Stadt und ihre Lösung durch die „Generic City“
- Funktionsweisen der „Generic City“ und ihre heterogene Struktur
- Das Beispiel der Stadt Houston als Exemplifizierung der „Generic City“
- Kritik und Diskussion der „Generic City“ im Kontext von städtebaulichen Konzepten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt das Ziel der Arbeit vor und skizziert den Entstehungskontext der „Generic City“, wobei der Autor seine eigene Erfahrung als Bezugspunkt heranzieht. Es wird auf die Bedeutung von Rem Koolhaas' Werk im Kontext der „Generic City“ eingegangen und der Begriff „Generic City“ im Vergleich zur deutschen Übersetzung „Die eigenschaftslose Stadt“ kritisch hinterfragt.
- The Generic City: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und den Charakteristika der „Generic City“. Es werden die Probleme der traditionellen Stadt in Bezug auf Identität und die Funktionsweise der „Generic City“ im Kontext dieser Herausforderungen analysiert.
- Houston, TX: Dieses Kapitel präsentiert die Stadt Houston als ein Beispiel für die „Generic City“ und erläutert die Besonderheiten dieser Stadt im Hinblick auf das vorgestellte Konzept.
Schlüsselwörter
„Generic City“, Stadtentwicklung, Urbanisierung, Identität, heterogene Struktur, Funktionsweise, Rem Koolhaas, Stadtplanung, Houston, „Delirious New York“, „Pearl River Delta“, „Shopping“
- Citar trabajo
- Caspar Borkowsky (Autor), 2003, Generic City - Eine Soziologie der neuen Stadt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19005