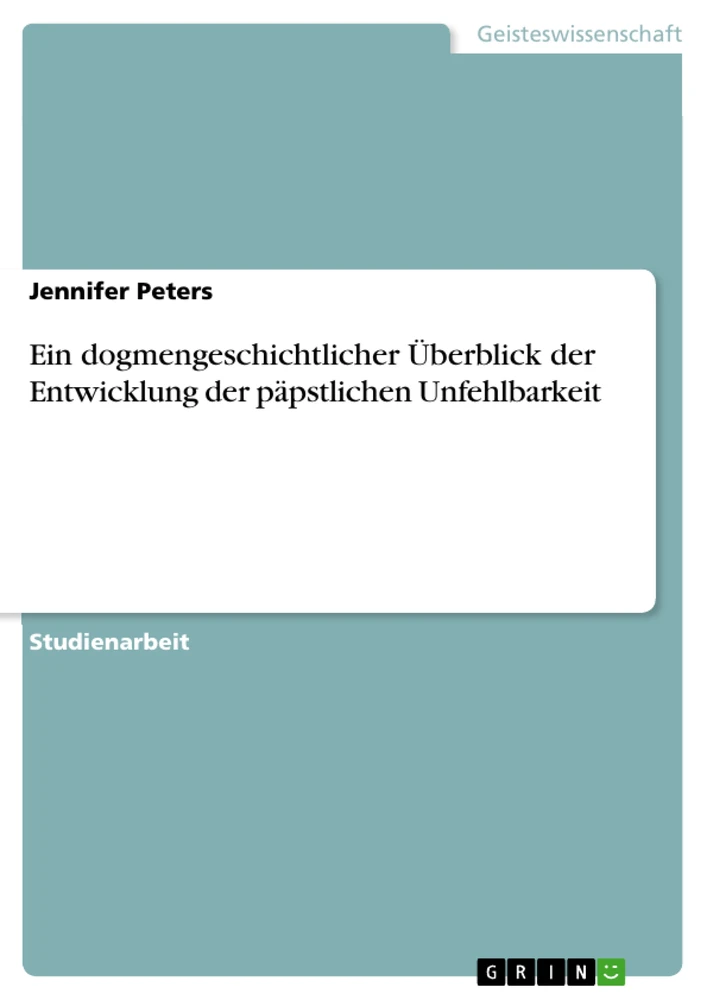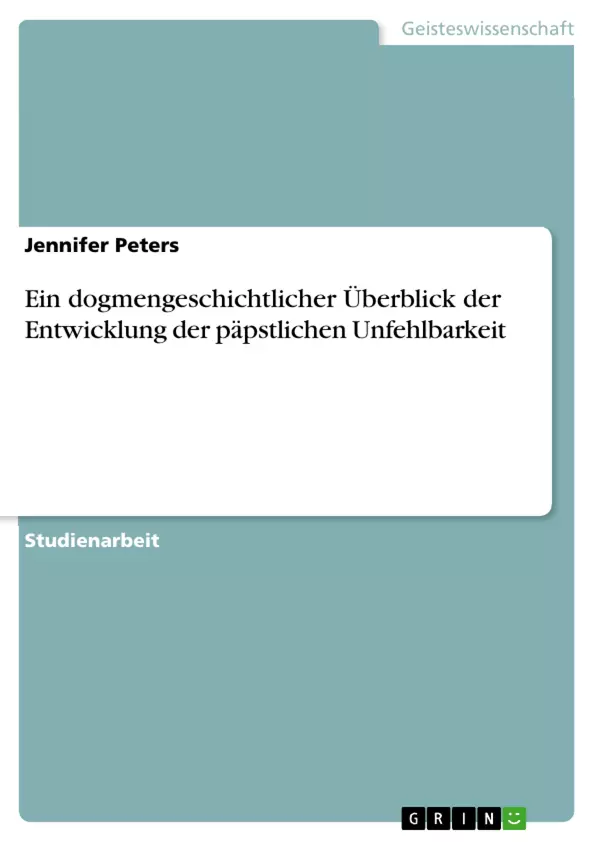„Nobody’s perfect“, weiß der Volksmund zu sagen. „Irren ist menschlich“, da ist er sich sicher. Vielleicht gerade deshalb wird wohl kaum ein Dogma der katholischen Kirche stärker diskutiert, kritisiert und umstritten. Wohl kaum ein Thema trennt die Befürworter und Kritiker des Glaubens mehr. Ein jeder hat eine Meinung, einen mehr oder weniger endgültigen und strikten Standpunkt, der ihn möglicherweise sogar vom Glauben und vor Allem von der Kirche ab- bzw. fernhält. „Wie kann ein Mensch unfehlbar sein?“, fragen die einen, „Natürlich macht der Papst als Gottesmann keine Fehler“, konstatieren die anderen. Doch wer hat Recht? Kann ein schlüssiges, theologisch-wissenschaftlich fundiertes Endergebnis gefunden werden, das für alle nachvollziehbar und logisch zu erklären ist, aber dennoch keinem Glaubensgrundsatz widerspricht oder die römisch-katholische Christenheit eines entscheidenden Guts beraubt? Wie hat sich die Thematik im Verlauf der Kirchengeschichte entwickelt, wann und wie ist die Frage aufkommen und wie lautet die tatsächliche Antwort und Entscheidung der Kirche? Die folgende Arbeit soll sich mit der Frage nach der Infallibilität und dem Jurisdiktionsprimat des Papstes beschäftigen, den Bogen zu vor Allem dem Ersten, aber auch dem Zweiten Vatikanischen Konzil schlagen und auch den damaligen Papst Pius IX. in den Kontext mit einbinden.
Dafür sollen zunächst die Biographie Papst Pius IX. und der Verlauf des Ersten Vatikanums skizziert werden, bevor die Begrifflichkeiten der Infallibilität und des Jurisdiktionsprimats des
Papstes näher betrachtet und erläutert werden. Im Anschluss wird der Bogen zum Zweiten Vatikanischen Konzil geschlagen, bevor die Bedeutung des Dogmas in die Entwicklung der Gesamtgeschichte des Papsttums eingebettet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Papst Pius IX.
- Lebenslauf
- Wirken
- Das Erste Vatikanum
- Vorgeschichte
- Verlauf und Ergebnisse
- Übergang und Ergebnisse des Zweiten Vatikanums
- Jurisdiktionsprimat
- Definition
- Infallibilität
- Definition
- Voraussetzungen
- Biblische Betrachtungen
- Systematische Betrachtungen
- Anwendungen
- Das Dogma der Unfehlbarkeit im Verlauf der Kirchengeschichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Infallibilität und dem Jurisdiktionsprimat des Papstes im Kontext des Ersten Vatikanischen Konzils. Dabei werden die Biographie Papst Pius IX. und der Verlauf des Ersten Vatikanums skizziert, bevor die zentralen Begriffe der Infallibilität und des Jurisdiktionsprimats näher erläutert werden. Des Weiteren wird der Bogen zum Zweiten Vatikanischen Konzil geschlagen und die Bedeutung des Dogmas der Unfehlbarkeit in die Entwicklung der Kirchengeschichte eingebettet.
- Biographie Papst Pius IX.
- Das Erste Vatikanische Konzil
- Der Begriff der Infallibilität
- Der Begriff des Jurisdiktionsprimats
- Das Dogma der Unfehlbarkeit in der Kirchengeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Kontext des Themas Infallibilität und Jurisdiktionsprimat in der katholischen Kirche.
- Papst Pius IX.: Dieses Kapitel befasst sich mit der Biographie von Papst Pius IX., seiner Zeit als Papst und seinen wichtigsten Entscheidungen und Maßnahmen.
- Das Erste Vatikanum: Dieses Kapitel befasst sich mit der Vorgeschichte, dem Verlauf und den Ergebnissen des Ersten Vatikanischen Konzils, das die Frage der päpstlichen Infallibilität behandelte.
- Jurisdiktionsprimat: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Jurisdiktionsprimats und erläutert seine Bedeutung im Kontext des Papsttums.
- Infallibilität: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition der Infallibilität, ihren Voraussetzungen, biblischen und systematischen Betrachtungen und Anwendungen.
- Das Dogma der Unfehlbarkeit im Verlauf der Kirchengeschichte: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Dogmas der Unfehlbarkeit in der Geschichte der Kirche.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe der Arbeit sind Infallibilität, Jurisdiktionsprimat, Papst Pius IX., das Erste Vatikanum, Dogma, Kirchengeschichte, katholische Kirche, Glaubensgrundsätze. Die Arbeit befasst sich mit der theologisch-wissenschaftlichen Analyse der Unfehlbarkeit des Papstes, seiner historischen Entwicklung und seiner Bedeutung im Kontext der katholischen Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit?
Es besagt, dass der Papst unter bestimmten Voraussetzungen (ex cathedra) in Glaubens- und Sittenfragen nicht irren kann.
Wann wurde die Unfehlbarkeit offiziell verkündet?
Das Dogma wurde während des Ersten Vatikanischen Konzils (1869–1870) unter Papst Pius IX. verabschiedet.
Was ist der Jurisdiktionsprimat des Papstes?
Er bezeichnet die oberste Rechtsgewalt und Leitungsvollmacht des Papstes über die gesamte katholische Kirche.
Welche Rolle spielte Papst Pius IX.?
Pius IX. war die treibende Kraft hinter dem Ersten Vatikanum und der Festschreibung der päpstlichen Vorrangstellung.
Wie veränderte das Zweite Vatikanum die Sicht auf dieses Dogma?
Das Zweite Vatikanum ergänzte die Unfehlbarkeit durch die Betonung der Kollegialität der Bischöfe und den Kontext der gesamten Kirche.
- Quote paper
- Jennifer Peters (Author), 2011, Ein dogmengeschichtlicher Überblick der Entwicklung der päpstlichen Unfehlbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190051