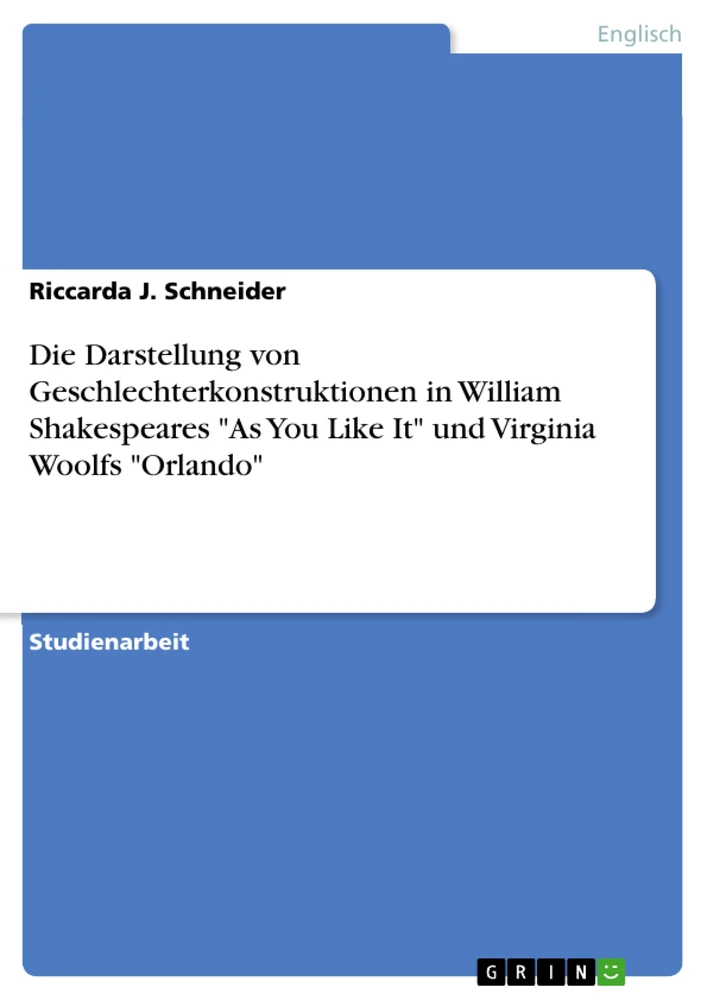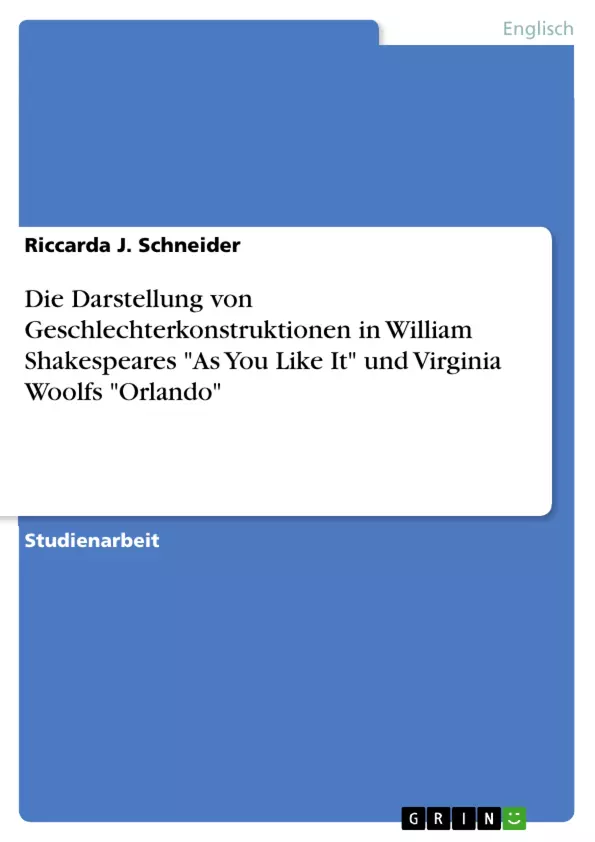Gender!
Welches sind die ersten Assoziationen, die Hörer/innen damit verbinden? Soziologische, philosophische, psychologische oder medizinische Abhandlungen?
Ich möchte mich in dieser Hausarbeit der Thematik „Geschlecht“ (gender) auf literarischer Ebene nähern. Hierfür werde ich die Werke As You Like It von William Shakespeare und Orlando von Virginia Woolf nach der Darstellung des Geschlechts analysieren und fragen:
Kann gender sichtbar gemacht oder gar in irgendeiner Weise codiert werden? Gibt es Äußerlichkeiten, an denen das soziale Geschlecht manifestiert werden kann? Was geschieht mit dem Subjekt bei einem Geschlechtswechsel? Verändern sich dann die Sprache des jeweiligen Individuums oder sein/ ihr Umgang mit anderen menschlichen Wesen?
Als Ausgangspunkt dient mir das Betrachten des sozialen Geschlechts (gender) als kulturell bedingte Konstruktion, welches ich insbesondere anhand der Figuren Rosalind aus As You Like It (1600) und Orlando aus dem gleichnamigen Roman Orlando (1928) von Virginia Woolf veranschaulichen will.
Dafür habe ich meine Arbeit thematisch gegliedert. Dabei untersuche ich die Figuren von „außen nach innen“. Das heißt, ich werde zuerst den Körper als Objekt beleuchten und mich mit der Wirkung von Kleidung als Verkleidung auseinandersetzen. Daneben beschreibt dieses Kapitel, wie sich die Körpersprache mit der Maskerade und einem Geschlechtswechsel verändern kann. Das darauf folgende Kapitel schildert die „inneren“, sprachlichen Veränderungen, die eine Transformation des Geschlechts bedingen kann. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Figuren zu Anderen vor und nach dem Wechsel des Geschlechts, um Gemeinsamkeiten oder etwaige Unterschiede feststellen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Körper-Inszenierung/ Geschlecht(s)-Inszenierung
- 2.1 Verkleidung als „äußerlicher\" Wechsel des Geschlechts
- 2.2 Körpersprache - die Codierung des Geschlechts?
- 3. Der Wandel der Sprache mit dem Geschlechtswechsel
- 4. Die Veränderung zwischenmenschlicher Beziehungen mit der Transformation des Geschlechts
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Geschlechterkonstruktionen in William Shakespeares As You Like It und Virginia Woolfs Orlando, um zu untersuchen, ob und wie Geschlecht (gender) in literarischen Texten sichtbar gemacht werden kann. Im Zentrum der Analyse stehen die Figuren Rosalind und Orlando, die beide einen Geschlechtswechsel durchlaufen und somit die Konstruiertheit von Geschlecht veranschaulichen.
- Das soziale Geschlecht als kulturelle Konstruktion
- Körper-Inszenierung und die Bedeutung von Verkleidung und Körpersprache
- Der Einfluss des Geschlechtswechsels auf Sprache und Kommunikation
- Die Veränderung zwischenmenschlicher Beziehungen durch die Transformation des Geschlechts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand „gender“ einführt und die Zielsetzung sowie den methodischen Ansatz der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich der Körper-Inszenierung und untersucht, wie Kleidung und Körpersprache die Darstellung des Geschlechts beeinflussen. In diesem Zusammenhang werden die Figuren Rosalind und Orlando vorgestellt, die beide durch ihre Verkleidung und/oder Transformation des Geschlechts die Konstruiertheit von Geschlecht veranschaulichen.
Das dritte Kapitel fokussiert auf den Wandel der Sprache im Zusammenhang mit dem Geschlechtswechsel. Hier wird analysiert, wie sich die sprachliche Ausdrucksweise der Figuren verändert, wenn sie ihr soziales Geschlecht wechseln. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen des Geschlechtswechsels auf die Beziehungen der Figuren zu anderen Personen. Hier werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verhalten der Figuren vor und nach der Transformation untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „gender“, Geschlechterkonstruktionen, Körper-Inszenierung, Verkleidung, Körpersprache, Sprache, Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen. Die Analyse basiert auf den literarischen Texten As You Like It von William Shakespeare und Orlando von Virginia Woolf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Geschlechterkonstruktionen (Gender) in William Shakespeares "As You Like It" und Virginia Woolfs "Orlando" unter dem Aspekt der kulturellen Konstruktion.
Welche literarischen Figuren stehen im Fokus der Analyse?
Im Zentrum stehen die Figuren Rosalind aus Shakespeares Komödie und Orlando aus Woolfs gleichnamigem Roman, die beide einen Geschlechtswechsel bzw. eine geschlechtliche Transformation durchlaufen.
Wie wird der Körper in Bezug auf Gender analysiert?
Die Autorin untersucht den Körper als Objekt der Inszenierung und beleuchtet die Wirkung von Kleidung als Maskerade sowie die Veränderung der Körpersprache durch den Geschlechtswechsel.
Welchen Einfluss hat die Transformation auf die Sprache der Figuren?
Die Arbeit analysiert im dritten Kapitel, ob und wie sich die sprachliche Ausdrucksweise und die Kommunikation der Individuen nach einem Wechsel des sozialen Geschlechts verändern.
Werden auch zwischenmenschliche Beziehungen thematisiert?
Ja, das letzte Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis der Figuren zu anderen Personen vor und nach der Transformation, um Gemeinsamkeiten oder Unterschiede festzustellen.
Kann Gender laut der Arbeit sichtbar gemacht werden?
Die Arbeit geht der Forschungsfrage nach, ob Gender durch Äußerlichkeiten codiert oder manifestiert werden kann und wie Literatur diese Sichtbarkeit herstellt.
- Quote paper
- Riccarda J. Schneider (Author), 2007, Die Darstellung von Geschlechterkonstruktionen in William Shakespeares "As You Like It" und Virginia Woolfs "Orlando", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190127