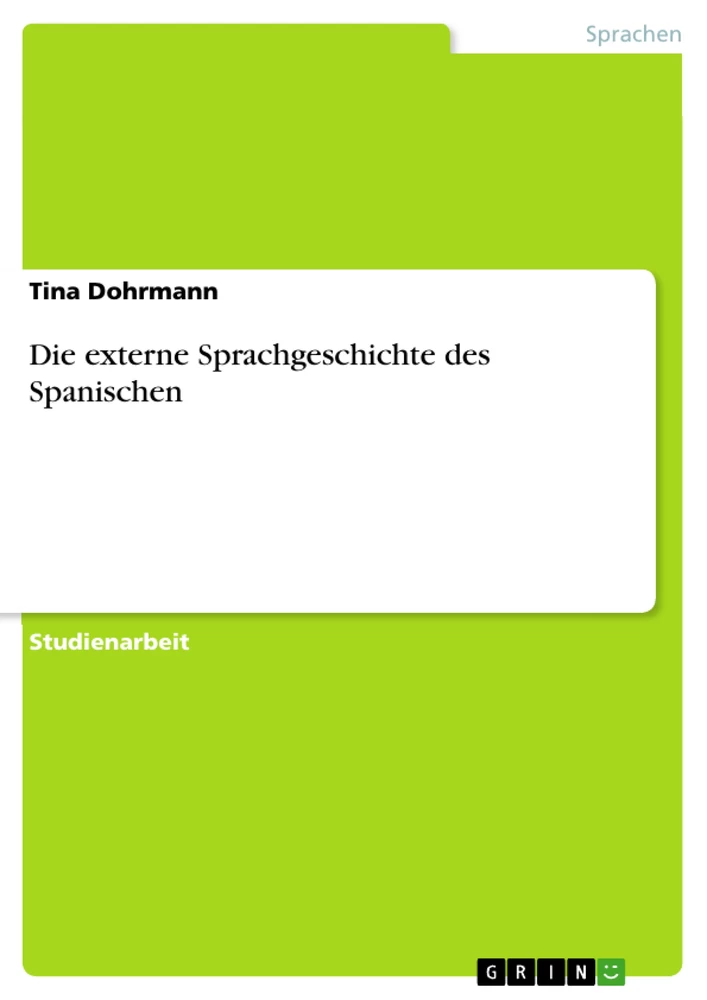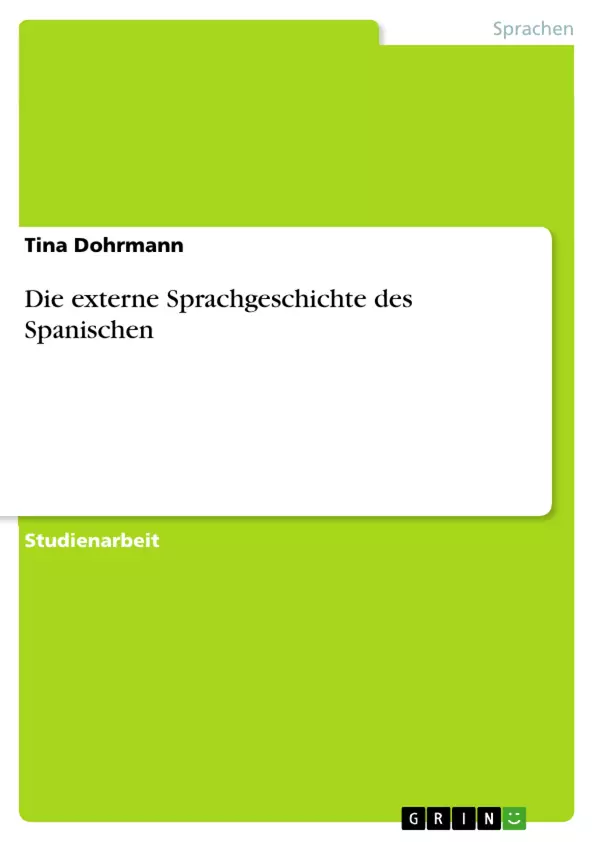„Spanisch ist eine Weltsprache!“. Dieser Satz bewegt heute immer mehr Jugendliche dazu Spanisch zu lernen und sich mit der hispanischen Kultur auseinanderzusetzen. Sowohl kulturell als auch wirtschaftlich gesehen zählt das Erlernen dieser Sprache zu den Trends des 21. Jahrhunderts. Globalisierung und das stetige Wachsen der hispanischen Sprecherfamilie führen dazu, dass das Spanische als wahrer Exportschlager gilt und einen lebhaften Aufschwung erfährt.
Würde man jedoch sagen „Kastilisch ist eine Weltsprache!“, so würde vermutlich der Großteil der deutschen Bevölkerung nicht wissen, dass das Kastilische als Synonym für Spanisch steht.
Das Kastilische, welches zu den romanischen und damit auch zu den indogermanischen Sprachen gehört, wird von ca. 370 Mio. Menschen gesprochen und belegt damit nach Chinesisch und Englisch Platz drei auf der Weltrangliste. Gesprochen wird es auf fast allen Kontinenten: In Europa z. B. in Spanien, Andorra und Gibraltar; in Südamerika von der Bevölkerung z.B. Venezuelas, Perus, Chiles, Argentiniens oder Paraguays; in Mittelamerika wird Spanisch in z.B. Guatemala, Honduras oder Costa Rica gesprochen; in Nordamerika in Mexico und den USA. Auch die Karibik zählt zu den kastilisch geprägten Gebieten mit z.B. Sprechern auf Kuba, in der Dominikanischen Republik oder in Trinidad und Tobago.
Auf dem afrikanischen Kontinent findet man Sprecher in Marokko, in der Westsahara oder Äquatorial- Guinea; in Ostasien auf den Philippinen. (vgl. Dietrich /Geckeler 2004:22 ff.)
Diese Aufzählung zeigt, dass sich das Spanische auf der gesamten Welt ausgebreitet hat.
Die wenigsten wissen jedoch um den Ursprung dieser Weltsprache, der sich daran begründet, dass das Spanische einen langen und wechselvollen geschichtlichen Sprachentwicklungsprozess durchlebt hat, der zum einen intern und zum anderen extern erfolgte.
In dieser Arbeit wird die externe Sprachgeschichte des Spanischen kurz und übersichtsartig vorgestellt, wobei eine Eingrenzung auf die wichtigsten Einflüsse erfolgt. Diese sind der vorromanische Einfluss, die lateinische Grundlage, der germanische und arabische Einfluss und die Entwicklung zum heutigen Spanisch. Auf dieser Grundlage wird geklärt, inwiefern das Kastilische als Ergebnis dieser gelten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die externe Sprachgeschichte des Spanischen
- 2.1 Der vorromanische Einfluss
- 2.2 Die lateinische Grundlage
- 2.3 Der germanische Einfluss
- 2.4 Der arabische Einfluss
- 2.5 Das heutige Spanisch
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der externen Sprachgeschichte des Spanischen und untersucht die wichtigsten Einflüsse auf seine Entwicklung. Dabei wird auf den vorromanischen Einfluss, die lateinische Grundlage, den germanischen und arabischen Einfluss sowie die Entwicklung zum heutigen Spanisch eingegangen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung des Kastilischen als Resultat dieser Einflüsse zu beleuchten.
- Der vorromanische Einfluss auf die spanische Sprache
- Die Rolle des Vulgärlateins als Grundlage des Spanischen
- Der Einfluss germanischer Sprachen auf die Entwicklung des Spanischen
- Die Bedeutung des arabischen Einflusses auf die spanische Sprache
- Die Entwicklung des Kastilischen zum heutigen Spanisch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung des Spanischen als Weltsprache und stellt die historische Entwicklung der Sprache in den Kontext der Globalisierung und des wachsenden Einflusses der hispanischen Kultur. Sie führt den Begriff "Kastilisch" als Synonym für Spanisch ein und beleuchtet die geografische Verbreitung der Sprache auf verschiedenen Kontinenten.
2. Die externe Sprachgeschichte des Spanischen
2.1 Der vorromanische Einfluss
Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen vorromanischen Völker, die die Iberische Halbinsel vor der römischen Eroberung bevölkerten. Es analysiert die sprachlichen Einflüsse der Iberer, Keltiberer, Lusitaner, Tartessier, Phönizier und Basken auf die Entwicklung des Spanischen.
2.2 Die lateinische Grundlage
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Vulgärlateins als Grundlage der romanischen Sprachen, darunter auch das Spanische. Es analysiert die Unterschiede zwischen dem literarischen Schriftlatein und dem umgangssprachlichen Vulgärlatein und erklärt, wie die unterschiedliche Bedeutung der Romanisierung zur Differenzierung des Provinzlateins und damit zur Entwicklung der verschiedenen romanischen Sprachen führte.
Häufig gestellte Fragen
Ist „Kastilisch“ dasselbe wie „Spanisch“?
Ja, im linguistischen und historischen Kontext wird das Kastilische oft als Synonym für die spanische Weltsprache verwendet, da es die Grundlage des heutigen Standards bildet.
Welche Rolle spielt das Vulgärlatein für die spanische Sprache?
Das Vulgärlatein (die gesprochene Umgangssprache der Römer) bildet die fundamentale Basis, aus der sich das Spanische als romanische Sprache entwickelt hat.
Welche externen Einflüsse prägten das Spanische?
Die wichtigsten Einflüsse sind vorromanische Völker (z.B. Iberer, Phönizier, Basken), das Lateinische, germanische Stämme und insbesondere die jahrhundertelange Präsenz der Araber.
Wie viele Menschen sprechen heute weltweit Spanisch?
Es wird von etwa 370 Millionen Muttersprachlern gesprochen und belegt damit Platz drei der Weltrangliste nach Chinesisch und Englisch.
Wo wird Spanisch überall als Amtssprache gesprochen?
Neben Spanien wird es in weiten Teilen Süd-, Mittel- und Nordamerikas (Mexiko, USA) sowie in Teilen Afrikas (Äquatorialguinea) und der Karibik gesprochen.
- Quote paper
- Tina Dohrmann (Author), 2010, Die externe Sprachgeschichte des Spanischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190170