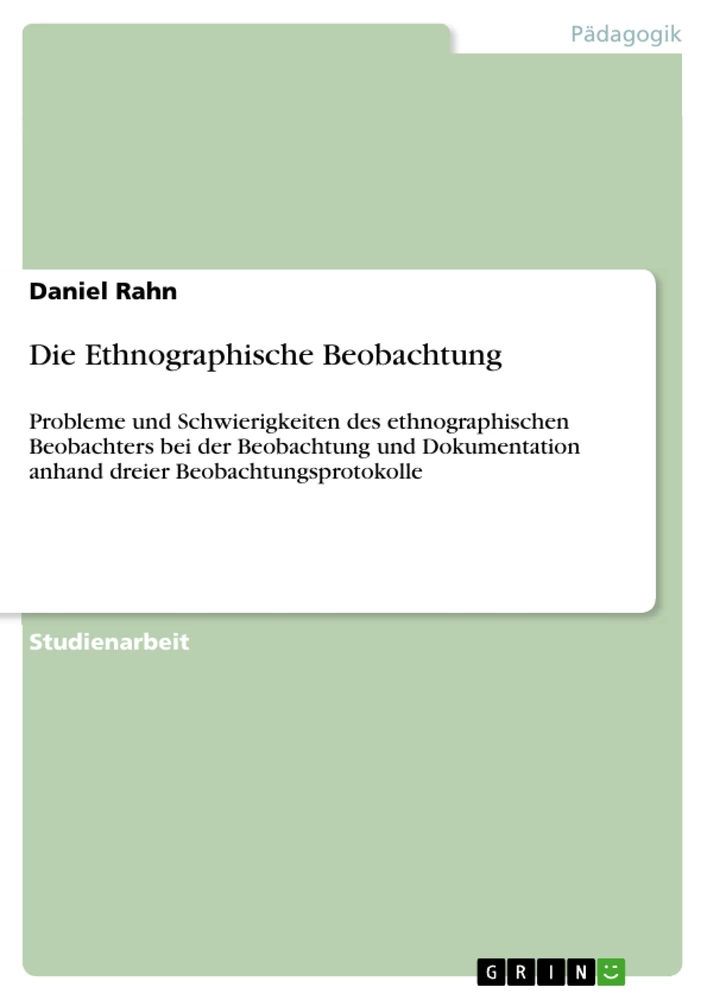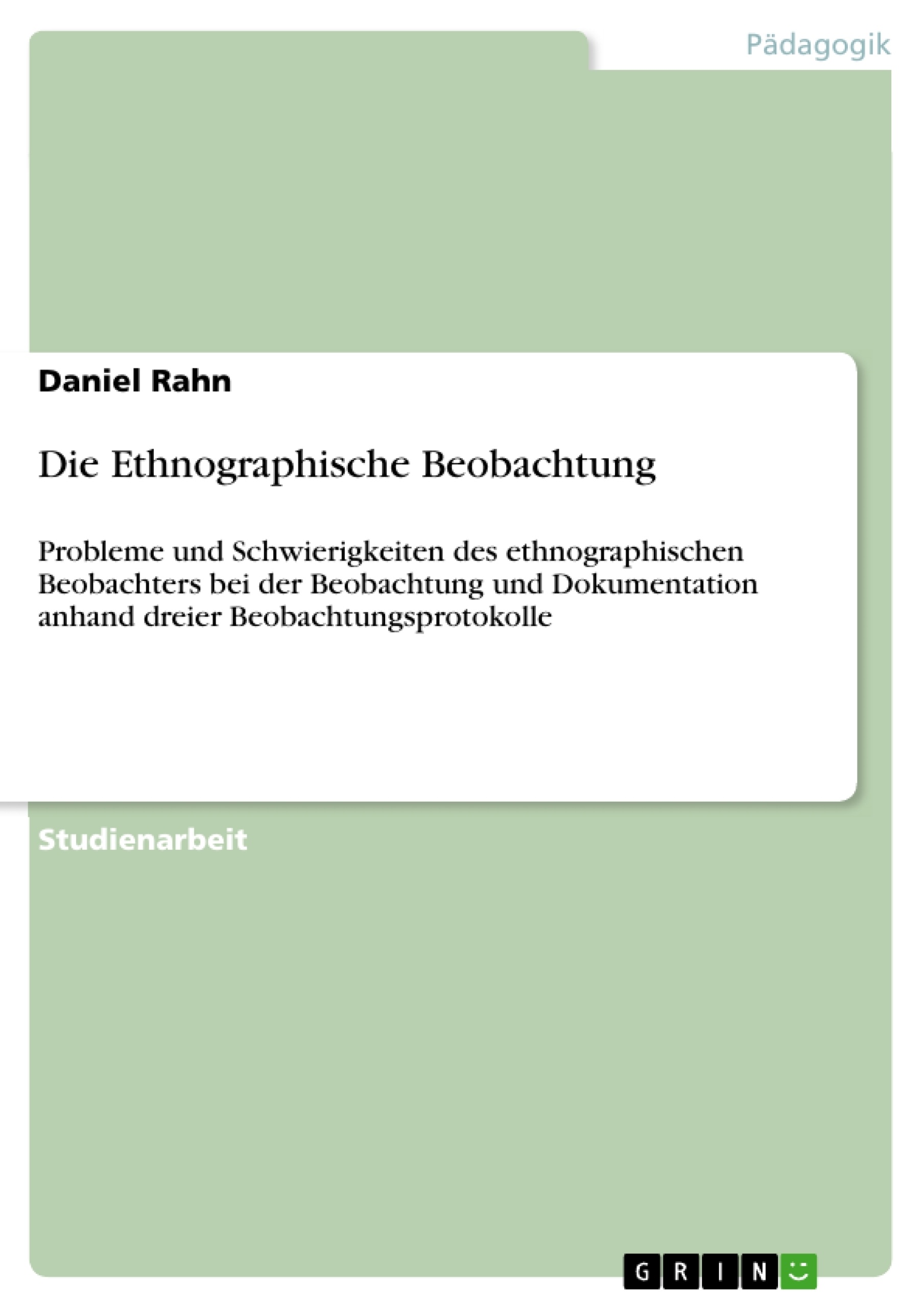Da man während eines Seminars an der Universität und mitten im Studium eher wenig Zeit hat, eine zeitintensive ethnographische Forschung zu betreiben und in einer fremden Kultur zu leben bzw. in sie einzutauchen, war mir eben dieses Eintauchen nicht möglich. Vielmehr ging es darum, die Möglichkeiten und Probleme des Ethnographen sowie der ethnographischen Forschung, Beobachtung, Dokumentation und Vertextlichung zu erfahren und sich teilweise selbst zu erschließen. Es ging demnach eher darum, das grobe Gerüst der Ethnographie zu besichtigen.
Auch die drei eigens angefertigten Beobachtungsprotokolle (s.u.) hatten u.a. das Ziel, uns die Möglichkeiten aber auch die Schwierigkeiten der ethnographischen Beobachtung und Dokumentation aufzuzeigen. Mit diesen Schwierigkeiten beschäftigt sich die folgende Arbeit.
Im ersten Teil werde ich auf die Schwierigkeiten und Probleme während des Beobachtungsprozesses von Begrüßungssituationen im Kindergarten eingehen, diese anhand von drei Beo-bachtungsprotokollen benennen und ggf. Wege aufzeigen, wie einige Probleme hätten vermieden werden können.
Meine Beobachtungen erfolgten in einer Deutsch-spanischen Kindertagesstätte, in der ich auch angestellt bin. Hierbei tat sich für mich der Vorteil auf, dass ich mich entgegen dem „klassischen“ Eintauchen in eine fremde Kultur, nicht mit der Fremde vertraut machen musste, sondern mit ihr bereits vertraut war. Ich musste also auch nicht um die Kreditwürdigkeit im kalthoffschen Sinne (s.u.) kämpfen. Vielmehr trat das Problem der Rollenfindung als Ethnograph und gleichzeitig als Pädagoge in dieser Einrichtung sowie das der Verfremdung des eigentlich Bekannten auf – dazu unten mehr.
Beim ersten Beobachtungsprotokoll habe ich mich auf die Begrüßungssituation zwischen Kindern und Erzieherinnen sowie Eltern und Kind fokussiert, während des zweiten Beobachtungsprotokolls auf das Begrüßungsgeschehen der Kindern untereinander fokussiert und während des dritten auf die Begrüßung zwischen Kindern und zwischen Kindern und Eltern. Ziel war es zu sehen, ob und wie Kinder sich untereinander begrüßen und wie sie Erwachsene begrüßen oder von Erwachsenen begrüßt werden.
[..]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schwierigkeiten und Probleme des Beobachtens und Dokumentierens
- 2.1 Was beschreibe ich?
- 2.2 Ethische Bedenken
- 2.3 Über die Probleme der Beobachterrolle, wenn man mit dem Feld vertraut ist
- 2.3.1 Welche Rolle nehme ich ein?
- 2.3.2 Flüchtigkeit des Sozialen, selektive Wahrnehmung und das „Problem“ des Feldnotizbuches
- 3. Exzerpt der Studie „Wohlerzogenheit – Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen“ von Herbert Kalthoff
- 3.1 Überblick
- 3.2 Aufbau der Studie
- 3.3 Ausschnitte aus der Studie
- 3.4 Schlussbemerkungen, Kritik
- 4. Resümee und Fazit
- 5. Anhang
- 5.1 Beobachtungsprotokoll 1
- 5.2 Beobachtungsprotokoll 2
- 5.3 Beobachtungsprotokoll 3
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schwierigkeiten und Probleme, die ein ethnographischer Beobachter bei der Beobachtung und Dokumentation von Begrüßungssituationen in einer deutsch-spanischen Kindertagesstätte erlebt. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Rollenfindung, der ethischen Aspekte der Beobachtung intimen sozialen Interaktionen und die Schwierigkeiten, die sich aus der Vertrautheit des Beobachters mit dem Feld ergeben. Die Arbeit analysiert diese Herausforderungen anhand von drei Beobachtungsprotokollen und vergleicht sie mit den Erfahrungen einer etablierten ethnographischen Studie.
- Herausforderungen der ethnographischen Beobachtung und Dokumentation
- Ethische Implikationen der Beobachtung intimen sozialen Verhaltens
- Die Rolle des Beobachters in einem vertrauten Feld
- Analyse von Begrüßungssituationen in einem multikulturellen Kontext
- Vergleich mit etablierten ethnographischen Studien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ethnographischen Feldforschung ein und definiert den Forschungsansatz. Sie beschreibt die teilnehmende Beobachtung als Methode und erläutert die Wahl der Begrüßungssituationen in einer bekannten Kindertagesstätte als Forschungsobjekt. Die Arbeit fokussiert auf die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der ethnographischen Beobachtung, besonders im Kontext der Vertrautheit mit dem Feld, und nicht auf die umfassende Durchführung einer längeren Feldstudie. Die drei Beobachtungsprotokolle im Anhang dienen als Grundlage der Analyse.
2. Schwierigkeiten und Probleme des Beobachtens und Dokumentierens: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen, die der Autor während des Beobachtungsprozesses und der Dokumentation erlebt hat. Es behandelt die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Begrüßungssituationen, die Dauer der Beobachtung und die ethischen Bedenken bezüglich der Beobachtung intimer Momente. Die subjektiven Wahrnehmungen und Gefühle des Autors werden mit wissenschaftlichen Arbeiten verknüpft.
Schlüsselwörter
Ethnographische Beobachtung, teilnehmende Beobachtung, Dokumentation, Begrüßungssituationen, Kindergarten, ethische Aspekte, Rollenfindung, Feldforschung, Vertrautheit mit dem Feld, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zu: Ethnographische Beobachtung von Begrüßungssituationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Schwierigkeiten und Probleme, die ein ethnographischer Beobachter bei der Beobachtung und Dokumentation von Begrüßungssituationen in einer deutsch-spanischen Kindertagesstätte erlebt. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen der Rollenfindung, ethischen Aspekten und den Schwierigkeiten, die sich aus der Vertrautheit des Beobachters mit dem Feld ergeben.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Methode der teilnehmenden Beobachtung. Drei Beobachtungsprotokolle, die im Anhang detailliert dargestellt sind, bilden die Grundlage der Analyse. Die Ergebnisse werden zudem mit einer etablierten ethnographischen Studie verglichen (Kalthoff, "Wohlerzogenheit – Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen").
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet folgende Themenschwerpunkte: Herausforderungen der ethnographischen Beobachtung und Dokumentation; Ethische Implikationen der Beobachtung intimen sozialen Verhaltens; Die Rolle des Beobachters in einem vertrauten Feld; Analyse von Begrüßungssituationen in einem multikulturellen Kontext; Vergleich mit etablierten ethnographischen Studien.
Welche Schwierigkeiten wurden bei der Beobachtung festgestellt?
Die Arbeit beschreibt Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Begrüßungssituationen, der Dauer der Beobachtung und die ethischen Bedenken bezüglich der Beobachtung intimer Momente. Es wird auf die subjektiven Wahrnehmungen und Gefühle des Autors und deren Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten eingegangen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Schwierigkeiten der Beobachtung und Dokumentation, ein Kapitel mit einem Exzerpt der Studie von Kalthoff, ein Resümee, einen Anhang mit den Beobachtungsprotokollen und ein Literaturverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ethnographische Beobachtung, teilnehmende Beobachtung, Dokumentation, Begrüßungssituationen, Kindergarten, ethische Aspekte, Rollenfindung, Feldforschung, Vertrautheit mit dem Feld, qualitative Forschung.
Welche Rolle spielt die Studie von Herbert Kalthoff?
Die Studie "Wohlerzogenheit – Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen" von Herbert Kalthoff dient als Vergleichsbasis. Die Arbeit analysiert Ausschnitte aus dieser Studie und vergleicht die darin beschriebenen Erfahrungen mit den eigenen Beobachtungen und Herausforderungen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Personen gedacht, die sich für ethnographische Feldforschung, qualitative Forschungsmethoden und die Herausforderungen der Beobachtung im Kontext der Vertrautheit mit dem Feld interessieren. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke konzipiert.
Wo finde ich die Beobachtungsprotokolle?
Die drei Beobachtungsprotokolle befinden sich im Anhang der Arbeit (Kapitel 5).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Resümee und Fazit (Kapitel 4) fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen. Es werden die Herausforderungen und Grenzen der ethnographischen Beobachtung in einem vertrauten Feld reflektiert.
- Citar trabajo
- Daniel Rahn (Autor), 2011, Die Ethnographische Beobachtung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190184