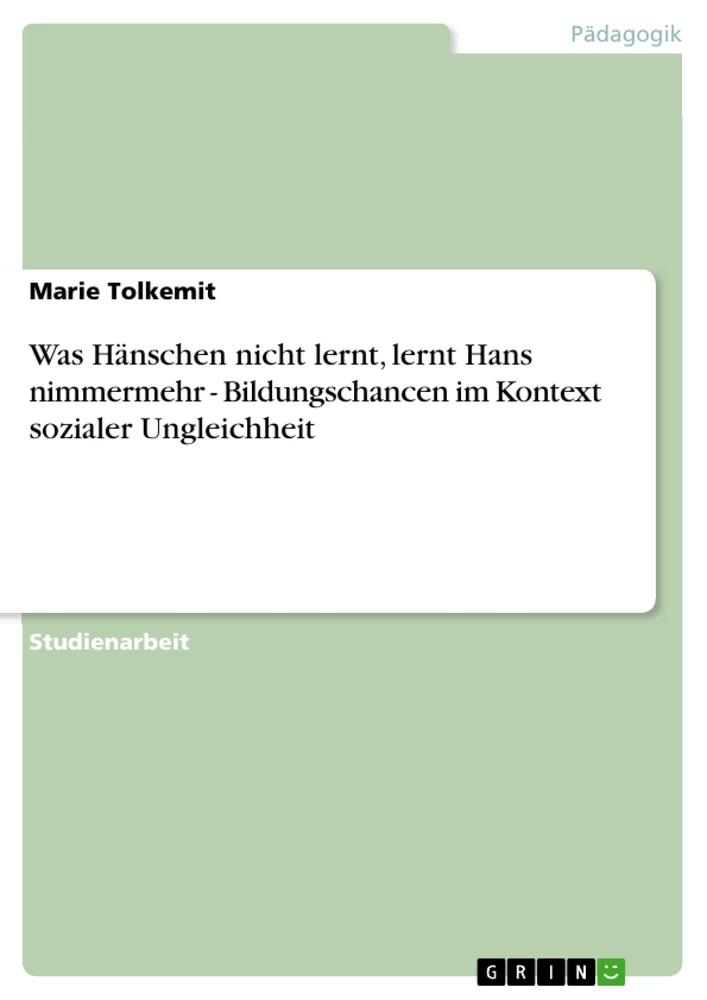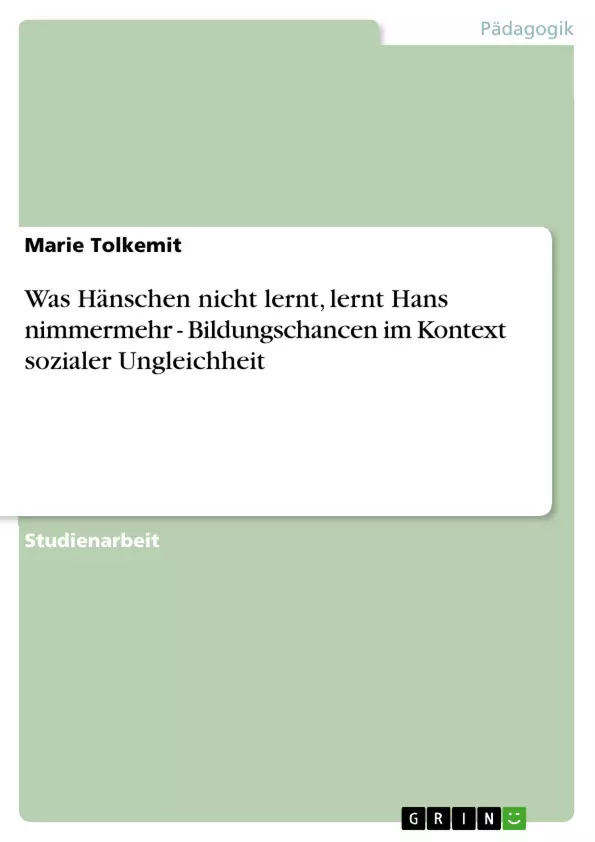Bildung ist eine zentrale, individuelle und gesellschaftliche Ressource des 21. Jahrhunderts (Quenzel/ Hurrelmann 2010: 13). Der Bildungsgrad eines Menschen entscheidet über dessen Chancen auf einen guten Lebensstandard, beruflichen Erfolg, soziale Sicherheit, auf soziale, kulturelle, gesellschaftliche und politischen Teilhabemöglichkeiten sowie auf gesellschaftliches Ansehen, Gesundheit, Selbstbestimmung und Freiheit (Solga/ Dombrowski 2009: 7; Geißler/ Weber-Menges 2009: 155). Die Bereitstellung gleicher Bildungschancen für alle Mitglieder der Bevölkerung ist folglich Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit in einer Gesellschaft (Geißler/ Weber-Menges 2009: 155).
In Deutschland ist diese Voraussetzung jedoch nicht erfüllt. Dies ist lange bekannt und durch verschiedene Studien zum wiederholten Mal nachgewiesen (Mindermann/ Schmidt/ Wippler 2012: 11). Denn in Deutschland sind soziale Herkunft und Bildungschancen stark korreliert (Geißler/ Weber-Menges 2009: 155).
Mit der Geburt gelangt ein Kind in seine Herkunftsfamilie, welche über einen bestimmten Pool an Ressourcen verfügt der schließlich einen großen Einfluss auf die Sozialisation des Kindes hat, hier beginnt die Chancenungleichheit. Institutionen der Erziehung und Bildung (Kindergarten und Schule) mit denen Kinder im Laufe ihres Lebens in Berührung kommen schaffen es in Deutschland meist nur unzureichend, Herkunft und Bildungschancen zu entkoppeln (Bos/ Schwippert/ Stubbe 2007: 225; Lankes 2009: 153).
Der erste Teil dieser Ausarbeitung wird daher die Ursachen sozi¬aler Ungleichheit im Bil-dungsbereich betrachten und die aktuellen Situation darstellen.
Als Deutschland im Jahr 2000 den „Spitzenplatz“ im Bereich der Chancenungleichheit im Bereich Lesen erzielte, wurden zahlreiche Stimmen laut, die Strategien zur Herstellung gleicher Bildungschanen forderten. Eine Maßnahme wird exemplarisch in Kapitel drei vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung zur Entkopplung von Herkunft und Bildungschancen untersucht: die Lesekompetenzförderung. Denn Lesen ist die grundlegende Voraussetzung für den Bildungserwerb. Lesen eröffnet den Zugang zur Medienwelt, die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben und befähigt so nicht zuletzt zum lebenslangen Lernen (Bundesministerium für Bildung und Forschung (im weiteren BMBF) 2007: 6; Bartnitzky 2006: 8; Klieme et al. 2010b: 23; Artelt et al. 2001: 133).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Definition Chancenungleichheit
- Ursachen von Chancenungleichheit
- Ausprägungen der Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Lesekompetenzförderung als Maßnahme zur Herstellung gleicher Bildungschancen
- Definition Lesekompetenz
- Projekte zur Lesekompetenzförderung
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem und die Rolle der Lesekompetenzförderung bei der Herstellung gleicher Bildungschancen. Sie befasst sich mit den Ursachen sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich und analysiert die aktuellen Herausforderungen.
- Die Definition von Chancenungleichheit und ihre Ausprägungen im Bildungsbereich
- Die Ursachen sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich, insbesondere die Rolle der sozialen Herkunft
- Die Bedeutung der Lesekompetenzförderung als Maßnahme zur Herstellung gleicher Bildungschancen
- Die Analyse von Projekten und Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz
- Die Auswirkungen der Lesekompetenzförderung auf die Bildungschancen von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Herkünften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Bildung als zentrale Ressource für den Einzelnen und die Gesellschaft dar. Sie betont die Notwendigkeit gleicher Bildungschancen für alle und verdeutlicht die aktuelle Situation der Chancenungleichheit in Deutschland. Die Arbeit fokussiert sich auf die Rolle der sozialen Herkunft und die Möglichkeiten der Lesekompetenzförderung als Maßnahme zur Herstellung gleicher Bildungschancen.
2. Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Chancenungleichheit, ihren Ursachen und ihrer Ausprägung im deutschen Bildungssystem. Es analysiert die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und zeigt die Unterschiede im Bildungserfolg von Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten auf.
3. Lesekompetenzförderung als Maßnahme zur Herstellung gleicher Bildungschancen
Kapitel 3 widmet sich der Lesekompetenzförderung als Maßnahme zur Herstellung gleicher Bildungschancen. Es definiert den Begriff der Lesekompetenz und erläutert seine Bedeutung für den Bildungserfolg. Das Kapitel stellt verschiedene Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz vor und untersucht ihre Wirksamkeit im Hinblick auf die Entkopplung von Herkunft und Bildungschancen.
Schlüsselwörter
Chancenungleichheit, Bildungssystem, soziale Ungleichheit, soziale Herkunft, Lesekompetenz, Lesekompetenzförderung, Bildungsgerechtigkeit, Bildungschancen, Projekte, Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen soziale Herkunft und Bildungschancen in Deutschland zusammen?
In Deutschland sind soziale Herkunft und Bildungserfolg stark korreliert; Kinder aus ressourcenstarken Familien haben deutlich bessere Chancen auf höhere Bildungsabschlüsse.
Warum ist Lesekompetenz so entscheidend für Bildungsgerechtigkeit?
Lesen ist die Grundvoraussetzung für den Wissenserwerb in fast allen Bereichen. Es ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und ist die Basis für lebenslanges Lernen.
Was war der Auslöser für die verstärkte Förderung der Lesekompetenz?
Die Ergebnisse der PISA-Studie im Jahr 2000, bei der Deutschland im Bereich Lesekompetenz und Chancenungleichheit schlecht abschnitt, führten zu neuen Strategien.
Können Kindergarten und Schule die Herkunftseffekte ausgleichen?
Die Arbeit stellt fest, dass Bildungsinstitutionen in Deutschland es bisher nur unzureichend schaffen, Herkunft und Bildungschancen voneinander zu entkoppeln.
Welche Ressourcen der Herkunftsfamilie beeinflussen die Sozialisation?
Dazu gehören ökonomische Mittel, aber auch kulturelle Ressourcen wie der Zugang zu Büchern, Bildungssprache und die Unterstützung bei schulischen Anforderungen.
Was wird im Kapitel über Lesekompetenzförderung untersucht?
Es werden beispielhaft Projekte vorgestellt und analysiert, ob sie geeignet sind, die Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Schichten zu verringern.
- Quote paper
- Bachelor of Science Marie Tolkemit (Author), 2012, Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr - Bildungschancen im Kontext sozialer Ungleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190212