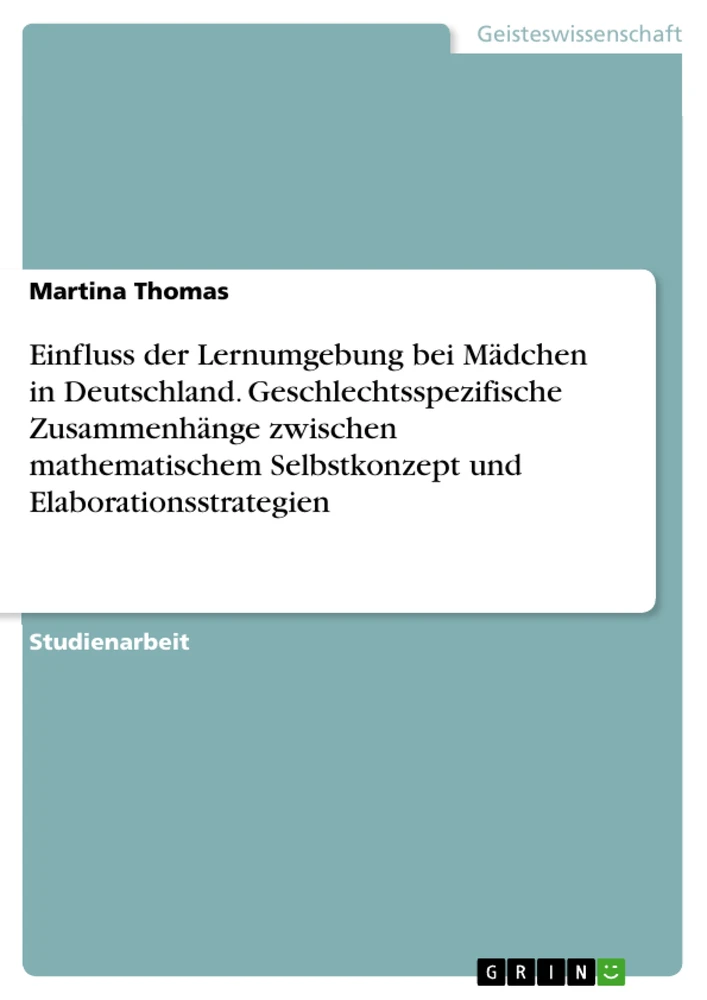„Jungen können besser rechnen, Mädchen besser lesen, denn die Talente sind eben ungleich verteilt. Stimmt gar nicht, sagen US-Forscher: Schülerinnen lösen Mathe-Aufgaben ähnlich gut wie Schüler -wenn sie nur an sich glauben und niemand ihnen eine Rechenschwäche einredet.“ (SPIEGEL online, 2010)
Geschlechtsstereotype wie im ersten Teil des o.g. Zitates beschrieben, scheinen nach wie vor weit verbreitet zu sein, wobei die in internationalen Vergleichsstudien auftretenden Differenzen in den Mathematikkompetenzen diese Vorurteile vordergründig bestätigen. So schneiden Mädchen bei den Mathematikleistungen im Rahmen der Pisa Studie 2003 schlechter ab als Jungen. Auffällig ist, dass Mädchen im Bereich Mathematik Schwierigkeiten haben, offene Problemstellungen modellierend zu erschließen. Sie setzen laut Budde (Budde, 2009, S. S. 20f.) seltener Elaborationsstrategien ein. Doch rstaunlicherweise
scheint dieses Defizit auf das Fach Mathematik beschränkt zu sein Mädchen schnitten in der Kategorie Problemlösen sogar geringfügig besser ab als die Jungen.
Da stabile biologische Ursachen für die differentiellen Mathematikleistungen nicht nachgewiesen sind (Budde, 2009, S.24), gilt es nach Umwelteinflüssen zu suchen, die das schlechtere Abschneiden der Mädchen in Vergleichstests erklären können. Insofern, als Einflüsse der sozialen Umwelt gestaltbar sind,
könnte also die Identifikation hinderlicher Faktoren einen Beitrag leisten, Rahmenbedingungen so zu verändern, dass sich die mathematischen Kompetenzen der Mädchen verbessern.
Eine zusätzliche gesellschaftliche Relevanz erhält die Thematik aufgrund des antizipierten Fachkräftemangels in den so genannten MINT-Berufen, von dem eine akute Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland befürchtet wird (vgl. Mint Zukunft). Idealerweise gilt es also, die Mädchen in diesem Bereich zu fördern und für mathematisch-technische Berufe zu begeistern.
Im Rahmen dieser Arbeit soll daher untersucht werden, ob bzw. inwieweit die Lernumgebung eventuell bestehende Zusammenhänge zwischen mathematischem Selbstvertrauen und der Verwendung adäquater Lernstrategien mit beeinflusst. Genauer gesagt: ob sich ein vermeintliches Bedingungsgefüge zwischen den genannten personalen Faktoren bei Mädchen in Abwesenheit von Jungen ändert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Herleitung der Fragestellung
- 3 Operationalisierung der Variablen
- 4 Methodik
- 4.1 Stichprobenziehung
- 4.2 Datenerhebung
- 5 Darstellung der Ergebnisse
- 6 Interpretation
- 6.1 kritische Reflexion des Vorgehens
- 6.2 Inhaltliche Interpretation
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen mathematischem Selbstkonzept und der Anwendung von Elaborationsstrategien bei Mädchen in Deutschland. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss der Lernumgebung, insbesondere darauf, ob die Anwesenheit von Jungen einen Einfluss auf diese Zusammenhänge hat. Ziel ist es, mögliche Faktoren zu identifizieren, die das mathematische Selbstvertrauen und die Nutzung effektiver Lernstrategien bei Mädchen beeinflussen.
- Einfluss der Lernumgebung (koedukativ vs. monoedukativ) auf das mathematische Selbstkonzept von Mädchen
- Zusammenhang zwischen mathematischem Selbstkonzept und der Anwendung von Elaborationsstrategien bei Mädchen
- Unterschiede in der Anwendung von Elaborationsstrategien zwischen Mädchen und Jungen
- Analyse von Geschlechterstereotypen im Bezug auf mathematische Fähigkeiten
- Beitrag zur Verbesserung der mathematischen Kompetenzen von Mädchen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Ausgangssituation: Mädchen schneiden in internationalen Vergleichsstudien wie PISA in Mathematik schlechter ab als Jungen. Es wird die These aufgestellt, dass dies nicht auf biologische Faktoren zurückzuführen ist, sondern auf Umwelteinflüsse. Die Arbeit untersucht deshalb den Einfluss der Lernumgebung auf den Zusammenhang zwischen mathematischem Selbstkonzept und der Verwendung von Elaborationsstrategien bei Mädchen. Die gesellschaftliche Relevanz wird durch den bestehenden Fachkräftemangel in MINT-Berufen hervorgehoben.
2 Herleitung der Fragestellung: Dieses Kapitel vertieft die Problematik. Es wird erläutert, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen seltener Elaborationsstrategien im Mathematikunterricht einsetzen. Elaborationsstrategien werden als wichtige Lernstrategie für das Verständnis offener mathematischer Problemstellungen definiert. Die Arbeit zitiert Studien, die auf einen Zusammenhang zwischen geringerem mathematischem Selbstvertrauen und dem bevorzugten Gebrauch von weniger effektiven Strategien hinweisen. Die Forschungsfrage wird präzisiert: Ändert sich der Zusammenhang zwischen mathematischem Selbstvertrauen und der Anwendung von Elaborationsstrategien bei Mädchen, wenn sie ohne Jungen lernen?
Schlüsselwörter
Mathematisches Selbstkonzept, Elaborationsstrategien, Lernumgebung, Geschlechterunterschiede, Mathematik, Koedukation, Monoedukation, PISA-Studie, MINT-Berufe, Selbstwirksamkeitserwartung, Geschlechterstereotype.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Einfluss der Lernumgebung auf das mathematische Selbstkonzept und die Anwendung von Elaborationsstrategien bei Mädchen
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem mathematischen Selbstkonzept von Mädchen und der Anwendung von Elaborationsstrategien im Mathematikunterricht. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einfluss der Lernumgebung – koedukativ (mit Jungen) versus monoedukativ (ohne Jungen).
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ändert sich der Zusammenhang zwischen mathematischem Selbstvertrauen und der Anwendung von Elaborationsstrategien bei Mädchen, wenn sie ohne Jungen lernen? Die Arbeit untersucht, ob die Anwesenheit von Jungen einen Einfluss auf das mathematische Selbstkonzept und die Wahl der Lernstrategien bei Mädchen hat.
Welche Variablen werden untersucht?
Die wichtigsten Variablen sind das mathematische Selbstkonzept der Mädchen, die Anwendung von Elaborationsstrategien und der Typ der Lernumgebung (koedukativ vs. monoedukativ). Die Studie analysiert den Zusammenhang zwischen diesen Variablen.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit beschreibt die Stichprobenziehung und die Datenerhebungsmethode, jedoch werden die spezifischen Methoden nicht im Preview detailliert dargestellt. Es wird lediglich erwähnt, dass die Arbeit sich auf die Analyse des Zusammenhangs zwischen den genannten Variablen konzentriert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Der Preview enthält keine konkreten Ergebnisse. Die Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation erfolgen im Hauptteil der Arbeit.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
Die Interpretation der Ergebnisse umfasst eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens und eine inhaltliche Interpretation der gefundenen Zusammenhänge. Diese Details werden im Hauptteil der Arbeit vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mathematisches Selbstkonzept, Elaborationsstrategien, Lernumgebung, Geschlechterunterschiede, Mathematik, Koedukation, Monoedukation, PISA-Studie, MINT-Berufe, Selbstwirksamkeitserwartung, Geschlechterstereotype.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Herleitung der Fragestellung, Operationalisierung der Variablen, Methodik (inkl. Stichprobenziehung und Datenerhebung), Darstellung der Ergebnisse, Interpretation (inkl. kritischer Reflexion und inhaltlicher Interpretation), Zusammenfassung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, mögliche Faktoren zu identifizieren, die das mathematische Selbstvertrauen und die Nutzung effektiver Lernstrategien bei Mädchen beeinflussen. Sie möchte den Einfluss der Lernumgebung auf diese Zusammenhänge untersuchen und einen Beitrag zur Verbesserung der mathematischen Kompetenzen von Mädchen leisten.
Welche gesellschaftliche Relevanz hat die Arbeit?
Die gesellschaftliche Relevanz wird durch den bestehenden Fachkräftemangel in MINT-Berufen und die in internationalen Vergleichsstudien (wie PISA) festgestellte schlechtere Leistung von Mädchen im Mathematikunterricht begründet.
- Quote paper
- Martina Thomas (Author), 2011, Einfluss der Lernumgebung bei Mädchen in Deutschland. Geschlechtsspezifische Zusammenhänge zwischen mathematischem Selbstkonzept und Elaborationsstrategien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190217