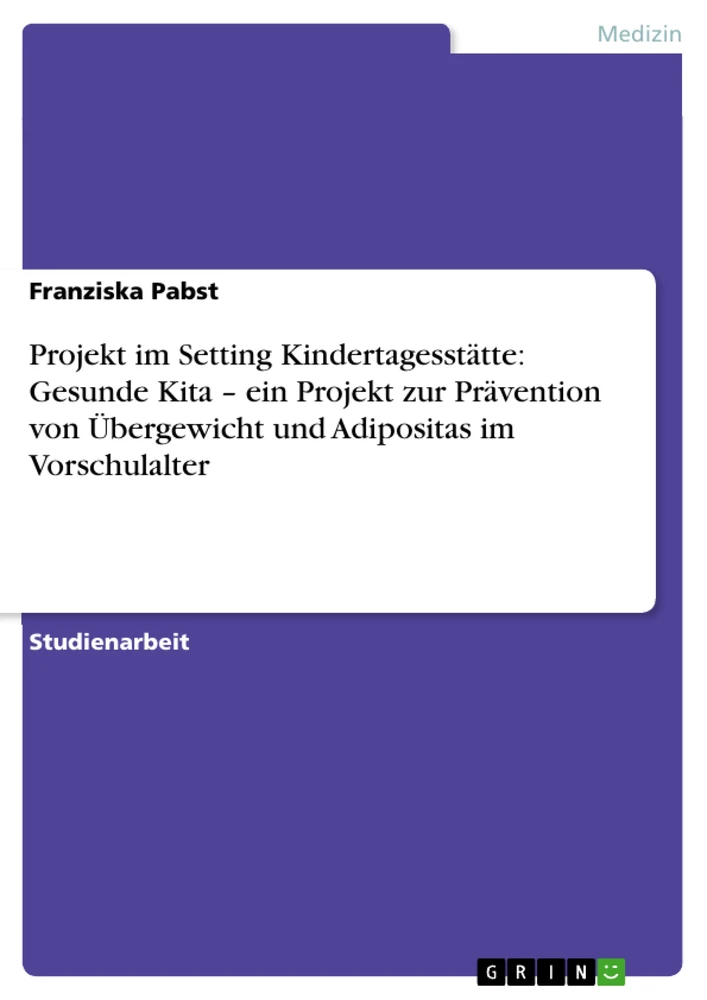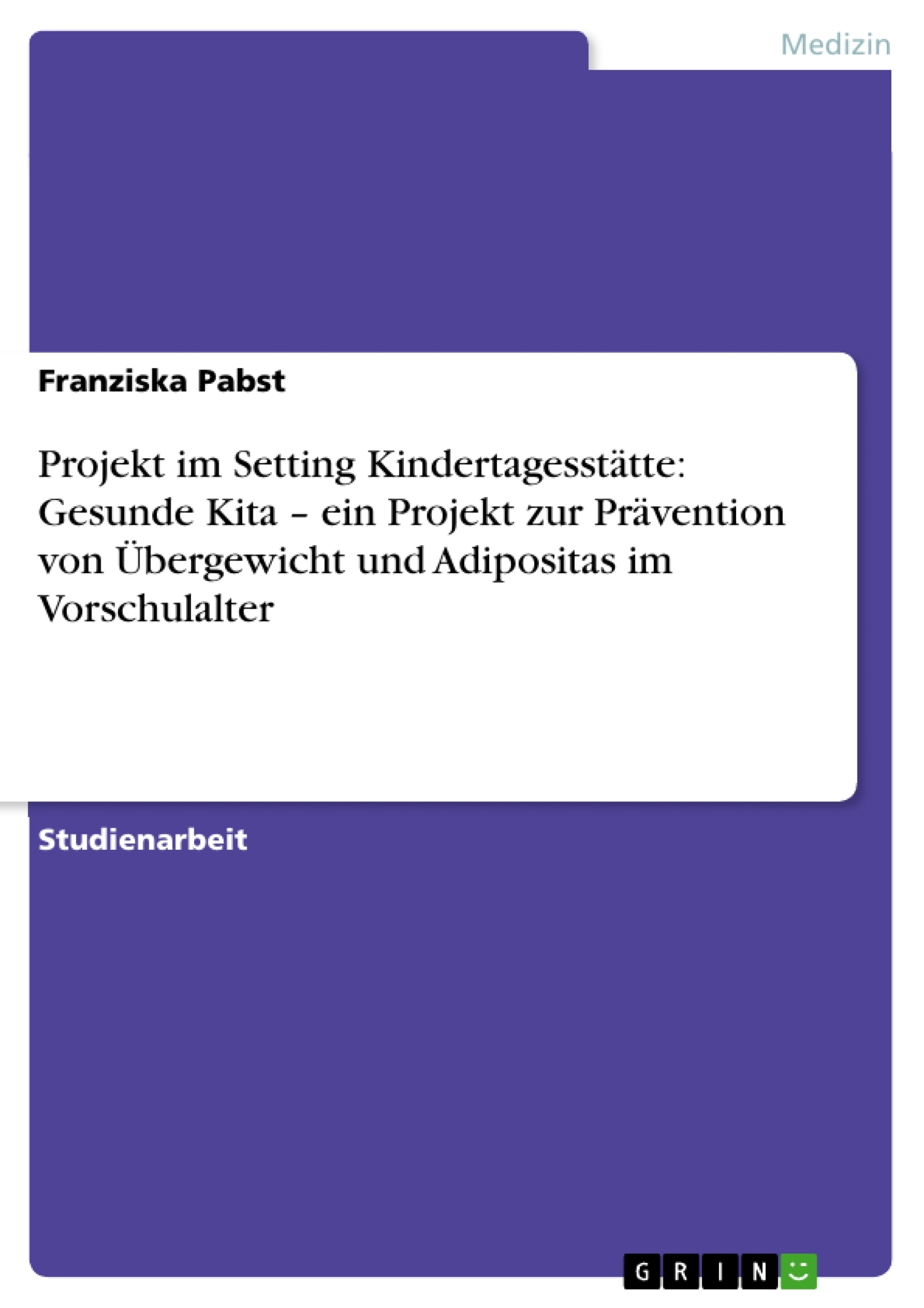Übergewicht und Adipositas sind zentrales Thema der aktuellen Gesundheitsforschung in Deutschland.
Studien belegen die erschreckenden und steigenden Zahlen der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft.
Adipositas wird als Grundproblem vieler Folgeerkrankungen, wie erhöhter Cholesterinwerte, erhöhtem systolischen Blutdruck und erhöhtem Diabetes mellitus-Risiko angesehen und stellt gerade im Kindesalter eine erhebliche Einschränkung wichtiger Entwicklungsstufen, sowohl in psychischer, physischer, als auch in psychosozialer Ebene dar (vgl. Goldapp & Mann, 2004, S. 14).
Deshalb sind Prävention und zielgerichtete Gesundheitserziehung schon im frühen Kindesalter wichtig und sinnvoll.
Das vorgestellte Projekt beschäftigt sich daher mit der Gesundheitserziehung hinsichtlich Bewegung und Ernährung von Kindern im Setting Kindergarten, speziell in den Vorschulgruppen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung der Gesundheitserziehung in der Kita
- Ursachen von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- Gesundheitsressourcen von Kindern und Jugendlichen zum Thema Adipositas
- Zielstellung des Projektes
- Rahmenbedingungen des Projektes
- Zeitlicher Rahmen
- Design
- Involvierte Akteure, Kooperationen, Vernetzung
- Zugrundeliegende Theorie des Gesundheitsverhaltens
- Evaluationskriterien
- Geplante Interventionen vor dem Hintergrund der Ottawa-Charta
- Handlungsstrategien des Projektes
- Aktionsfelder des Projektes
- Erwartete Ergebnisse
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Projekt zielt darauf ab, die Prävention von Übergewicht und Adipositas im Vorschulalter im Setting Kindergarten zu fördern. Dabei werden sowohl die Kinder als auch ihre Eltern und die Erzieher in die Gesundheitsförderung einbezogen.
- Bedeutung der Gesundheitserziehung in der Kita
- Ursachen von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- Entwicklung eines Präventionsprojektes im Setting Kindergarten
- Einbindung der Ottawa-Charta in die Handlungsstrategien
- Erwartete Ergebnisse des Projektes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel stellt die Relevanz der Thematik Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland dar. Es beleuchtet die Bedeutung der Gesundheitserziehung im Kindergarten als wichtige Institution der Sozialisation von Kindern. Die Ottawa-Charta wird als zentrales Instrument der Gesundheitsförderung vorgestellt.
Bedeutung der Gesundheitserziehung in der Kita
Das Kapitel vertieft die Rolle des Kindergartens in der Prävention von Übergewicht und Adipositas. Es werden die Vorteile des Settings Kindergarten für die Gesundheitsförderung, die unterschiedlichen Zielgruppen und die Schnittstelle zwischen professioneller Arbeit und Erziehung im häuslichen Umfeld aufgezeigt.
Ursachen von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Es werden soziale Benachteiligung, familiäre Essverhaltensstörungen und die Bedeutung einer gesunden Ernährung als wichtige Faktoren diskutiert.
Rahmenbedingungen des Projektes
Hier werden die Rahmenbedingungen des Projektes „Gesunde Kita“ detailliert dargestellt. Dazu gehören der zeitliche Rahmen, das Design, die involvierten Akteure und die zugrundeliegende Theorie des Gesundheitsverhaltens.
Geplante Interventionen vor dem Hintergrund der Ottawa-Charta
Dieses Kapitel beschreibt die geplanten Interventionen des Projektes. Dabei werden die Handlungsstrategien und Aktionsfelder vor dem Hintergrund der Ottawa-Charta erläutert.
Erwartete Ergebnisse
Das Kapitel skizziert die erwarteten Ergebnisse des Projektes, wie zum Beispiel eine Verbesserung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens der Kinder sowie eine Steigerung der Gesundheitskompetenz der Eltern und Erzieher.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes umfassen Adipositas, Prävention, Gesundheitserziehung, Kindergarten, Ottawa-Charta, Settingansatz, Essverhalten, Bewegung, soziale Benachteiligung, Gesundheitsressourcen, Kinder und Jugendliche.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Gesundheitserziehung in der Kita so wichtig?
Da sich Ess- und Bewegungsgewohnheiten bereits im frühen Kindesalter festigen, ist die Kita ein idealer Ort, um Übergewicht und Adipositas präventiv entgegenzuwirken.
Was sind die Hauptursachen für Adipositas bei Kindern?
Neben genetischen Faktoren spielen soziale Benachteiligung, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und familiäre Verhaltensmuster eine entscheidende Rolle.
Welche Rolle spielt die Ottawa-Charta für das Projekt?
Die Ottawa-Charta dient als Leitfaden für die Gesundheitsförderung, indem sie Strategien wie die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten und die Stärkung persönlicher Kompetenzen vorgibt.
Wie werden Eltern in das Projekt "Gesunde Kita" eingebunden?
Eltern werden durch Informationsangebote und Beratung einbezogen, um die Schnittstelle zwischen professioneller Erziehung in der Kita und dem häuslichen Umfeld zu stärken.
Welche Interventionen sind zur Bewegungsförderung geplant?
Geplant sind gezielte Spiel- und Bewegungsangebote im Alltag der Vorschulkinder, die Spaß vermitteln und motorische Fähigkeiten spielerisch verbessern.
- Citar trabajo
- Franziska Pabst (Autor), 2011, Projekt im Setting Kindertagesstätte: Gesunde Kita – ein Projekt zur Prävention von Übergewicht und Adipositas im Vorschulalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190309