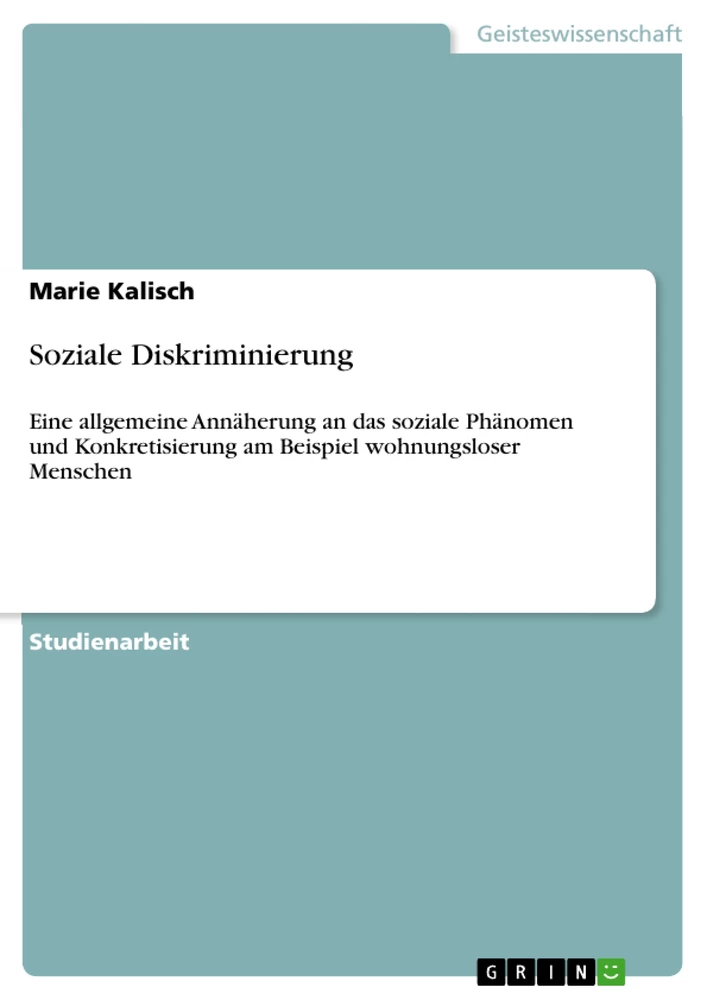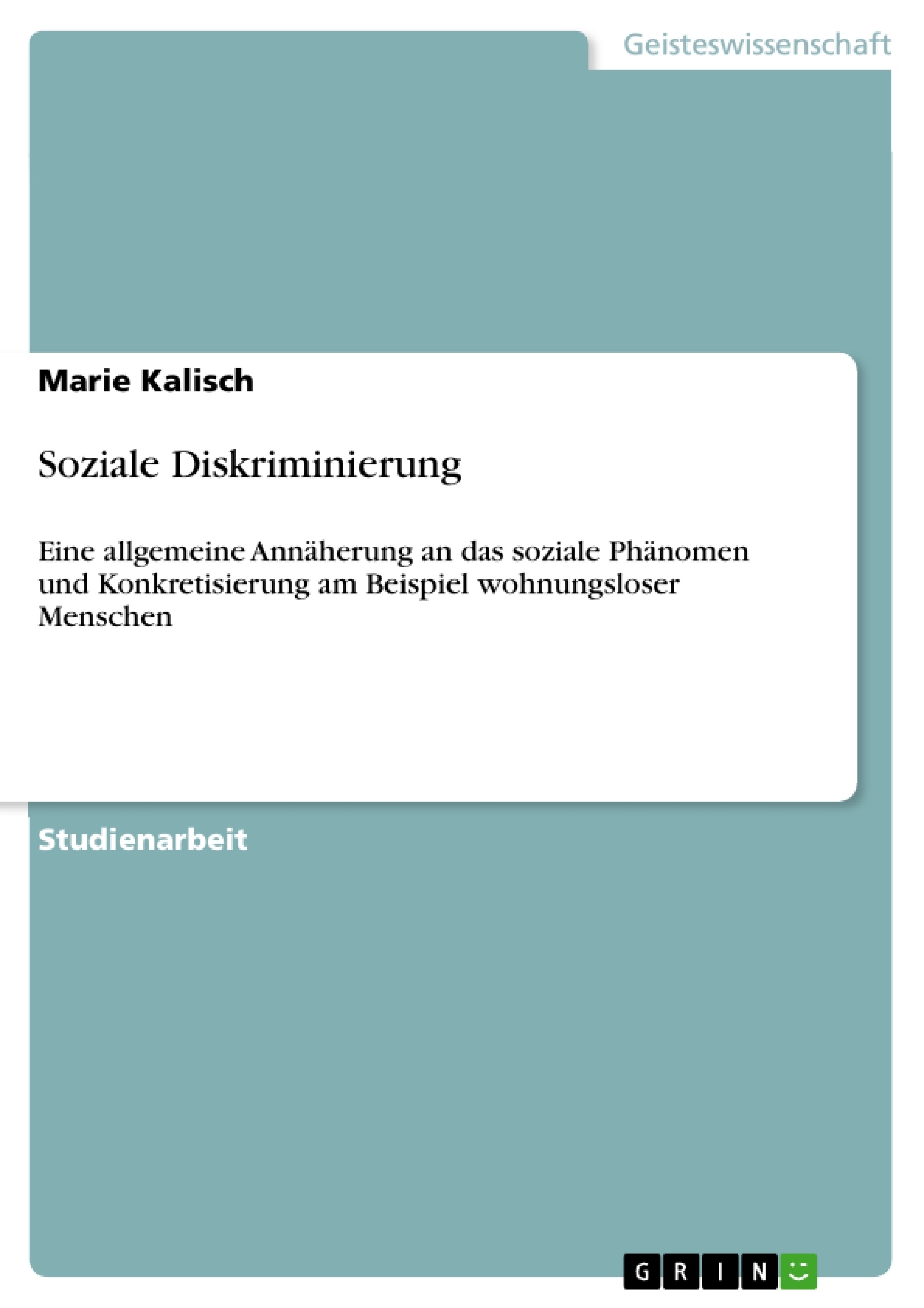Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen Diskriminierung als einer Form der Exklusion aus gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Zusammenhängen. Ziel der Arbeit ist es, dieses soziale Phänomen zu betrachten: Wer handelt und wie? Warum wird so gehandelt? Wie kann der Diskriminierung entgegengewirkt werden?
Die Seminararbeit ist in zwei Teile geteilt. Zunächst wird (Kapitel 2) Diskriminierung definiert und allgemein charakterisiert. Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird das vorher allgemein dargestellte Thema am Beispiel der Diskriminierung von wohnungslosen Menschen konkretisiert. Die Kapitel sind jeweils mit Einleitungen versehen, so dass den Leser ein roter Faden durch die Arbeit führt.
Am Ende (Kapitel 4) fasst das Fazit Gelerntes zusammen.
Inhaltsverzeichnis
1 Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
2 Allgemeiner Teil
2.1 Was ist Diskriminierung - Wortbedeutung und Definition
2.2 Was ist Diskriminierung - Definition
2.3 Wer wird diskriminiert?
2.4 Wer diskriminiert?
2.5 Wie wird diskriminiert?
2.6 Erklärungen und Ursachen
2.7 Wirkung von Diskriminierung
2.8 Gegenmaßnahmen und Lösungen - Was kann man dagegen tun?
3 Diskriminierung am Beispiel wohnungsloser Menschen
3.1 Zahlen und Fakten zur Wohnungslosigkeit
3.2 Wer diskriminiert Wohnungslose und wie?
3.3 Warum wird diskriminiert?
3.4 Wie kann der Diskriminierung entgegengewirkt werden?
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Ebenen und Intensität diskriminierender Verhaltensweisen
1 Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen Diskriminierung als einer Form der Exklusion aus gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Zusammenhängen. Ziel der Arbeit ist es, dieses soziale Phänomen zu betrachten: Wer handelt und wie? Warum wird so gehandelt? Wie kann der Diskriminierung entgegengewirkt werden?
Die Seminararbeit ist in zwei Teile geteilt. Zunächst wird (Kapitel 2) Diskriminierung definiert und allgemein charakterisiert. Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird das vorher allgemein dargestellte Thema am Beispiel der Diskriminierung von wohnungslosen Menschen konkretisiert. Die Kapitel sind jeweils mit Einleitungen versehen, so dass den Leser ein roter Faden durch die Arbeit führt.
Am Ende (Kapitel 4) fasst das Fazit Gelerntes zusammen.
2 Allgemeiner Teil
In diesem Kapitel wird zunächst erarbeitet, was im Allgemeinen unter Diskriminierung verstanden wird. Es erfolgt eine Abgrenzung und Einordnung zum Begriff der Exklusion, der ähnliche soziale Phänomene beschreibt. Anschließend werden die Komponenten der Interaktion betrachtet: Wer wird diskriminiert und wer diskriminiert? sowie Formen und Möglichkeiten der Diskriminierung beschrieben. Danach wird versucht zu erklären, welche Funktionen Diskriminierung erfüllt bzw. welche Ursachen ihr zugrunde liegen und wie sich Diskriminierung auswirkt. Am Ende des Kapitels werden Möglichkeiten besprochen, wie der Diskriminierung entgegengewirkt werden kann.
2.1 Was ist Diskriminierung - Wortbedeutung und Definition
Das lateinische Wort „discriminare“ bedeutet übersetzt „trennen“, „absondern“, „auslesen“, „unterscheiden“ (Online 1). Der Wortstamm „criminare“ bedeutet „jemanden Beschuldigen“, „verdächtigen“, „verleumden“, „etwas vorwerfen“ oder „sich über etwas beschweren“. Es lässt sich eine Verwandtschaft mit dem englischen „crime“ assoziieren.
Diskriminierung bezeichnet eine eher aktive Ausgrenzung, die sich auch mit Worten oder unter Anwendung von Gewalt äußern kann. Der Begriff ist aber nicht auf aktive und beabsichtigte Eigenschaften begrenzt – durch Definition verschiedener Formen der Diskriminierung in der Literatur, wie z.B. strukturelle oder institutionelle Diskriminierung sind auch passive Verhaltensweisen möglich, die einer Abgrenzung vom Begriff Exlusion entgegen stehen.
Exklusion kommt von „excludere“, zu deutsch: „ausschließen“, „aussperren“ oder „abweisen“ und ist in der lateinischen Bedeutung dem „discriminare“ sehr ähnlich (Online 1). Das Wort „Exklusion“ kommt in der Sozialen Arbeit in Mode, es wurde vor allem im Bereich der Hilfe für Menschen mit Behinderungen in der Diskussion um Inklusion und Teilhabe (vgl. Wansing 2005) intensiv gebraucht. Im Vergleich zur Diskriminierung bezeichnet es eher eine Form der passiven d.h. strukturell – institutionellen Ausgrenzung. Vielfach wird der Begriff neuerdings als Gegenbegriff zur Inklusion für alle Formen der sozialen Ausgrenzung und Desintegration verwendet (vgl. Online 6). Insofern ist Exklusion eher ein Überbegriff und Diskriminierung eine spezielle Form der Exklusion.
2.2 Was ist Diskriminierung - Definition
Die gängigen Definitionen von Diskriminierung beschreiben eine Herabsetzung bzw. Entwertung von Personen durch ungleiche Behandlung. Weisser (2010, S. 307) spricht von einem sozialen Tatbestand bzw. symbolischen oder materiellen Vorgang der Benachteiligung.
Lemke spricht (2010, S. 329) allgemein von Prozessen der sozialen Ausgrenzung und Benachteiligung. Die Autoren Hormel & Scherr (2010, S. 7) definieren Diskriminierung als „(…)Äußerungen und Handlungen, die sich in herabsetzender oder benachteiligender Absicht gegen Angehörige bestimmter sozialer Gruppen richten.“
Beabsichtigte Wirkung der Diskriminierung ist demnach die Benachteiligung der diskriminierten Menschen (vgl. Online 2) und damit auf der anderen Seite der Einflusszuwachs der Diskriminierenden. Diese „Absicht“ wird nicht allen Formen der Diskriminierung (z.B. bewusste und unbewusste; direkte und indirekte, unmittelbare und mittelbare Diskriminierung vgl. Online 3) unterstellt. Faktisch liegt aber jeder Diskriminierung eine unzulässige, d.h. nicht sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung zu Grunde (vgl. Online 2). Dabei wird die Ethik der Gleichbehandlung verletzt (Six & Petersen 2008, S. 161)
Das bedeutet nach Häfelin & Haller (2001, 215, zit. In: Weisser 2010, S. 312), dass Menschen nach dem allgemeinen Gleichheitssatz dann gleich behandelt werden müssen, wenn kein Grund vorliegt, sie ungleich zu behandeln. Liegt ein Grund vor, ist die Ungleichbehandlung sachlich begründet (z.B. Alter beim Genuss von Alkohol). Fehlt die Differenzkategorie (z.B. niedrigerer Lohn für Frauen), liegt eine Benachteiligung resp. Diskriminierung vor.
Lemke (2010, S. 329) stellt der Diskriminierung den Begriff der „Fairness“ entgegen, Diskriminierung wäre damit alles Verhalten und Agieren, das „unfair“ ist.
Diskriminierung ist eine Interaktion zwischen einem Opfer und einem Täter. Nicht immer sind die Wahrnehmungen dieser beiden Akteure gleich. Lemke (2010, S. 329) bemerkt: „Was im Einzelfall als diskriminierend empfunden wird, unterliegt selbst gesellschaftlichen Werturteilen und normativen Konflikten.“ In der Sozialpsychologie ist soziale Diskriminierung an die Erfüllung zweier Kriterien gebunden, nämlich: Die betroffene Person muss die negative Behandlung als illegitim wahrnehmen und die Behandlung muss aufgrund der Gruppenzugehörigkeit der Person erfolgen (Major, Quinton & McCoy 2002 zit. n. Hansen & Sassenberg 2008, S. 259). In welcher Weise diskriminierende Handlungen ausgeführt werden können, kann in Kap. 2.5. nachgelesen werden.
2.3 Wer wird diskriminiert?
Sowohl Einzelpersonen als auch Personengruppen können diskriminiert werden. Bei Einzelpersonen spricht man in diesem Zusammenhang von „individueller Diskriminierung“ (vgl. Online 3, Online 4). Von „Mobbing“ (vgl. Online 5) ist meist die Rede, wenn die diskriminierende Handlung in einem bestimmten Sozialraum, wie Schule oder am Arbeitsplatz stattfindet.
Die meisten Formen der Diskriminierung betreffen im allgemeinen Gruppen. Bei der Diskriminierung von Personengruppen wird mitunter auch von „sozialer Diskriminierung“ (vgl. Online 2) gesprochen. Bei dieser Form von Diskriminierung legt eine Mehrheit bzw. eine bestimmende Personengruppe Maßstäbe fest, die als Normen einen Geltungsanspruch erheben (vgl. Ebenda). Von Diskriminierung betroffen sind dann Gruppen, die diesen definierten Normen nicht entsprechen. Sie weisen gruppenspezifische Merkmale auf (Online 2), die sie von anderen Gruppen abgrenzen und eignen sich damit hervorragend für eine Stigmatisierung. Bei den Opfern von Diskriminierung handelt es sich häufig um zahlenmäßige Minderheiten (Online 2).
Die Liste der möglichen Merkmale, aufgrund derer Diskriminierung in unserer Gesellschaft bisher wahrgenommen wurde, ist lang. Bielefeldt (2010, S. 26ff) stellt in seinem Beitrag heraus, dass sich das in den Gesetzen gegen Diskriminierung widerspiegelt. Die EU- Grundrechtcharta aus dem Jahr 2000 nennt weit mehr nicht gewünschte Diskriminierungsmerkmale als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948. Das ist ein Hinweis darauf, dass gesellschaftliche Lern- und Sensibilisierungsprozesse stattfinden und sich Normen immer wieder verändern.
Weisser (2010, S. 308) folgert, dass Diskriminierung voraussetzungslos ist: „Diskriminierung ist eine Erfahrung ganz unterschiedlicher Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen.“ Seine These ist, dass Unterscheidungsmerkmale bzw. Differenzkategorien auf die Unterschiedlichkeit von Menschen verweisen. Ihre Heranziehung für Diskriminierung geschieht zweckgebunden. Das bedeutet, dass jede Eigenschaft, die Menschen unterscheidet, grundsätzlich genutzt werden kann, um Menschen herabzusetzen. Die Liste der möglichen Merkmale ist demnach nicht nur lang sondern unendlich.
2.4 Wer diskriminiert?
In Kap. 2.3. wurde davon ausgegangen, dass eine Mehrheit bzw. eine bestimmende Personengruppe Maßstäbe definiert. In der Folge werden alle Menschen, die diese Maßstäbe nicht erfüllen, ausgeschlossen. In diesem Fall wird also davon ausgegangen, dass Opfer und Täter verschiedene Personen sind. Täter können sowohl Einzelpersonen oder Gruppen aber auch Institutionen und Organisationen sein.
Eine interessante weitere Form der Diskriminierung ist die Selbstdiskriminierung. Bekannt ist sie beispielsweise als „Outing“ bei Homosexuellen. Aber auch in anderen Bereichen wird von Selbstdiskriminierung oder selbstausschließendem Verhalten berichtet, z.B. von Migranten oder Senioren (Online 7, 8). Dieses Verhalten kann bewusst eingesetzt werden, beispielsweise, um sich von anderen Menschen abzuheben. Es kann aber auch unbewusst z.B. aufgrund von fehlender Selbstwertüberzeugung, von den Tätern übernommen werden.
2.5 Wie wird diskriminiert?
Die Literatur kennt viele verschiedene Formen der sozialen Diskriminierung. Einige Formen-Bezeichnungen weisen darauf hin, wie diese Diskriminierungen stattfinden. Es gibt beispielsweise die „Indirekte“, „Multiple“, „Strukturelle“, „Organisationale“, „Institutionelle“ „Interaktionelle“, „Symbolische“ (vgl. Hormel & Scherr, S. 95ff, S. 214, 329, S. 332, S. 335) oder auch die „Sprachliche“ (vgl. Online 3), „(Un-)Bewusste“, „(In-)Direkte“, „Offene“, „Verdeckte“, „Alltägliche“ oder (Un-)mittelbare Diskriminierung (vgl. Online 2).
So lang also die Liste der Merkmale aufgrund derer diskriminiert werden kann, so vielfältig sind auch die Praktiken der Diskriminierung.
Sie reichen von verbalen Äußerungen, wie Witzen, Beschimpfungen, Beleidigungen oder Verharmlosung und distanziertem Verhalten (vgl. Online 4, Rauchfleisch 2001, S. 140) über Vorurteile, Hass- und Ekelgefühle (Hormel & Scherr 2010, S. 8) bis hin zur Anwendung manifester körperlicher Gewalt, Hass, zur Boykottierung von Geschäften, Ausgangssperren, Beschneidung von Rechten, ungleichen Bezahlung für gleiche Arbeit (Online 4) oder Ausschluss von Berufen (Rauchfleisch 2001, S. 141). In Abb. 1 wurde der Versuch unternommen, diese Praktiken nach Intensität und Ebenen einzuordnen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Ebenen und Intensität diskriminierender Verhaltensweisen
Nicht immer wird indessen Diskriminierung als etwas Negatives wahrgenommen. Die deutsche Mentalität wertet und akzeptiert viele Formen der Diskriminierung als legitime Formen der Ungleichbehandlung (Hormel & Scherr 2010, S. 8). Beispielsweise könnte die ärztliche Bevorzugung und Besserstellung privat zahlender Patienten, schulische Elitebildung privat zahlender Eltern oder andere gemeinhin akzeptierte Statussymbole daraufhin untersucht werden, ob sie nicht de facto diskriminierend und exkludierend wirken. In diesen Zusammenhang passen die im nächsten Kapitel folgenden Erklärungsversuche zu den Ursachen von Diskriminierung.
2.6 Erklärungen und Ursachen
Die Forschung macht für die Entstehung von Diskriminierungen verschiedene Ursachen verantwortlich. Eine Erklärung ist das Vorurteil (Online 9) bzw. die Zuschreibung von Stereotypen (vgl. Lemke 2010, S. 338). Vorurteile unterstellen Menschen bestimmte Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen, in dem sie Gruppen zugeordnet werden. Vorurteile können unbewusst bei der Reduzierung von Komplexität entstehen oder absichtlich geschaffen werden.
Eine weitere Ursache, die teils auch die Entstehung von Vorurteilen erklären will, ist die Fremdheit (Boatca 2010, S. 115) bzw. Angst (vgl. Rauchfleisch 2001, S. 165f). So wird beispielsweise Homophobie damit erklärt, dass sowohl eigene homosexuelle Anteile Angst erregen als auch fremde Homosexualität als Gefahr wahrgenommen wird, weil sie gültige Normen in Frage stellt. Beispielsweise wird die Beziehung zwischen Mann und Frau, die traditionelle Familie und das Männlichkeitsideal angegriffen. Durch sozialkonformes Verhalten und Diskriminierung von Homosexuellen (Sündenbockfunktion) kann sich der homophobe Mensch orientieren und einen Machtvorsprung gewinnen. Ähnliche Muster sind möglicherweise auch ursächlich für die Diskriminierung von Ausländern und Wohnungslosen. In diesen Fällen sind geltende Normen in Bezug auf Kultur und Arbeitsleistung bedroht.
Macht bzw. Gewalt werden in der Literatur kaum in den Zusammenhang mit Diskriminierung gestellt. Ein Beispiel für diesen Zusammenhang lieferten Elias & Scotson mit der von ihnen als „Figurationssoziologie" veröffentlichten Untersuchung aus dem Jahre 1960. Darin fanden sie heraus, dass Diskriminierungen einem bestimmten Muster folgen. Dieses soziodynamische Muster nannten sie „Etablierten-Außenseiter-Beziehung“ (Elias & Scotson 1990, S. 13). Das Muster besteht darin, dass die Etablierten – in der Studie durch ihre längere Wohndauer am Platz - ein höheres Kohäsionspotential hatten als neu Zugewanderte (Ebenda, S. 11). Durch Stigmatisierung und Ausgrenzung der neuen Siedler gelang es ihnen, ihre eigene Macht auszubauen und die kollektive Identifizierung mit hohen Werten in der eigenen Gruppe zu stärken. Es wird deutlich, dass Diskriminierung durchaus eingesetzt wird, um Machtverhältnisse zu beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Diskriminierung?
Die Arbeit untersucht soziale Diskriminierung als eine Form der Exklusion aus gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ziel ist es, zu beleuchten, wer diskriminiert, wie diskriminiert wird, warum dies geschieht und wie Diskriminierung entgegengewirkt werden kann.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Zuerst wird Diskriminierung allgemein definiert und charakterisiert. Im zweiten Teil wird das Thema am Beispiel der Diskriminierung von wohnungslosen Menschen konkretisiert. Ein Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Was versteht man unter Diskriminierung?
Diskriminierung wird als eine Herabsetzung von Personen durch ungleiche Behandlung definiert. Sie kann sich aktiv durch Worte oder Gewalt äußern, aber auch passiv durch strukturelle oder institutionelle Benachteiligungen.
Wer kann diskriminiert werden?
Sowohl Einzelpersonen (individuelle Diskriminierung, Mobbing) als auch Personengruppen (soziale Diskriminierung) können diskriminiert werden. Betroffen sind oft Minderheiten, die von vorherrschenden Normen abweichen.
Wer diskriminiert?
Täter können Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen oder Organisationen sein. Es gibt auch die Form der Selbstdiskriminierung.
Welche Formen der Diskriminierung gibt es?
Es gibt viele verschiedene Formen, wie indirekte, multiple, strukturelle, organisationale, institutionelle, interaktionelle, symbolische, sprachliche, bewusste/unbewusste, offene/verdeckte und alltägliche Diskriminierung. Diese reichen von verbalen Äußerungen bis hin zu Gewalt und dem Beschneiden von Rechten.
Welche Ursachen hat Diskriminierung?
Die Ursachen sind vielfältig. Vorurteile, Stereotypen, Fremdheit, Angst und der Wunsch nach Macht können eine Rolle spielen. Auch die Theorie des Autoritarismus und verschiedene Paradigmen (Soziale Dominanz, minimale Gruppen, Bedürfnisse, reale Gruppenbedrohung) bieten Erklärungsansätze.
Was sind mögliche Gegenmaßnahmen gegen Diskriminierung?
Das Kapitel bespricht, wie der Diskriminierung entgegengewirkt werden kann, geht aber in der Sprachvorschau nicht auf die konkreten Maßnahmen ein.
- Citation du texte
- Marie Kalisch (Auteur), 2011, Soziale Diskriminierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190332