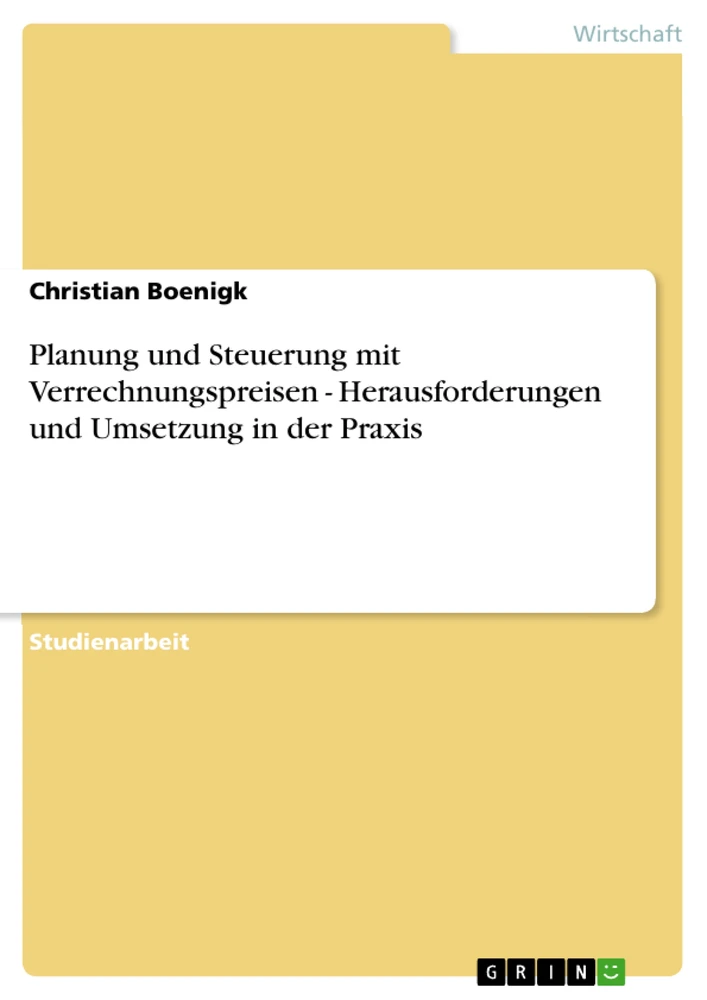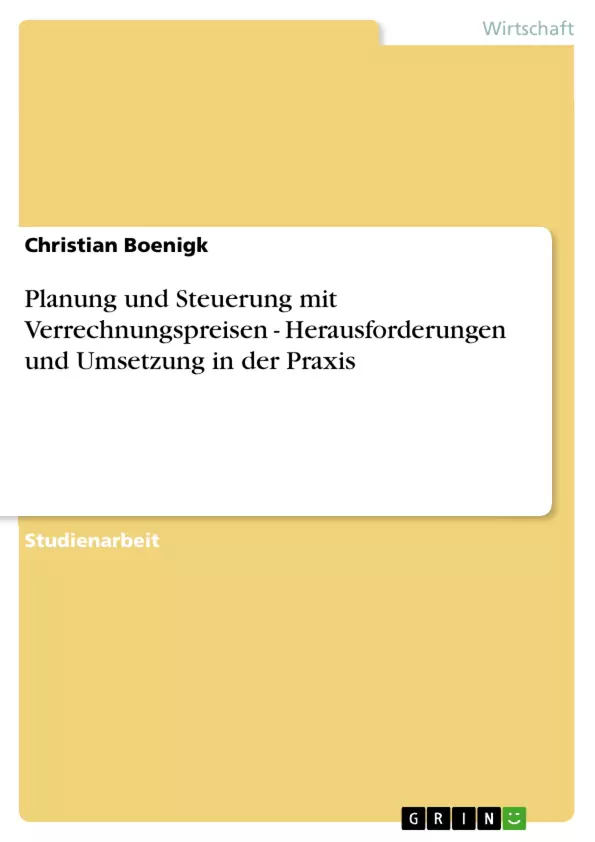Im Zuge der immer weiter heran schreitenden Globalisierung, vom Unternehmen zum Konzern, in einer Welt der Arbeitsteilung, in der Prozesse über den Gewinn oder Ver-lust entscheiden, sind Verrechnungspreise auch Transfer Prices genannt ein, wichtiger Erfolgsfaktor. Verrechnungspreise stehen im Fokus, wenn Unternehmen im Konzern-verbund agieren sowie im Einzelunternehmen. Die Aufteilung von Gewinnen und Ver-lusten in Abhängigkeit der verschiedenen länderspezifischen Regelungen und Besteue-rungen hinsichtlich der Steueroptimierung stellen eine Herausforderung dar. Desweite-ren sind Verrechnungspreise nicht nur aus steuerlichen Gesichtspunkten in Bezug auf die Einkunftsabgrenzung nach Ihrer Funktion wichtig. Zudem dienen auch diese in be-triebswirtschaftlicher Sicht als Planung- und Koordinationsinstrument. Dadurch, dass Verrechnungspreise die Anforderung haben externe und interne Funktionen zu erfüllen, kann es zu Zielkonflikten kommen. Konzerne und einzelne Unternehmen sind meistens in ergebnisverantwortliche Divisionen organisiert, damit eine dezentrale Planung und Steuerung durch die Bereichsmanager möglich wird. In diesem Sinne stellen Verrech-nungspreise ein Koordinationsinstrument dar, das versucht einen fiktiven Marktmecha-nismus im Unternehmen zu erzeugen . Dienstleistungen und Güter im Wertschöpfungs-prozess zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen bzw. Konzernunternehmen müssen bewertet werden, damit diese Leistung den einzelnen Leistungseinheiten zuge-rechnet werden kann. Durch die Bewertung von Leistungen ergibt sich der Erfolg einer Leistungseinheit. Daraus lässt sich ableiten, dass die Erfolgsermittlungsfunktion von signifikanter Bedeutung ist und zudem zu Konflikten innerhalb der Unternehmen führen kann. Außerdem ist zu bemerken, dass theoretische Ansätze eine hohe Diskrepanz zu den in der Praxis angewendeten Methoden zur Verrechnungspreisermittlung aufweisen. In der Praxis lässt sich beobachten, dass die Gesamtunternehmenssicht tendenziell verloren geht und Profit Center –Denken bzw. Bereichsdenken in den Vordergrund rückt. Der Ursprung dieser Problematik sind Zielvereinbarungen, die oft an quantitativen Ergebnissen gekoppelt werden. Diese lassen den Gesamtwertschöpfungsprozess außer Acht. Aus dieser Problematik lässt sich erkennen, dass die Steuerung und Planung mit Hilfe von Verrechnungspreisen und die Anwendung in der Praxis für Unternehmen eine besondere Herausforderung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Seminararbeit
- Definition: Verrechnungspreis
- Grundlagen und Funktionen von Verrechnungspreisen
- Koordination
- Erfolgsermittlung
- Zielkonflikte
- Sonstige Funktionen
- Steuerrechtliche Rahmenbedingungen
- Heraus- und Anforderungen bei der Bildung von Verrechnungspreisen
- Marktpreisorientierte Verrechnungspreise
- Kostenorientierte Verrechnungspreise
- Zweistufiger Verrechnungspreis
- Verhandelbare Verrechnungspreise
- Ermittlungsmethoden von Konzernverrechnungspreisen
- Transaktionsbasierte Methoden
- Gewinnbasierte Methoden
- Verrechnungspreise in der Praxis
- Rahmenbedingungen
- Einsatz in der Praxis
- Dokumentation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der Planung und Steuerung von Verrechnungspreisen in der Praxis und analysiert die Herausforderungen, die sich dabei stellen. Sie untersucht die verschiedenen Funktionen von Verrechnungspreisen, sowohl im Hinblick auf die interne Koordination und Erfolgsermittlung als auch im Hinblick auf die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Methoden zur Ermittlung von Verrechnungspreisen im Konzernverbund beleuchtet.
- Die vielseitigen Funktionen von Verrechnungspreisen
- Die Herausforderungen der Verrechnungspreisermittlung in der Praxis
- Die verschiedenen Methoden zur Berechnung von Verrechnungspreisen
- Die Bedeutung der Verrechnungspreise für die Steuerung und Planung von Unternehmen
- Die Berücksichtigung von steuerrechtlichen Aspekten bei der Gestaltung von Verrechnungspreisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verrechnungspreise ein und erläutert den Aufbau der Seminararbeit. Sie definiert den Begriff "Verrechnungspreis" und beleuchtet die verschiedenen Synonyme, die in der Literatur verwendet werden. Im Anschluss werden die wichtigsten Funktionen von Verrechnungspreisen vorgestellt, die sowohl die Koordination als auch die Erfolgsermittlung innerhalb von Unternehmen betreffen. Darüber hinaus werden die Zielkonflikte, die durch die Nutzung von Verrechnungspreisen entstehen können, sowie die sonstigen Funktionen dieser Instrumente diskutiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für Verrechnungspreise. Es werden die verschiedenen Ansätze zur Bildung von Verrechnungspreisen, wie beispielsweise die marktpreisorientierte, die kostenorientierte und die zweistufige Methode, erläutert. Das Kapitel schließt mit der Vorstellung von verhandelbaren Verrechnungspreisen ab.
Im dritten Kapitel werden die Ermittlungsmethoden von Konzernverrechnungspreisen analysiert. Es werden sowohl transaktionsbasierte als auch gewinnbasierte Methoden vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Anwendung von Verrechnungspreisen in der Praxis. Es beleuchtet die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Verrechnungspreisen und stellt verschiedene Beispiele für die praktische Anwendung vor. Darüber hinaus werden die Anforderungen an die Dokumentation von Verrechnungspreisen im Rahmen von Unternehmenssteuerung und -kontrolle erörtert.
Schlüsselwörter
Verrechnungspreise, Transferpreise, Konzernverrechnungspreise, interne Preisbildung, Koordination, Erfolgsermittlung, Zielkonflikte, Steuerrecht, Marktpreisorientierung, Kostenorientierung, Transaktionsbasierte Methoden, Gewinnbasierte Methoden, Praxisanwendungen, Unternehmenssteuerung, Dokumentation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Verrechnungspreise (Transfer Prices)?
Verrechnungspreise sind Preise, die für Güter oder Dienstleistungen zwischen verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens oder zwischen verbundenen Unternehmen eines Konzerns berechnet werden.
Welche Funktionen erfüllen Verrechnungspreise?
Sie dienen der internen Koordination (Lenkungsfunktion), der Erfolgsermittlung einzelner Profit Center und der steuerlichen Gewinnabgrenzung zwischen verschiedenen Ländern.
Welche steuerrechtlichen Herausforderungen gibt es?
Finanzbehörden fordern, dass Verrechnungspreise dem „Fremdvergleichsgrundsatz“ (Arm's Length Principle) entsprechen, um künstliche Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerländer zu verhindern.
Was ist der Unterschied zwischen marktpreis- und kostenorientierten Preisen?
Marktpreisorientierte Preise basieren auf externen Marktpreisen. Kostenorientierte Preise basieren auf den tatsächlichen Herstellungskosten, oft zuzüglich eines Gewinnaufschlags.
Warum entstehen Zielkonflikte bei Verrechnungspreisen?
Ein Preis, der steuerlich optimal ist, kann intern zu falschen Anreizen für Manager führen (z. B. Bereichsdenken statt Gesamtunternehmenssicht).
Was sind gewinnbasierte Ermittlungsmethoden?
Hierbei wird der angemessene Verrechnungspreis anhand der erzielten Nettomargen oder der Gewinnaufteilung (Profit Split) zwischen den beteiligten Einheiten bestimmt.
- Quote paper
- Christian Boenigk (Author), 2011, Planung und Steuerung mit Verrechnungspreisen - Herausforderungen und Umsetzung in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190393