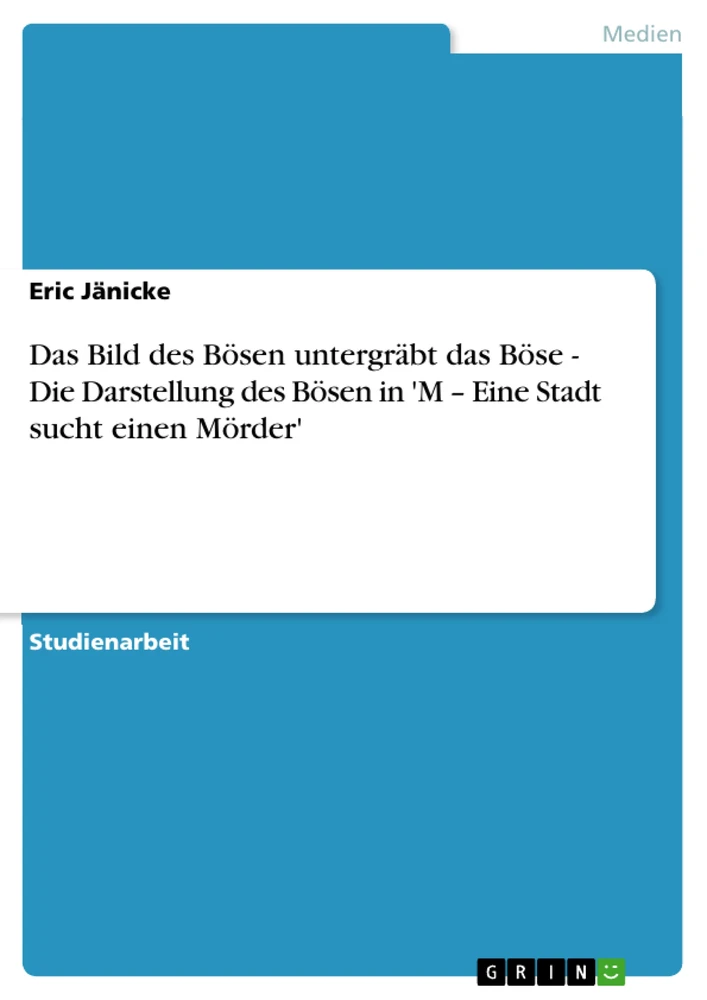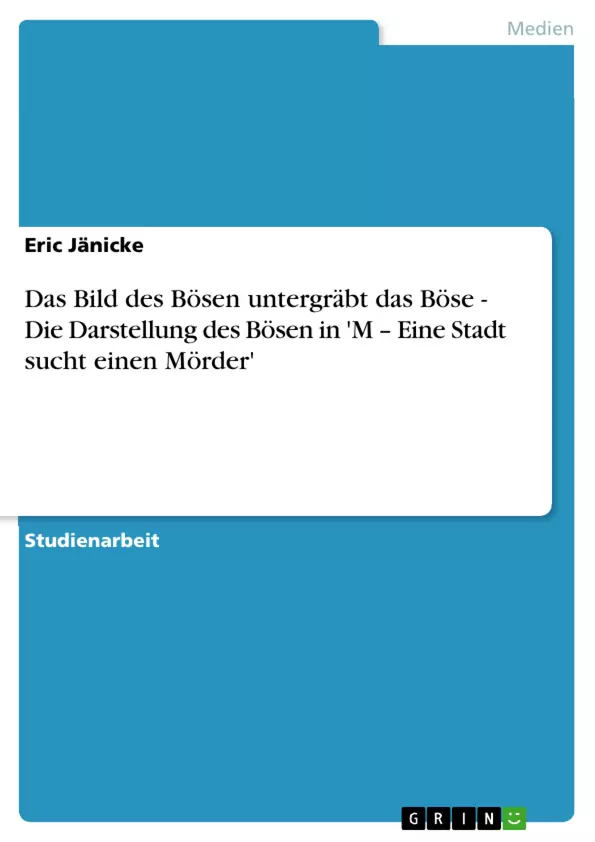Gut und Böse, Ordnung und Chaos, Gesetz und Verbrechen, Vernunft und Gewalt – Das ist der Rahmen des Kriminalfilms und die Überschreitung gesellschaftlicher Normen seine Ausgangslage. Während des Handlungsverlaufs wird also ein Verbrechen aufgeklärt. Die Faszination für diese Thematik kann man mit dem heimlichen Bedürfnis des Zuschauers nach einem Ausbruch aus der Ordnung zu erklären suchen, dem Begehren nach Unerlaubtem, der Gefahr und der damit erzeugten Erregung. Der Zuschauer kann nach mimetischem Prinzip Fantasien ausleben und mit Handlungsträgern mitfühlen, um am Ende festzustellen, dass sich eine Grenzüberschreitung nicht lohnt. Doch ist es wirklich so einfach?
Für Regisseur Fritz Lang bot das „[…] Kriminalfilmgenre die Möglichkeit der Kritik an bestimmten Aspekten des Lebens, die es wirklich gibt. Ihn interessierte der Mensch und insbesondere die Frage ‚what makes him tick‘“ . Mit M – Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931 erschienen, hat er ein Werk geschaffen, das gern, immer in Begleitung von Superlativen, zu den Meilensteinen der Filmgeschichte gerechnet wird.
Die Darstellung des Täters und das Bild von ihm, welches sich in der konstruierten Öffentlichkeit manifestiert, stehen im Interesse dieser Arbeit. Die zentrale Frage lautet also:
Wie gestaltet sich das Böse in M?
Der erste und ausführlichste Teil widmet sich dem Mörder selbst, seinem Charakter und wie sich dieser im Film entfaltet und motivisch untermalt wird.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Bild vom Bösen, den Vorstellungen vom Mörder, welche sich in der Filmbevölkerung entwickeln. Dass hier beides bewusst voneinander getrennt betrachtet wird, ist der Intention zu schulden, das Böse und das Bild des Bösen nicht im wirkungsorientierten Wechselspiel der dramaturgischen Vorgabe, sondern für sich stehend zu fokussieren. Allerdings nicht, ohne zu schildern, auf welche Weise sie sich bedingen und auf den Zuschauer wirken.
Abschließend wird versucht den Film in das Genre einzuordnen und gewisse Bezüge anzureißen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Böse - Die Darstellung des Täters
- Wie und wodurch charakterisiert sich der Mörder Hans Beckert?
- Welche Motive unterstreichen die Charakterdarstellung?
- Das Bild des Bösen - Der Schatten des Täters
- Die Stadtbevölkerung
- Die Polizei
- Die Kriminellen
- Genrespezifik und Einflüsse
- Schlussbemerkung
- Filmquelle
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Darstellung des Bösen im Film „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ von Fritz Lang und untersucht, wie sich das Bild des Täters in der konstruierten Öffentlichkeit manifestiert. Im Fokus steht dabei die Frage, wie das Böse im Film gestaltet wird.
- Charakterisierung des Mörders Hans Beckert
- Motive und Hintergründe des Täters
- Entwicklung des Bildes vom Bösen in der Stadtbevölkerung
- Die Rolle der Polizei und der Kriminellen
- Genrespezifik und Einflüsse des Kriminalfilms
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Kriminalfilms und die Faszination des Zuschauers für das Thema des Bösen ein. Sie stellt die Frage, ob die Überschreitung gesellschaftlicher Normen tatsächlich immer negative Konsequenzen hat. Anschließend wird Fritz Lang als Regisseur und sein Film „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ vorgestellt. Das Hauptinteresse der Arbeit liegt in der Analyse der Darstellung des Täters und des Bildes, das sich von ihm in der Öffentlichkeit entwickelt.
Das zweite Kapitel widmet sich der Charakterisierung des Mörders Hans Beckert und seinen Motiven. Hier wird untersucht, wie sich Beckert im Film entwickelt und welche Faktoren seine Handlungsweise beeinflussen.
Im dritten Kapitel werden die Vorstellungen von dem Mörder, die sich in der Filmbevölkerung entwickeln, analysiert. Dabei wird das Verhältnis zwischen dem Bösen und dem Bild des Bösen betrachtet, und es wird untersucht, wie diese beiden Aspekte sich gegenseitig beeinflussen.
Das vierte Kapitel ordnet den Film in das Genre des Kriminalfilms ein und betrachtet wichtige Einflüsse und Genrekonventionen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie dem Bösen und dessen Darstellung im Film, der Charakterisierung von Täterfiguren, dem Bild des Bösen in der Öffentlichkeit, der Konstruktion von Angst und Unsicherheit, der Genrespezifik des Kriminalfilms und dem Einfluss von realen Kriminalfällen auf die Filmwelt.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Mörder Hans Beckert im Film „M“ charakterisiert?
Beckert wird nicht als klassisches Monster, sondern als getriebener, psychisch kranker Mensch dargestellt, was durch spezifische Motive untermalt wird.
Was ist die zentrale Frage der Arbeit?
Die zentrale Frage lautet: Wie gestaltet sich das Böse in Fritz Langs Werk „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“?
Welches Bild vom Bösen entwickelt die Stadtbevölkerung im Film?
Die Bevölkerung reagiert mit Hysterie und Misstrauen, wobei sich ein verzerrtes Bild des Täters manifestiert, das zur Vorverurteilung Unschuldiger führt.
Warum arbeiten Polizei und Kriminelle im Film parallel?
Beide Gruppen suchen den Mörder aus unterschiedlichen Motiven: Die Polizei zur Wiederherstellung der Ordnung, die Kriminellen, weil der Fahndungsdruck ihr eigenes Geschäft stört.
Welche filmhistorische Bedeutung hat „M“?
Der Film von 1931 gilt als Meilenstein der Filmgeschichte und als früher Vorläufer des Film Noir und des modernen Psychothrillers.
- Quote paper
- Eric Jänicke (Author), 2010, Das Bild des Bösen untergräbt das Böse - Die Darstellung des Bösen in 'M – Eine Stadt sucht einen Mörder', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190415