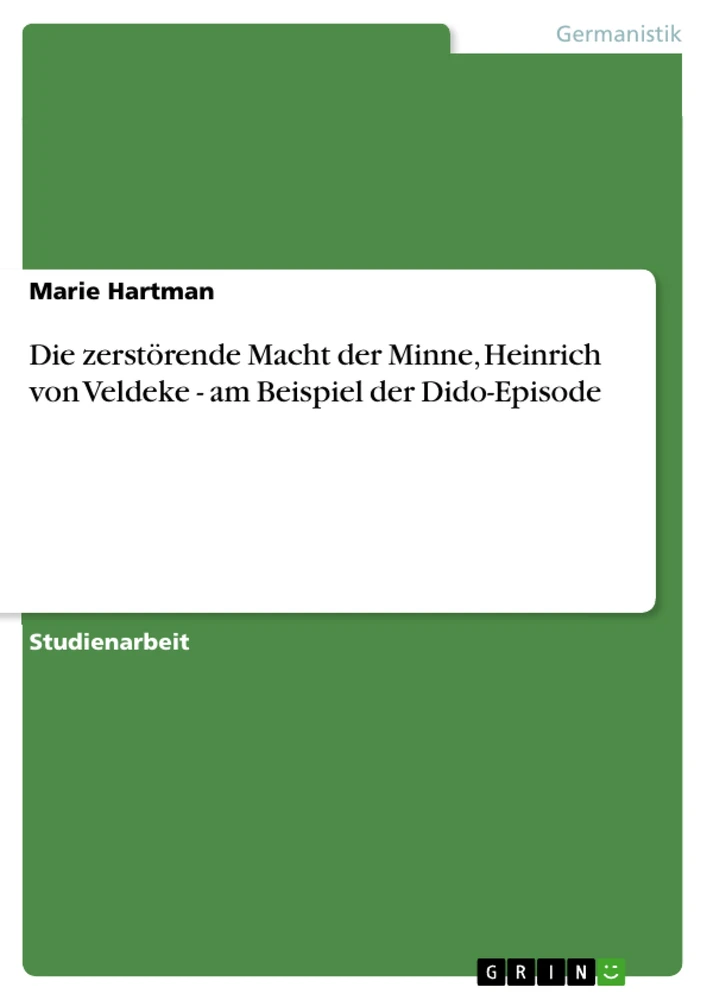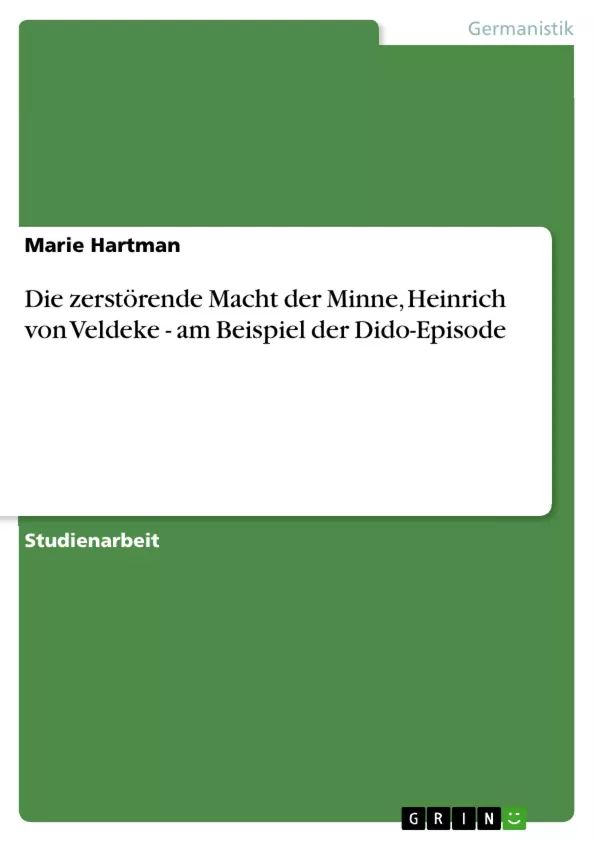Heinrich von Veldeke, einer der herausragenden volkssprachigen Dichter der mittelhochdeutschen Literaturzeit, wird in der Forschung als «Begründer des neuen höfischen Romans» genannt. Diese Bezeichnung verdient er dank seinem „Eneasroman“ (um 1190 fertig gestellt), da er der erste Dichter ist, der das antike Epos dem höfischen Publikum in deutscher Sprache präsentiert.
Veldekes „Eneasroman“ ist keine wörtliche Übersetzung von Vergils „Aeneis“, sondern eine bearbeitete Wiedergabe des altfranzösischen „Roman d’Eneas“ (um 1160 entstanden), der seinerseits auf Vergil zurückweist. Obwohl die Fabel und die wesentlichen Etappen der römischen Eposhandlung in die mittelalterliche Romane übernommen worden sind, unterscheiden sie sich vom antiken Werk sowohl in stilistischer, als auch in inhaltlicher Sicht. Die Akzente werden verschoben und die Charaktere umgestaltet. Die Macht der Götter, die das Leben der Protagonisten in Vergils „Aeneis“ lenken, wird abgeschwächt, die Unterweltfahrt des Trojaners wird gekürzt und stark verändert, die Liebesgeschichte zwischen Lavinia und Eneas wird ins Werk eingeführt. Alle drei Autoren folgen dem Geist ihrer Zeit und wollen mit ihren Werken das Publikum sowohl erfreuen, als auch erziehen.
Im Unterschied zu der antiken Vorlage, wird in den mittelalterlichen Adaptionen mehr Akzent auf die Minnehandlungen gelegt. Die Macht der Minne wird am Beispiel der Dido- und Lavinia-Geschichte gezeigt, indem ihre Wirkung auf das Denken, Handeln und insgesamt auf das Leben der Personen explizit betont wird. Liebe ist in den Romanen der Dichter des 12. Jahrhunderts eine treibende Kraft, die das Dasein der Protagonisten bestimmt.
In der vorliegenden Arbeit soll am Beispiel der Darstellung der Dido-Episode bei Veldeke, die von dem antiken Original etwas abweicht, gezeigt werden, dass Minne eine zerstörende, den Verstand raubende Macht ist.
Zuerst soll die Darstellung der Karthagerin Dido als einer mächtigen und klugen Herrscherin vor dem Auftritt der Liebeskrankheit betrachtet werden. Dann werden die Entstehung der Minne und die durch sie verursachten körperlichen und seelischen Schmerzen zum Thema. Im nächsten Kapitel soll die Entscheidung der Königin, sich dem Trojaner hinzugeben und die Tat im Wald analysiert werden. Die Reaktion der Gesellschaft auf die Liebesbeziehung und deren Folgen sollen im Mittelpunkt des folgenden Abschnittes stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Dido als Herrscherin
- II. Macht der Minne
- III. Heilung um jeden Preis
- IV. Folgen: zerbrochene Ordnung
- V. Der Weg zum Selbstmord
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Veldekes Darstellung der Dido-Episode im „Eneasroman“ und untersucht, wie Minne in diesem Werk als eine zerstörerische Kraft dargestellt wird, die den Verstand raubt.
- Didos Macht und Position als Herrscherin
- Entstehung und Auswirkungen der Minne auf Dido
- Didos Entscheidung, sich Aeneas hinzugeben
- Gesellschaftliche Reaktion auf die Liebesbeziehung
- Notwendigkeit und Folgen von Didos Selbstmord
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt Heinrich von Veldeke als einen wichtigen Dichter der mittelhochdeutschen Literaturzeit vor und erläutert die Entstehung des „Eneasroman“ im Kontext der mittelalterlichen Literatur.
- I. Dido als Herrscherin: Dieses Kapitel betrachtet Didos Darstellung als eine mächtige und kluge Herrscherin, bevor die Minne in ihr Leben tritt.
- II. Macht der Minne: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung von Didos Liebe zu Aeneas und die damit verbundenen körperlichen und seelischen Schmerzen.
- III. Heilung um jeden Preis: Dieses Kapitel befasst sich mit Didos Entscheidung, sich Aeneas hinzugeben und die Folgen dieser Entscheidung für die Königin.
- IV. Folgen: zerbrochene Ordnung: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen der Gesellschaft auf die Liebesbeziehung zwischen Dido und Aeneas und die daraus resultierenden Folgen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Themen Minne, Macht, Herrschaft, Selbstmord, mittelalterliche Literatur, Heinrich von Veldeke, „Eneasroman“, Dido-Episode, antike Vorlage.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Heinrich von Veldeke und welche Bedeutung hat sein Werk?
Heinrich von Veldeke gilt als Begründer des neuen höfischen Romans in Deutschland. Mit seinem „Eneasroman“ (um 1190) adaptierte er antike Stoffe für das mittelalterliche Publikum.
Wie unterscheidet sich Veldekes Dido-Darstellung von der antiken Vorlage?
Während in Vergils „Aeneis“ die Götter das Geschehen lenken, rückt Veldeke die „Minne“ (Liebe) als psychologische, oft zerstörerische Triebkraft in den Vordergrund, die das Handeln der Figuren bestimmt.
Warum wird die Minne in der Dido-Episode als zerstörerische Macht bezeichnet?
Die Arbeit zeigt, dass die Minne Dido den Verstand raubt, sie zu körperlichen und seelischen Schmerzen führt und letztlich ihre soziale und politische Ordnung als Herrscherin zerstört.
Welche Phasen durchläuft Dido in Veldekes Roman?
Zuerst wird sie als mächtige, kluge Herrscherin eingeführt. Nach der Begegnung mit Eneas folgt der Ausbruch der Liebeskrankheit, die Hingabe im Wald und schließlich der soziale Abstieg, der im Selbstmord endet.
Welche Rolle spielt die Gesellschaft in der Liebesbeziehung zwischen Dido und Eneas?
Die Gesellschaft reagiert mit Unverständnis und Kritik, da die private Leidenschaft der Herrscherin ihre öffentliche Pflicht und die staatliche Ordnung gefährdet.
- Arbeit zitieren
- Marie Hartman (Autor:in), 2011, Die zerstörende Macht der Minne, Heinrich von Veldeke - am Beispiel der Dido-Episode, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190649