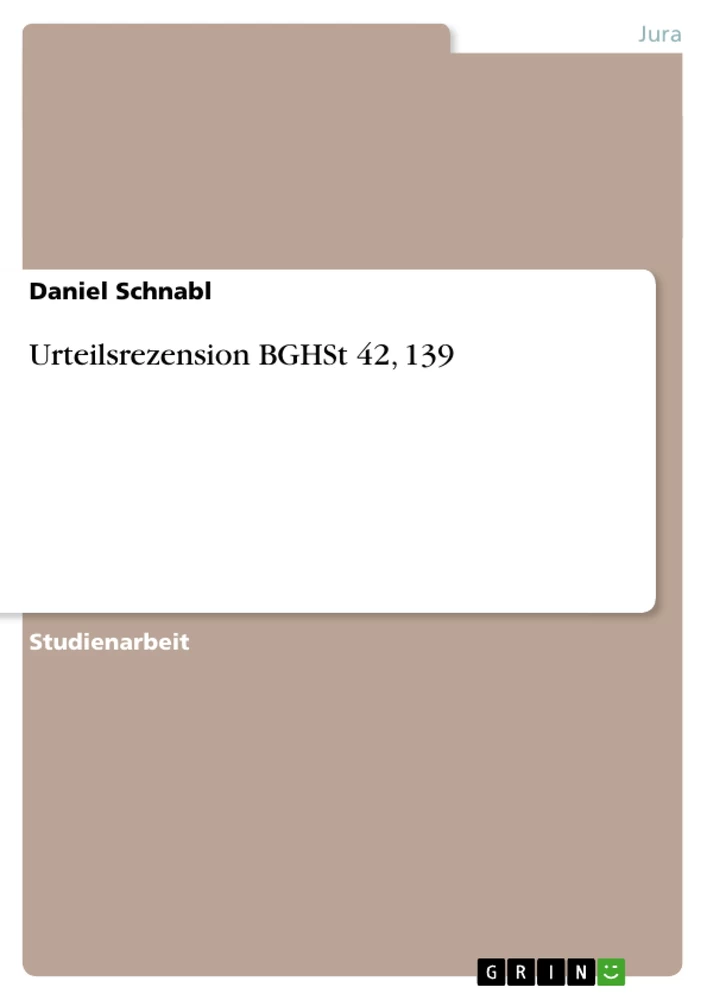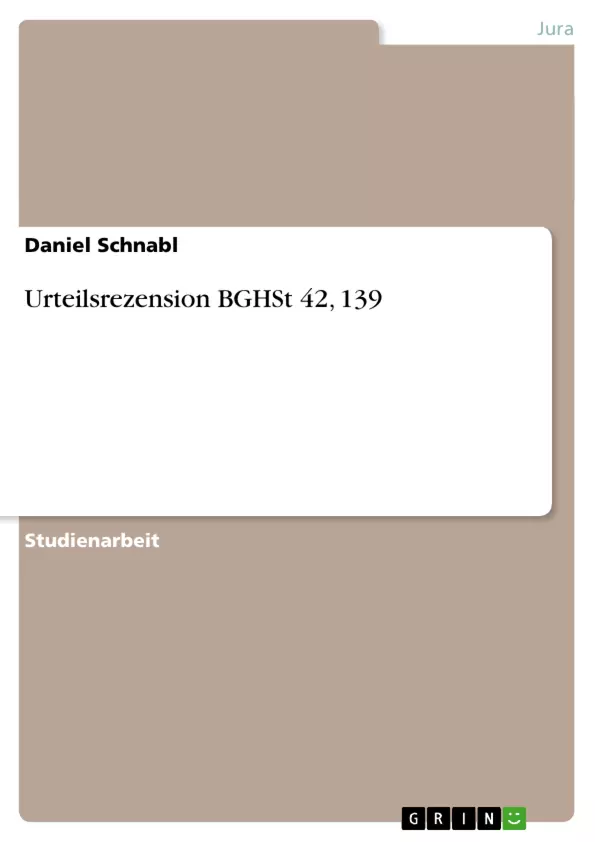Straftaten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität können ohne den
Einsatz „heimlicher“ Ermittlungsmaßnahmen nur noch selten zur Aburteilung
gebracht werden.1 Der Einsatz solcher Methoden wirft jedoch eine ganze
Reihe von strafprozessualen Fragen auf und wird unter diesem Blickwinkel
seit längerem kontrovers diskutiert.
Der große Senat für Strafsachen hatte sich in diesem Zusammenhang in
dem Beschluss vom 13.5.19962 mit einem Problem von besonders großer
praktischer Relevanz auseinanderzusetzen. Es ging um die Fragestellung,
ob ein Beweisverwertungsverbot für Äußerungen des Beschuldigten besteht,
wenn er nicht weiß, dass er auf Veranlassung der Strafverfolgungsbehörden
ausgefragt wurde. Neben den rein praktischen Konsequenzen ist
die Beantwortung dieser Frage zwangsläufig auch „kursbestimmend“3 für
die gesamte Strafprozessrechtsdogmatik. Zunächst sei der dem Urteil zugrunde gelegte Sachverhalt kurz dargestellt.
Im vorliegenden Fall bat die Polizei eine Privatperson, welche offensichtlich
mit dem Tatverdächtigen bekannt war, diesem in einem vertraulichen Telefonat
entsprechende Informationen über die Tat zu entlocken. Da das Gespräch
nicht auf deutsch geführt werden konnte, wurde mit Wissen des Zeugen
ein Dolmetscher bestellt, der das Gespräch mithörte. In dem Telefongespräch
gestand der Tatverdächtige ein, die Tat begangen zu haben. Der
Dolmetscher sagte dann in der Hauptverhandlung gegen den Angeklagten
aus, woraufhin dieser verurteilt wurde.
1 Schneider, NStZ 2001, 8, 9.
2 BGHSt 42, 139.
3 So treffend Fezer, NStZ 1996, 289, 289.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- I. Sachverhalt
- II. Die Entscheidung des Großen Senats
- III. Stellungnahme
- 1. Zur Anwendbarkeit des § 136 a StPO
- 2. Zur Anwendbarkeit des § 136 StPO
- 3. Berücksichtigung der prozessual garantierten Beschuldigtenrechte
- C. Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entscheidung des Großen Senats für Strafsachen im Beschluss vom 13. Mai 1996 zum Thema der verdeckten Befragung eines Beschuldigten. Der Fokus liegt auf der Frage, ob ein Beweisverwertungsverbot für Äußerungen des Beschuldigten besteht, wenn er nicht weiß, dass er auf Veranlassung der Strafverfolgungsbehörden ausgefragt wurde.
- Anwendbarkeit von § 136a StPO bei verdeckten Befragungen
- Anwendbarkeit von § 136 StPO bei verdeckten Befragungen
- Schutz der prozessualen Rechte des Beschuldigten
- Relevanz der Entscheidung für die Strafprozessrechtsdogmatik
- Abwägung zwischen effektiver Strafverfolgung und Wahrung von Grundrechten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die wachsende Bedeutung von „heimlichen“ Ermittlungsmaßnahmen im Strafprozess, insbesondere im Kontext der organisierten Kriminalität. Der Beschluss des Großen Senats vom 13. Mai 1996 wird als wegweisend für die Strafprozessrechtsdogmatik vorgestellt. Im Hauptteil wird zunächst der Sachverhalt des konkreten Falls dargestellt, der der Entscheidung des Großen Senats zugrunde lag. Anschließend wird die Entscheidung des Senats zusammengefasst, die ein Beweisverwertungsverbot bei verdeckten Befragungen des Beschuldigten unter bestimmten Voraussetzungen ablehnt. Die Stellungnahme analysiert die Anwendbarkeit von § 136a und § 136 StPO im Zusammenhang mit verdeckten Befragungen und beleuchtet die Berücksichtigung der prozessual garantierten Beschuldigtenrechte. Die Schlussgedanken fassen die zentralen Argumente der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Verdeckte Befragung, Beweisverwertungsverbot, Beschuldigtenrechte, § 136a StPO, § 136 StPO, Strafprozessrecht, Strafprozessrechtsdogmatik, organisierte Kriminalität, heimliche Ermittlungsmaßnahmen, effektive Strafverfolgung, Rechtsstaatlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Entscheidung BGHSt 42, 139?
Der Große Senat für Strafsachen befasste sich mit der Frage, ob ein Beweisverwertungsverbot für Äußerungen eines Beschuldigten besteht, wenn dieser verdeckt durch eine Privatperson ausgefragt wurde.
Dürfen verdeckt erlangte Geständnisse vor Gericht verwertet werden?
Die Entscheidung lehnt ein generelles Beweisverwertungsverbot ab, sofern keine verbotenen Vernehmungsmethoden nach § 136a StPO vorliegen und die prozessualen Rechte gewahrt bleiben.
Welche Rolle spielte die Privatperson im Sachverhalt?
Die Polizei bat eine Bekannte des Tatverdächtigen, ihm in einem vertraulichen Telefonat Informationen zu entlocken, wobei ein Dolmetscher das Gespräch mithörte.
Welche Bedeutung hat § 136a StPO in diesem Kontext?
Es wird geprüft, ob die Täuschung über die Identität des Fragestellers eine unzulässige Beeinträchtigung der Willensfreiheit des Beschuldigten darstellt.
Wie werden die Beschuldigtenrechte in der Rezension bewertet?
Die Arbeit analysiert kritisch die Abwägung zwischen effektiver Strafverfolgung (besonders bei organisierter Kriminalität) und dem Schutz der prozessual garantierten Rechte des Beschuldigten.
Warum ist dieses Urteil „kursbestimmend“ für die Strafprozessdogmatik?
Weil es grundlegende Weichen stellt für den Einsatz heimlicher Ermittlungsmethoden und die Grenzen der Selbstbelastungsfreiheit (Nemo-tenetur-Prinzip) definiert.
- Quote paper
- Daniel Schnabl (Author), 2003, Urteilsrezension BGHSt 42, 139, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19069