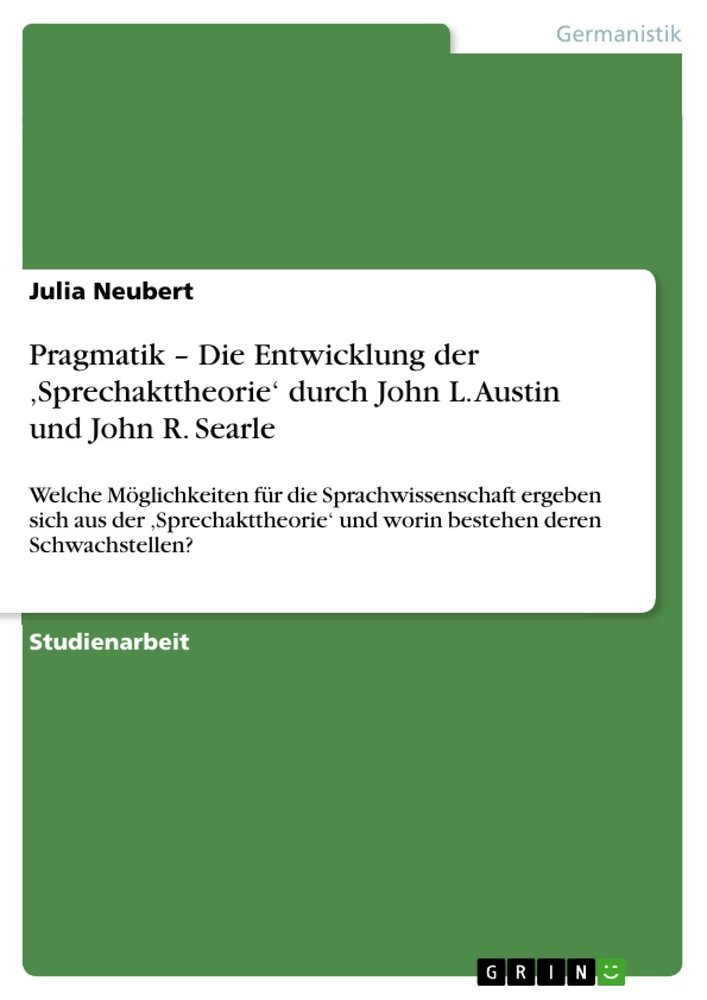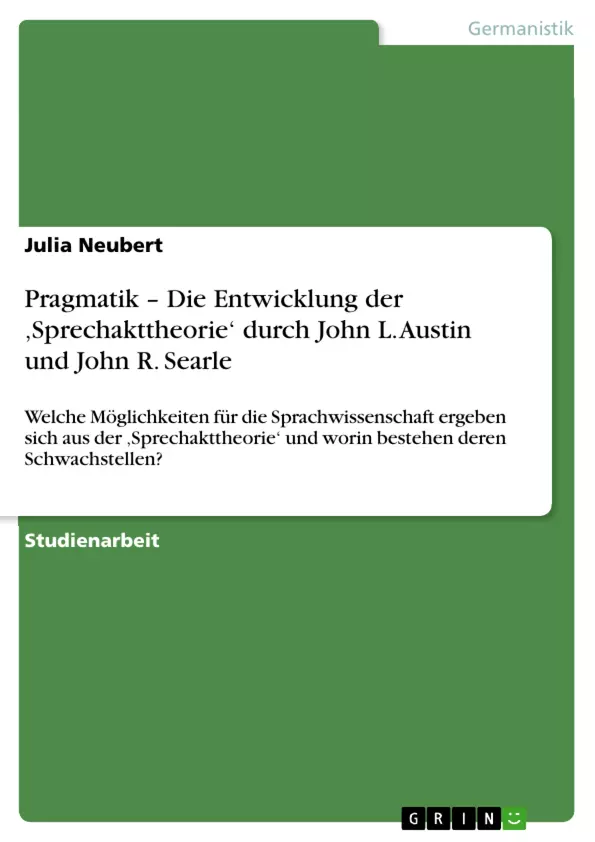Austin und Searles Sprechakttheorie haben die linguistische Pragmatik grundle-gend beeinflusst. Die Deutung von sprachlichen Äußerungen und den in ihn for-mulierten Absichten der Sprecher ist allerdings nicht einfach und somit erweisen sich in den vierziger und fünfziger Jahren auch Austins und Searles durchaus fort-schrittliche Ansätze über das, was wir mit Sprache machen, als lückenhaft und streckenweise sogar fehlerhaft.
In dieser Arbeit möchte ich mich der Sprechakttheorie widmen. Vom Entwurf John L. Austins, über die populärere Weitergestaltung durch John R. Searle bis hin zu ihren Grenzen, der Problematik der indirekten Sprechakte.
Um mich mit der Sprechakttheorie auseinandersetzen zu können gehe ich anfangs auf Austins ursprüngliche Ansätze ein. Sie bilden die Grundlage der Sprechakt-theorie und geben Anlass zur kritischen Hinterfragung derer. Austins Überlegun-gen zu sprachlichen Äußerungen sind zunächst, dass Aussagen nicht nur wahr oder falsch sein können, sondern sie unter bestimmten Voraussetzungen einem Sprecher sogar zum Vollzug von Handlungen dienen können. Seine Theorien bleiben allerdings nicht als solche stehen. Er selbst baut sie weiter aus, stellt fest, dass Äußerungen generell performativ sind und von Sprechern bewusst mit be-stimmten Absichten versehen eingesetzt werden. Zur besseren Analyse von sprachlichen Äußerungen nimmt Austin später die Aufsplittung des Sprechakts in drei Teilakte vor.
Searle wiederum gliedert den Sprechakt in vier Teilakte, setzt die performativen Äußerungen ins Zentrum seiner Überlegungen und beschäftigt sich genauer mit der Klassifikation der Sprechakte, also wodurch sich Bitten von Befehlen, Aussa-gen von Versprechen regelhaft unterscheiden lassen. Aber auch Searle geht in seinen Arbeiten nur am Rande auf die Problematik der indirekten Sprechakte ein.
Ich versuche nachvollziehbar darzustellen wie die Theorie entstand, welche grundsätzlichen Überlegungen sie verfolgt, warum und vor allem welchen Ände-rungen sie unterlag. Geklärt werden soll welche Verbesserungen der Philosoph Searle an der Sprechakttheorie vornimmt, wodurch diese motiviert sind und worin letztendlich ihre Schwächen bestehen.
2 Die Fragestellung der linguistischen Pragmatik
Um sich der Sprechakttheorie und ihrer Notwendigkeit in der modernen Linguis-tik zu nähern, ist es sinnvoll zunächst das Gebiet der Pragmatik, deren Fragestel-lungen und Ziele, zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Fragestellung der linguistischen Pragmatik
- Die Entwicklung der Sprechakttheorie
- Austins philosophische Überlegungen zu sprachlichen Äußerungen
- ,Konstative' und,Performative'
- Gelingensbedingungen' performativer Sätze
- Austins neue Ansätze zur Theorie „,How to do things with words\"
- Austins Sprechakttheorie
- Searles Überlegungen zu Austins, Sprechakttheorie
- Die Vierteilung der Teilakte
- Searles, Sprechaktklassifikation
- Austins philosophische Überlegungen zu sprachlichen Äußerungen
- Möglichkeiten und Grenzen der,Sprechakttheorie‘
- Das Vorkommen und die Charakteristik, indirekter Sprechakte
- Die Problematik der,indirekten Sprechakte“ für die „Sprechakttheorie‘
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sprechakttheorie und deren Entwicklung, beginnend mit den ursprünglichen Ansätzen John L. Austins, über die Weiterentwicklung durch John R. Searle bis hin zu den Grenzen der Theorie, insbesondere im Bereich der indirekten Sprechakte. Das Ziel ist es, die Entstehung, die grundlegenden Überlegungen, die Veränderungen und die Stärken und Schwächen der Sprechakttheorie aufzuzeigen.
- Die Entwicklung der Sprechakttheorie von Austin und Searle
- Die Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen
- Die Klassifikation von Sprechakten und deren Teilakte
- Die Problematik der indirekten Sprechakte
- Die Bedeutung der Sprechakttheorie für die linguistische Pragmatik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Sprechakttheorie von Austin und Searle für die Linguistik. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar, nämlich die Untersuchung der Entstehung, Entwicklung und Grenzen der Sprechakttheorie. Die Einleitung betont, dass Austins und Searles Ansätze zwar wegweisend waren, jedoch in der Praxis als lückenhaft und fehlerhaft gelten.
Das zweite Kapitel widmet sich der Fragestellung der linguistischen Pragmatik. Es wird erläutert, dass Pragmatik als Sprach-Handlungs-Theorie betrachtet wird und sich mit dem Sprachgebrauch in kommunikativen Situationen beschäftigt.
Das dritte Kapitel behandelt die Entwicklung der Sprechakttheorie. Es werden Austins philosophische Überlegungen zu sprachlichen Äußerungen, die Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Sätzen sowie Austins neue Ansätze zur Theorie ,,How to do things with words" dargestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich den Möglichkeiten und Grenzen der Sprechakttheorie. Es werden das Vorkommen und die Charakteristik indirekter Sprechakte sowie deren Problematik für die Sprechakttheorie beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, Pragmatik, Sprache, Handlung, Austin, Searle, konstative Äußerungen, performative Äußerungen, Sprechaktklassifikation, indirekte Sprechakte.
- Citar trabajo
- Julia Neubert (Autor), 2009, Pragmatik – Die Entwicklung der ‚Sprechakttheorie‘ durch John L. Austin und John R. Searle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190776