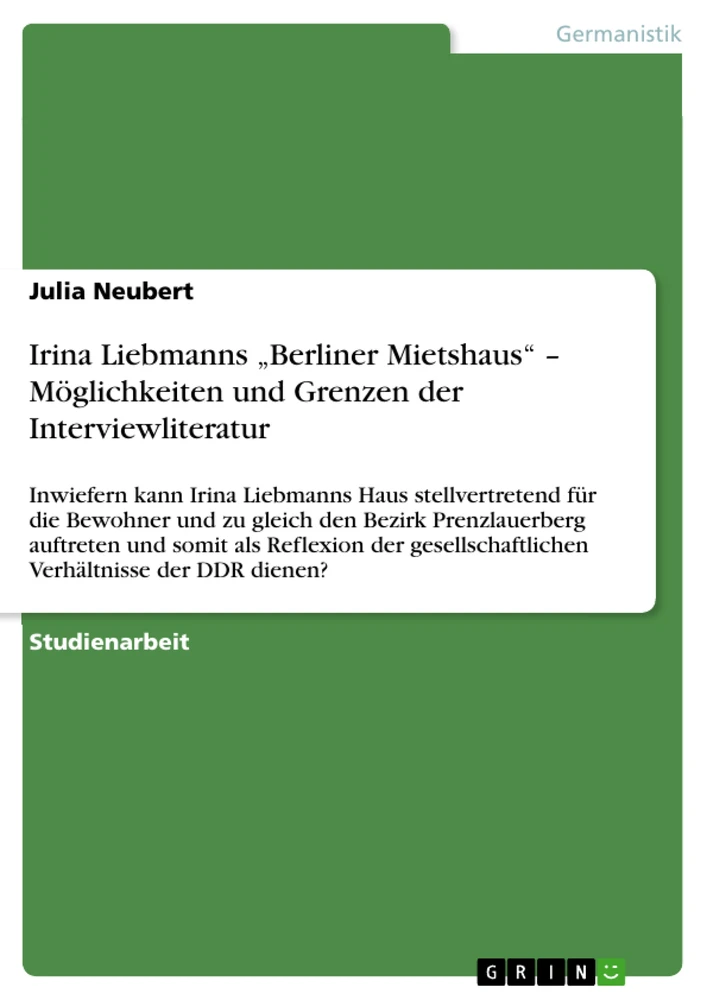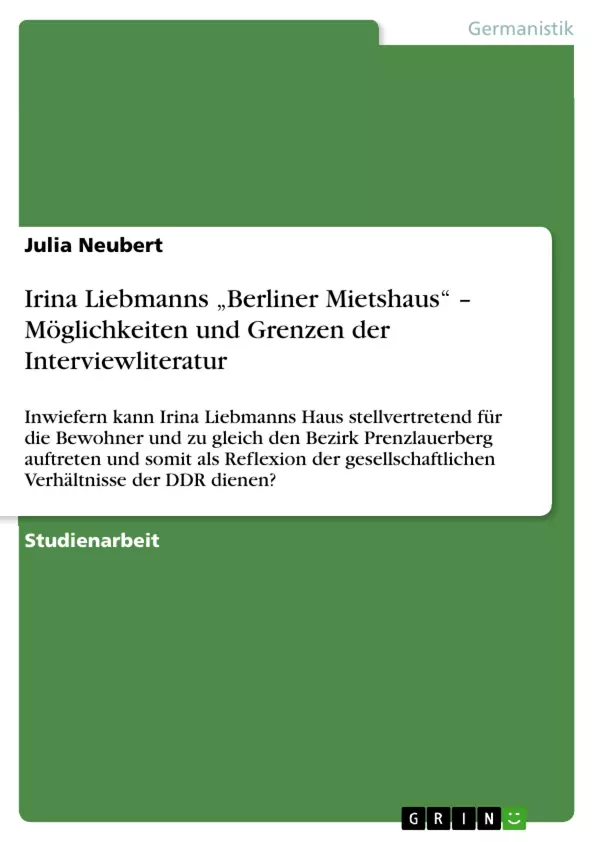Im Fokus dieser Arbeit steht Irina Liebmanns „Berliner Mietshaus“ und die dort stattgefundenen „Begegnungen und Gespräche“. Dabei soll unter Betrachtung der Gesamtheit der einzelnen Bewohnerportraits des „Berliner Mietshaus[es]“ unter Anderem nachvollziehbar erläutert werden, warum sich die Befragten eher als eine anscheinend untereinander anonyme, meist heterogene und willkürlich vom Schicksal zusammengewürfelte Gruppe, nahezu ohne gemeinschaftliche Tenden-zen herausstellen. Auch die Frage, warum das „Berliner Mietshaus“ zum Teil als ein „unbequemes, ein ehrliches Buch“ rezipiert wurde, welches mit scheinbar „schonungsloser Offenheit [damalige] Umstände“ enthüllt, soll nicht unbeant-wortet bleiben.
Inwiefern lassen sich nun diese zusammengewürfelten Portraits als eine Reflexion der DDR-Gesellschaft verstehen und vor allem mit welcher Intention?
Ich möchte beweisen, dass sowohl die einzeln befragten 32 Mietsparteien des „Berliner Mietshaus“ als ‚Menschengemeinschaft‘, wie auch das Haus selbst eine symbolträchtige Rolle einnehmen und von Liebmann bewusst zur Darstellung und letztendlich zur Vermittlung der vorgefundenen Ausschnitte zum Leben in der DDR genutzt werden.
Unter Einbeziehung und Auswertung der ausgewählten Sekundärliteratur soll Irina Liebmanns Methodik im Interview selbst, wie die Vorgehensweise bei der literarischen Umsetzung der „Begegnungen und Gespräche“, auch durch den Vergleich zum Konzept der gängigen Interviewliteratur näher beleuchtet werden. Da im Allgemeinen speziell die Literaturlage zu diesem Thema recht spärlich, andererseits vieles deutungsabhängig ist, soll meine Arbeit einen Einblick in Liebmanns Vorgehensweise gewähren, um in einer zusammenfassenden Auswer-tung als ein Interpretationsangebot die Frage nach Authentizität und Stellvertre-terfunktion des „Berliner Mietshaus[es]“ für die DDR-Gesellschaft zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung des Werkes „Berliner Mietshaus“
- Die Vorgehensweise Irina Liebmanns als Autorin im „Berliner Mietshaus“
- Der Weg zum Berliner Mietshaus
- Allgemeines zur Interviewliteratur
- Die Umsetzung – Darstellung der „Begegnungen und Gespräche“
- Das Haus
- Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Irina Liebmanns Werk „Berliner Mietshaus“ und den „Begegnungen und Gesprächen“, die darin festgehalten werden. Ziel ist es, die Bewohnerportraits des „Berliner Mietshaus[es]“ zu analysieren und die Frage zu beantworten, warum die Befragten eher als eine anonyme, heterogene und zufällig zusammengewürfelte Gruppe erscheinen. Zudem soll untersucht werden, warum das „Berliner Mietshaus“ als ein „unbequemes, ein ehrliches Buch“ wahrgenommen wurde, das „schonungsloser Offenheit [damalige] Umstände“¹ enthüllt. Darüber hinaus wird die Intention Liebmanns beleuchtet und geklärt, inwiefern die zusammengetragenen Portraits als eine Reflexion der DDR-Gesellschaft verstanden werden können.
- Analyse der Bewohnerportraits im „Berliner Mietshaus“
- Die Rolle des „Berliner Mietshauses“ als Spiegel der DDR-Gesellschaft
- Die Intention Irina Liebmanns bei der Auswahl und Darstellung der Bewohner
- Die Authentizität und Stellvertreterfunktion des „Berliner Mietshauses“
- Die Methodik Irina Liebmanns im Interview und in der literarischen Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die Zielsetzung. Dabei wird der Fokus auf Irina Liebmanns Werk „Berliner Mietshaus“ und die dort stattgefundenen „Begegnungen und Gespräche“ gelegt.
Vorstellung des „Berliner Mietshauses“
Dieses Kapitel stellt das „Berliner Mietshaus“ vor und gibt Einblicke in die Entstehung des Werkes sowie in die Methodik der Autorin. Liebmann schildert die Entstehung des Buches im Rahmen ihrer journalistischen Tätigkeit und beschreibt die Auswahl des Mietshauses in der Papenallee im Berliner Bezirk Prenzlauerberg. Sie stellt die „Kombination von Biographie[n], Erinnerung[en] und Kommentar[en]«³ der Bewohner vor und hebt die „bewusst fragmentisierten Lebensgeschichten“ hervor, die als eine „lockere Sammlung von Reportagen“ und eine „dicht komponierte Beschreibung der Alltagsgeschichte des Hauses und seiner Bewohner“ betrachtet werden können.
Die Vorgehensweise Irina Liebmanns als Autorin im „Berliner Mietshaus“
Der Weg zum „Berliner Mietshaus“
Dieser Abschnitt beleuchtet die Motivation Irina Liebmanns für die Entstehung des „Berliner Mietshauses“ und ihren Anspruch an sich selbst als Schriftstellerin. Es wird beschrieben, wie Liebmann aufgrund fehlender Inspiration und eines hohen Qualitätsanspruchs ihre Aufgabe als Journalistin in der DDR mit ihren eigenen Idealen vom Schreiben in Konflikt sah. Sie beschreibt die Einschränkungen und die Einseitigkeit des Blickwinkels, die ihr in der DDR-Reportage auferlegt wurden.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind „Berliner Mietshaus“, Irina Liebmann, Interviewliteratur, DDR-Gesellschaft, Authentizität, Stellvertreterfunktion, Methodik, „Begegnungen und Gespräche“, Lebensgeschichten, Alltagsgeschichte, Reportage, journalistische Tätigkeit, DDR-Reportage.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Irina Liebmanns „Berliner Mietshaus“?
Das Werk dokumentiert Begegnungen und Gespräche mit Bewohnern eines Hauses im Prenzlauer Berg zur Zeit der DDR.
Warum wird das Buch als „schonungslos offen“ bezeichnet?
Es enthüllt die tatsächlichen Lebensumstände und die Anonymität der Bewohner, was im Kontrast zum offiziellen DDR-Gesellschaftsbild stand.
Was ist das Besondere an der Methodik der Interviewliteratur hier?
Liebmann nutzt bewusst fragmentierte Lebensgeschichten und Biographien, um eine authentische Alltagsgeschichte des Hauses zu weben.
Dient das Haus als Symbol für die DDR-Gesellschaft?
Ja, die Arbeit untersucht die Stellvertreterfunktion des Hauses als Spiegel einer heterogenen und oft isolierten Gesellschaft.
Welchen Konflikt hatte Liebmann als Journalistin in der DDR?
Sie empfand die Einseitigkeit der staatlich auferlegten Reportage-Vorgaben als Einschränkung ihrer literarischen Ideale.
- Citation du texte
- Julia Neubert (Auteur), 2010, Irina Liebmanns „Berliner Mietshaus“ – Möglichkeiten und Grenzen der Interviewliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190779