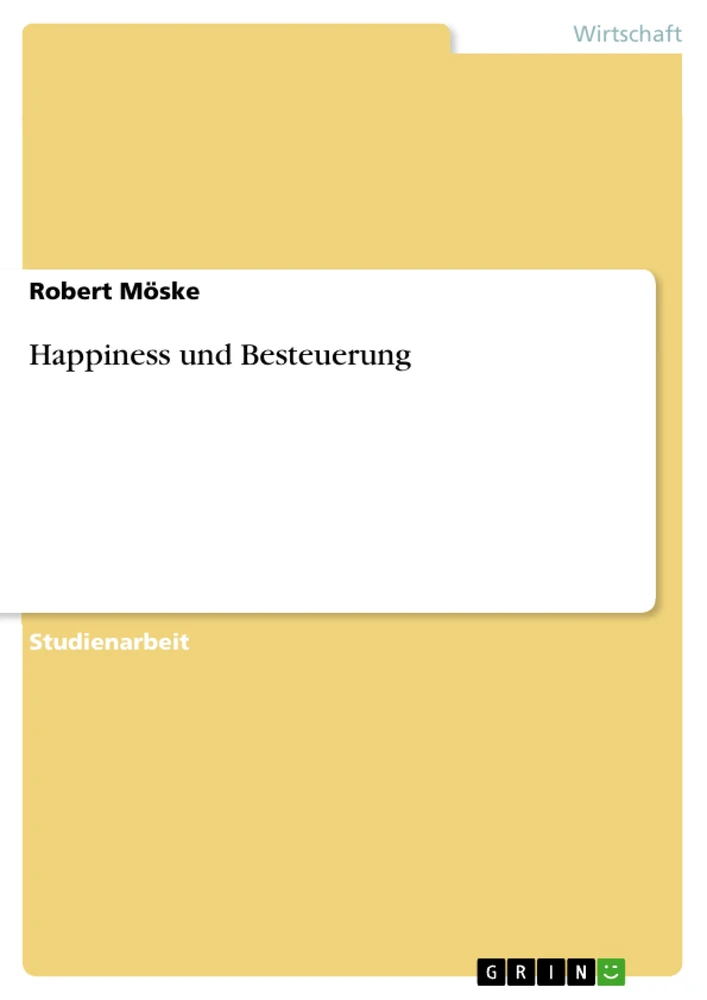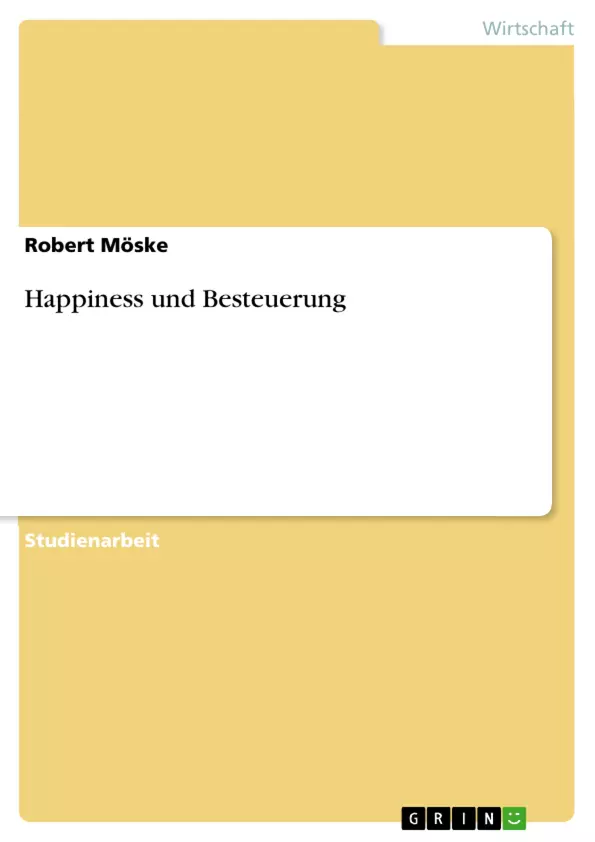"Der Glaube an die politische Herstellbarkeit von Glück gehört an zentraler Stelle zum Selbstverständnis der Moderne schlechthin, legitimiert unter den Bedingungen des modernen
Denkens geradezu die Politik"
Helmut Klages
Die Glücksforschung ist in den letzten Jahren zu einem aufstrebenden interdisziplinären Forschungsgebiet avanciert. Ökonomen, Psychologen, Biologen und Philosophen beschäftigen sich mit dem Thema Glück aus unterschiedlichen Perspektiven. So untersuchten sie wie
Glück gemessen werden kann, was Glück im Grunde ist und welches die Determinanten des Glücks sind. Darüber hinaus ist das Thema Glück ein zeitunabhängiger, kulturinvarianter Gegenstand der menschlichen Natur, welches durch zahlreiche Schriften von berühmten
Philosophen, die teilweise über 2000 Jahre zurückreichen, deutlich wird. Diese Präsenz in der Wissenschaft und der Menschheitsgeschichte färbt nun auch auf die Politik ab, wie man
an dem Monatsbericht des Bundesministerium der Finanzen vom April 2010 erkennen kann.
Im Sinne des Zitats von Helmut Klages, ist es nicht verwunderlich, das Ökonomen sich Gedanken machen wie Glück und Steuern zusammenhängen. Dahinter steht die Idee der „politische
Herstellbarkeit von Glück“. In dieser Arbeit wird dieser Zusammenhang zwischen Steuern und Glück untersucht. Dies wird anhand einer empirischen Analyse, genauer gesagt, anhand einer ordinalen Logit Regression umgesetzt. Dazu werden in Kapitel 2 die
grundlegenden theoretischen Konzepte der Glücksforschung dargestellt. Dabei wird vor allem auf das Einkommen und die Arbeitslosigkeit Bezug genommen, da in Ermanglung von Daten nicht die direkte Auswirkung von Steuern auf das Glück untersucht werden kann. Dieses Vorgehen stimmt mit der allgemeinen Praxis der Glücksforschung überein. In Kapitel 3
werden die verwendeten Daten und das empirische Modell kurz erläutert. Kapitel 4 beinhaltet die Ergebnisse der empirischen Analyse. Im darauffolgenden Kapitel werden anhand der
Ergebnisse Rückschlüsse auf die Steuerpolitik gezogen. Dabei wird versucht, eine optimale
Steuer in Bezug auf größtmögliche Lebenszufriedenheit zu skizzieren. Abschließend werden
die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Grundlagen der Glücksforschung
- 2.2 Steuern und Glück
- 3. Empirischer Untersuchungsansatz
- 3.1 Verwendete Daten
- 3.2 Verwendetes Modell und konzeptioneller Ansatz der Auswertung
- 4. Ergebnisse der empirischen Analyse
- 5. Steuerpolitische Implikationen
- 6. Zusammenfassung
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Steuern und Glück. Hierbei wird die These der „politischen Herstellbarkeit von Glück“ betrachtet, wobei die Frage im Fokus steht, inwiefern Steuern das subjektive Wohlbefinden der Menschen beeinflussen können. Die empirische Analyse fokussiert dabei auf die Auswirkungen von Einkommen und Arbeitslosigkeit auf das Glück, da direkte Daten zum Einfluss von Steuern auf das Glück fehlen.
- Theoretische Grundlagen der Glücksforschung
- Einflussfaktoren auf das Glück
- Zusammenhang zwischen Steuern und Glück
- Empirische Analyse der Glücksdeterminanten
- Steuerpolitische Implikationen für die Steigerung der Lebenszufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Glück in der heutigen Zeit und stellt den Zusammenhang zwischen Glück und Steuern in den Kontext der „politischen Herstellbarkeit von Glück“ dar. Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel und skizziert die Methode der empirischen Analyse.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Glücksforschung, wobei unterschiedliche Glücksempfindungen und Determinanten des Glücks betrachtet werden. Es wird insbesondere auf die Rolle von Einkommen und Arbeitslosigkeit als Einflussfaktoren auf das Glück eingegangen, da diese Faktoren in der empirischen Analyse untersucht werden.
- Kapitel 3: Empirischer Untersuchungsansatz: In diesem Kapitel werden die verwendeten Daten und das empirische Modell vorgestellt, das zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Glück und den ausgewählten Faktoren eingesetzt wird.
- Kapitel 4: Ergebnisse der empirischen Analyse: Die Ergebnisse der empirischen Analyse werden in diesem Kapitel dargestellt und analysiert. Es wird untersucht, inwiefern Einkommen und Arbeitslosigkeit das subjektive Wohlbefinden beeinflussen.
- Kapitel 5: Steuerpolitische Implikationen: Aus den Ergebnissen der empirischen Analyse werden in diesem Kapitel Schlussfolgerungen für die Steuerpolitik gezogen. Es wird versucht, eine optimale Steuer in Bezug auf größtmögliche Lebenszufriedenheit zu skizzieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Glück und seiner Beziehung zur Steuerpolitik. Zentrale Begriffe sind Lebenszufriedenheit, subjektives Wohlbefinden, Glücksempfindung, Einkommen, Arbeitslosigkeit und Steuerpolitik. Die empirische Analyse stützt sich auf die Erkenntnisse der Glücksforschung und untersucht den Einfluss von ökonomischen Determinanten auf das Glück.
Häufig gestellte Fragen
Was ist 'Glücksforschung' in der Ökonomie?
Ein interdisziplinäres Feld, das untersucht, wie Glück gemessen werden kann und welche Faktoren (Determinanten) das Wohlbefinden beeinflussen.
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Steuern und Glück?
Die Arbeit nutzt Einkommen und Arbeitslosigkeit als Hilfsgrößen, um Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Steuern auf die Lebenszufriedenheit zu ziehen.
Was bedeutet 'politische Herstellbarkeit von Glück'?
Der Gedanke, dass politische Maßnahmen und Rahmensetzungen (wie die Steuerpolitik) aktiv dazu beitragen können, das Glück der Bürger zu steigern.
Wie sieht eine 'optimale Steuer' für das Glück aus?
Basierend auf der empirischen Analyse werden steuerpolitische Implikationen skizziert, die auf eine größtmögliche Lebenszufriedenheit abzielen.
Welche Methode wurde für die empirische Analyse genutzt?
Es wurde eine ordinale Logit-Regression durchgeführt, um die Determinanten der Lebenszufriedenheit zu bestimmen.
- Citation du texte
- Robert Möske (Auteur), 2010, Happiness und Besteuerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190805