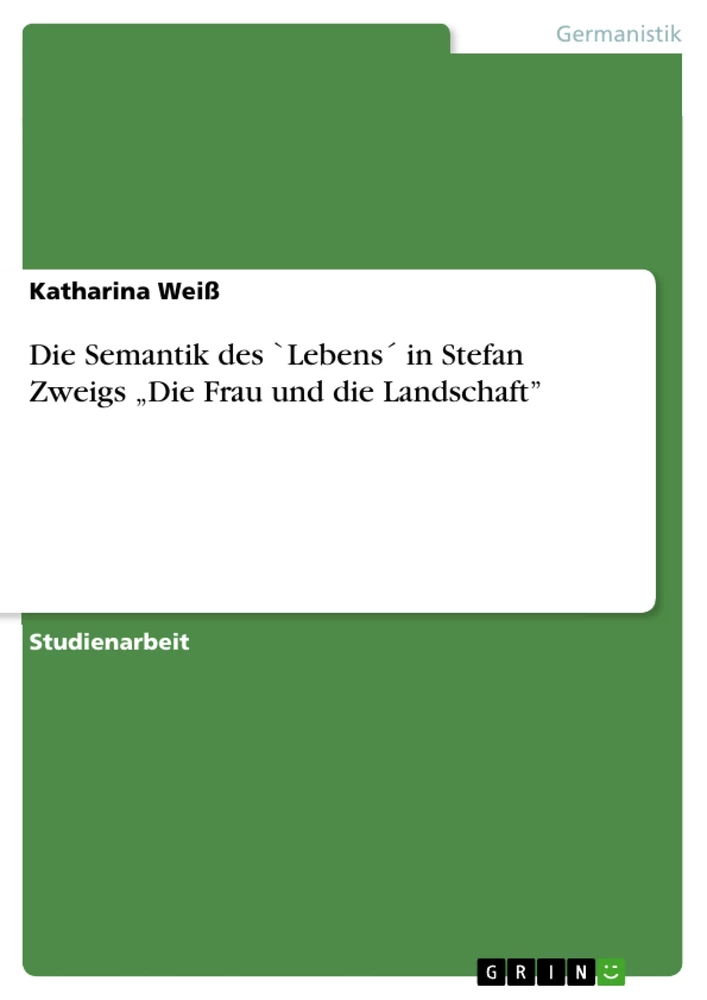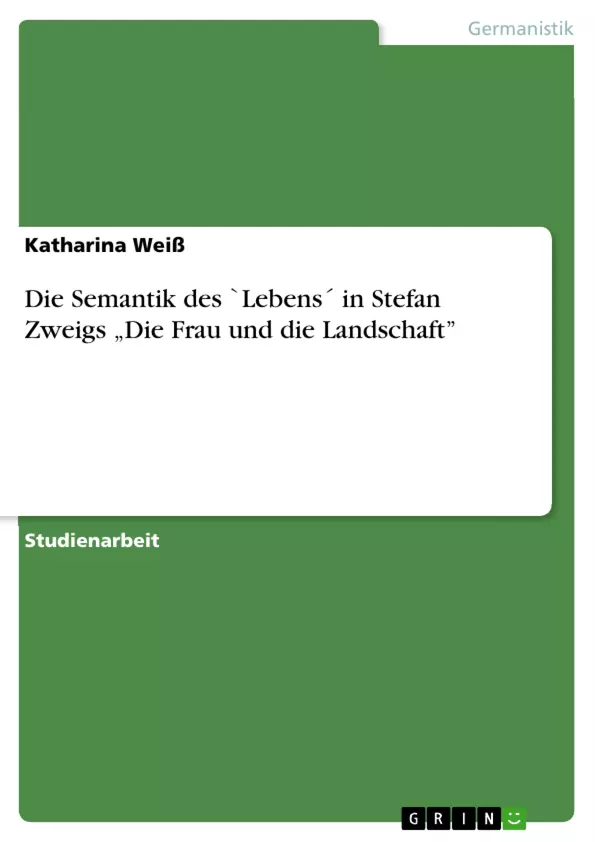Dieses Zitat Stefan Zweigs beschreibt äußerst zutreffend sein hauptsächlich aus Novellen bestehendes Werk, das fast ausschließlich den tragischen Ausgang kennt. Auch in der auf die Semantik des `Lebens´ zu untersuchenden Novelle „Die Frau und die Landschaft“2 soll auf die Frage - ob am Ende eine metaphorische Wiedergeburt steht oder auch hier nur ein weiteres trauriges Schicksal – eine Antwort gefunden werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den vorliegenden Text aus dem Zeitverständnis der zwanziger Jahre der Frühen Moderne heraus auf seine Bedeutung hin zu interpretieren. Hierbei ist es zunächst sinnvoll die „Lebensideologie“3 der klassischen Moderne zu untersuchen und daraus Rückschlüsse auf die Novelle zu ziehen; zumal der Forschungsstand bezüglich dieses Werkes Zweigs faktisch bei Null steht. Dabei soll der Schlüsselbegriff der Epoche `Leben´ besondere Beachtung finden und definiert werden, nicht nur weil er das Zentrum des intellektuellen Denkens der damaligen Zeit darstellt, sondern auch aufgrund seiner strukturellen Komplexität. Das maßgebende Werk Martin Lindners4 bezieht sich hierbei allerdings hauptsächlich auf die Neue Sachlichkeit, der Stefan Zweig sprachlich nur latent aufgrund seines glatten, klaren Stils und inhaltlich gar nicht zuzuordnen ist. Ganz besonders der für ihn schon konstituierende Psychologismus seiner Darstellungen passt keinesfalls zu dieser Strömung.5
[...]
2 Zweig, Stefan: Amok. Novellen einer Leidenschaft. Leipzig. Insel 1922.
3 Lindner, Martin: Leben in der Krise. Zeitromane der neuen Sachlichkeit und die intellektuelle Mentalität der klassischen Moderne. Stuttgart, Weimar. Metztler 1994.
4 Ebd.
5 Becker, Sabina: Die literarische Moderne der zwanziger Jahre. Theorie und Ästhetik der Neuen Sachlichkeit. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. 27 (2002) 1.
S. 73-95.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Semantik des `Lebens' in der Literatur der Frühen Moderne
- 1. Begriffsdefinition von `Leben` und Lebensraum
- 2. Die Krise
- 3. Normbruch und Erotik als Pfad zu emphatischem Leben
- III. ,,Die Frau und die Landschaft"
- 1. Die Funktion der Landschaft und ihre Einordnung in die Lebenssemantik
- 2. Die Beziehung der Figuren zueinander und deren 'lebensideologische Konzeption
- 3. Bedeutung von Erotik und Normbruch
- IV. Die Geschichte einer metaphorischen Wiedergeburt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Stefan Zweigs Novelle „Die Frau und die Landschaft“ im Kontext der „Lebensideologie“ der Klassischen Moderne. Ziel ist es, die Bedeutung des Textes im Zeitverständnis der 1920er Jahre zu ergründen und den Schlüsselbegriff „Leben“ zu definieren. Dabei sollen die Leitfragen nach einer möglichen metaphorischen Wiedergeburt, der Charakteristik der Krise, der Rolle der Erotik und der Bedeutung des Mädchens für den Erzähler beantwortet werden.
- Die Semantik des „Lebens“ in der Klassischen Moderne
- Die „Lebensideologie“ als prägendes Merkmal der 1920er Jahre
- Die Beziehung zwischen Form und Inhalt im Konzept des Lebens
- Der Einfluss des Lebensraums auf die Seelenlandschaft der Figuren
- Die Bedeutung von Krise und Erotik für die Erlangung eines neuen Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet Stefan Zweigs Fokus auf das tragische Schicksal in seinen Novellen. Anschließend wird die „Lebensideologie“ der Klassischen Moderne als Grundlage für die Analyse von „Die Frau und die Landschaft“ eingeführt.
Kapitel II widmet sich der Semantik des „Lebens“ in der Literatur der Frühen Moderne. Es definiert den Begriff „Leben“ und beleuchtet seine verschiedenen Bedeutungen. Dabei werden die Polarität von „Form“ und „Ganzheit“, die semantischen Achsen des lebensideologischen Raumes sowie die Bedeutung des Lebensraums für die Seelenlandschaft der Figuren erläutert.
Kapitel III untersucht „Die Frau und die Landschaft“ im Detail. Es analysiert die Funktion der Landschaft in Bezug auf die Lebenssemantik, beleuchtet die Beziehungen der Figuren zueinander und ihre 'lebensideologische Konzeption' sowie die Bedeutung von Erotik und Normbruch.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Leben, Lebensideologie, Klassische Moderne, Krise, Wiedergeburt, Normbruch, Erotik, Landschaft, Seelenlandschaft, Stefan Zweig, „Die Frau und die Landschaft“.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Stefan Zweigs Novelle „Die Frau und die Landschaft“?
Die Novelle thematisiert eine psychologische Krise und die Suche nach dem „wahren Leben“. Sie wird hier im Kontext der Lebensideologie der 1920er Jahre analysiert.
Was bedeutet „Lebensideologie“ in der Klassischen Moderne?
Der Begriff „Leben“ war ein zentrales intellektuelles Konzept der Zeit, das Vitalität, Ganzheit und den Ausbruch aus starren gesellschaftlichen Formen in den Vordergrund stellte.
Welche Funktion hat die Landschaft in der Novelle?
Die Landschaft dient als Spiegel der „Seelenlandschaft“ der Figuren und ist eng mit der Lebenssemantik und der emotionalen Entwicklung verknüpft.
Steht am Ende der Geschichte eine metaphorische Wiedergeburt?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob die tragischen Schicksale in Zweigs Werk Raum für eine metaphorische Wiedergeburt oder Hoffnung lassen.
Welche Rolle spielen Erotik und Normbruch in diesem Werk?
Erotik und der Bruch mit gesellschaftlichen Normen werden als Pfade zu einem emphatischen, intensiven Leben und als Mittel zur Überwindung der Krise dargestellt.
- Quote paper
- Katharina Weiß (Author), 2009, Die Semantik des `Lebens´ in Stefan Zweigs „Die Frau und die Landschaft”, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190846