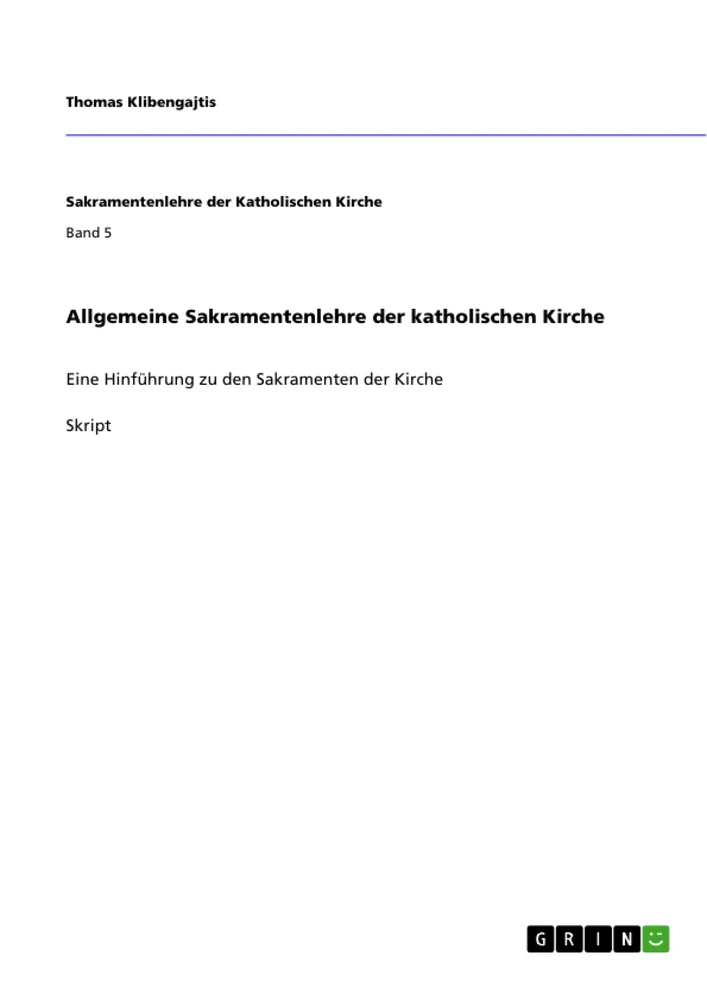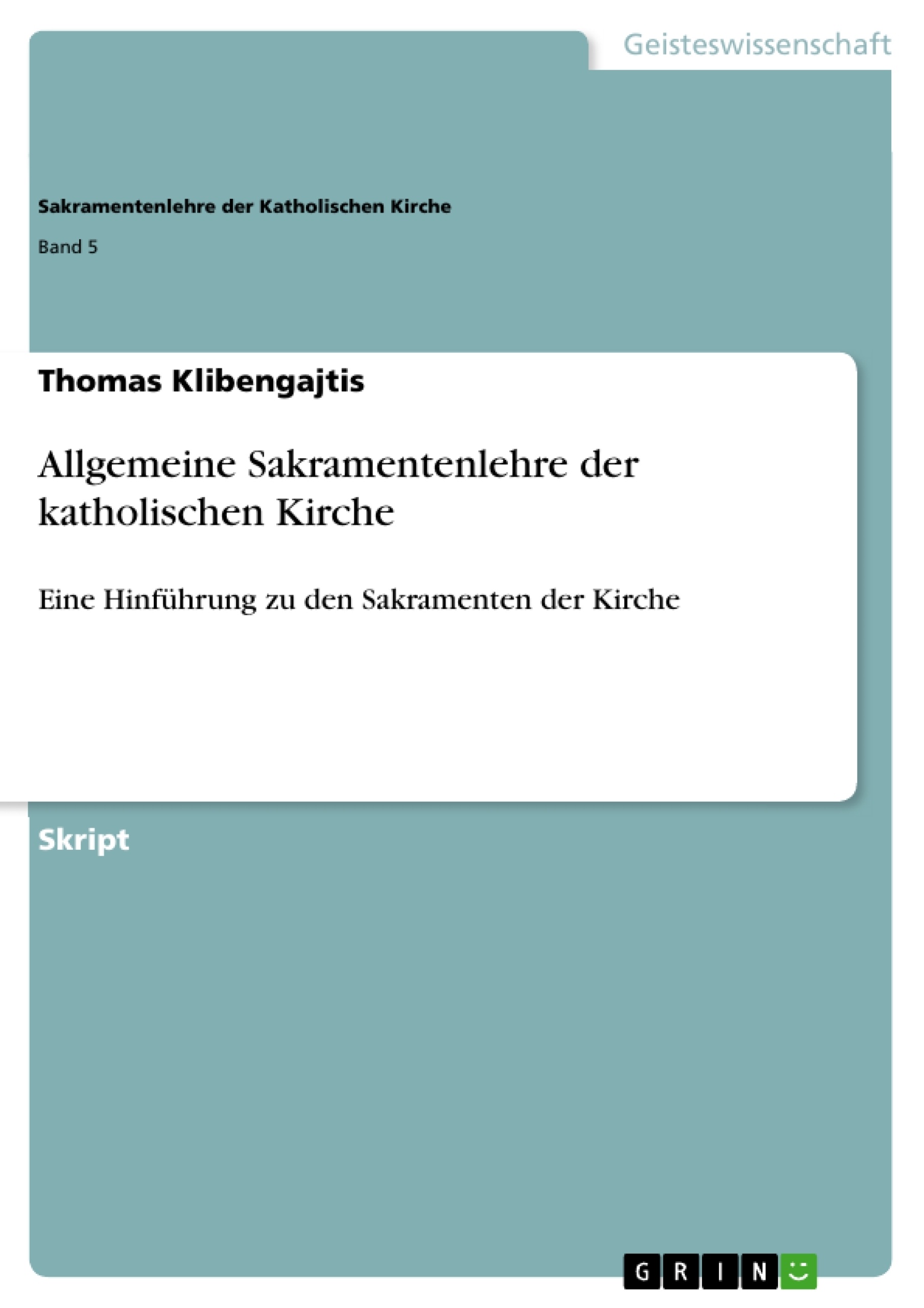Eine verständlich geschriebene Einführung in die Allgemeine Sakramentenlehre der Katholischen Kirche. Erklärung der Grundbegriffe: sacramentum, materia und forma, Wirkung, Zahl und Ordnung, Spender und Empfänger der Sakramente, gefolgt von einer kurzen Darstellung der Sakramentenlehre bei Luther, Calvin und Zwingli. Zahlreiche Quellentexte und Zitate aus den Werken der Kirchenlehrer und Kirchenväter. Gedacht für alle, die theoretisch und praktisch ihr sakramentales Leben vertiefen möchten. Dient als Einleitung zu meiner speziellen Sakramentenlehre, in welcher (1) Taufe, (2) Firmung, (3) Eucharistie, (4) Buße, (5) Krankensalbung, (6) Ehe und (7) Weihe vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Was ist ein Sakrament?
- a. Die Wortbedeutung von Sakrament
- b. Die Sachbedeutung von Sakrament
- 2. Sinn der Sakramente. Warum brauchen wir sie?
- a. Die anthropologische Basis der Sakramente
- b. Die christologische Basis der Sakramente
- c. Die ekklesiologische Basis der Sakramente
- 3. Struktur der Sakramente
- a. Signum
- b. Materia und forma
- 4. Wirkungen der Sakramente
- a. Heiligung des Menschen und Christusförmigkeit
- b. Spezielle sakramentale Gnade
- c. Der sakramentale Charakter und character indelebilis
- d. Die objektive Wirksamkeit der Sakramente (ex opere operato)
- 5. Ursprung, Zahl und Ordnung der Sakramente
- a. Ursprung der Sakramente. Einsetzung durch Christus
- b. Zahl der Sakramente. Begründung der Siebenzahl der Sakramente
- c. Ordnung der Sakramente
- 6. Spender und Empfänger der Sakramente
- a. Spender der Sakramente
- b. Empfänger der Sakramente
- 7. Sakramentalien
- 8. Protestantische Sicht der Sakramente
- a. Fundamente der protestantischen Sakramentenlehre:
- i. Anthropologie
- ii. Rechtfertigungslehre
- iii. Sola fides, sola gratia und sola Scriptura
- b. Sakramentenlehre Luthers
- c. Sakramentenlehre Calvins und Zwinglis
- i. Ansichten Calvins
- ii. Ansichten Zwinglis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Reader bietet eine umfassende Einführung in die Sakramentenlehre der katholischen Kirche. Er dient als Begleitmaterial für Vorlesungen, die im Sommersemester 2008 an der TU Dresden gehalten wurden. Der Reader beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Sakramente, von ihrer Wort- und Sachbedeutung bis hin zu ihrer Struktur, Wirkung und dem Ursprung. Darüber hinaus wird die protestantische Sicht auf die Sakramente beleuchtet, um ein breiteres Verständnis des Themas zu ermöglichen.
- Die Bedeutung und Funktion der Sakramente in der katholischen Kirche
- Die anthropologische, christologische und ekklesiologische Grundlage der Sakramente
- Die Struktur und Wirkung der Sakramente
- Die protestantische Sicht auf die Sakramente und die Unterschiede zur katholischen Lehre
- Die Geschichte der Sakramente und ihre Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Sakrament". Es werden die Wort- und Sachbedeutung des Begriffs beleuchtet, wobei die historischen Entwicklungen und verschiedenen Interpretationen des Begriffs "Sakrament" im Laufe der Zeit hervorgehoben werden.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Sinn der Sakramente und der Frage, warum sie für den Menschen von Bedeutung sind. Es werden die anthropologische, christologische und ekklesiologische Basis der Sakramente erörtert. Die anthropologische Basis betrachtet den Menschen als "sakramentales Wesen" mit einer symbolischen Grundstruktur. Die christologische Basis befasst sich mit Christus als "Ursakrament", während die ekklesiologische Basis die Kirche als "Sakrament" betrachtet.
Kapitel 3 behandelt die Struktur der Sakramente. Es werden die verschiedenen Elemente, die ein Sakrament ausmachen, erläutert, darunter das Signum, die Materia und die forma.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Wirkungen der Sakramente. Die Kapitel behandelt die Heiligung des Menschen und die Christusförmigkeit, die durch die Sakramente erlangt werden können. Es werden die verschiedenen Arten der sakramentalen Gnade und der sakramentale Charakter und character indelebilis beleuchtet.
Kapitel 5 beleuchtet den Ursprung, die Zahl und die Ordnung der Sakramente. Es wird die Einsetzung der Sakramente durch Christus erörtert, sowie die Begründung der Siebenzahl der Sakramente. Die Kapitel stellt die Ordnung der Sakramente innerhalb der katholischen Kirche dar.
Kapitel 6 behandelt die Spender und Empfänger der Sakramente. Es werden die Qualifikationen für die Ausübung des Sakramentaldienstes und die verschiedenen Arten von Empfängern der Sakramente erläutert.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit den Sakramentalien, die als Hilfsmittel zur Sakramentenspendung dienen.
Kapitel 8 bietet eine umfassende Darstellung der protestantischen Sicht der Sakramente. Die Kapitel beleuchtet die Unterschiede in der anthropologischen und rechtfertigungslehre, die zu unterschiedlichen Sichtweisen auf die Sakramente führen. Es werden die Ansichten Luthers, Calvins und Zwinglis im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Readers umfassen: Sakramente, Sakramentenlehre, katholische Kirche, protestantische Sicht, Anthropologie, Christologie, Ekklesiologie, Signum, Materia, forma, Heiligung, Christusförmigkeit, sakramentale Gnade, character indelebilis, ex opere operato, Ursprung, Zahl, Ordnung, Spender, Empfänger, Sakramentalien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition eines Sakraments in der katholischen Kirche?
Ein Sakrament ist ein wirksames Zeichen der Gnade, das von Christus eingesetzt wurde, um das göttliche Leben zu vermitteln. Es besteht strukturell aus „materia“ (Stoff) und „forma“ (Wort).
Welche sieben Sakramente gibt es?
Die katholische Kirche kennt sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Ehe und Weihe.
Was bedeutet „ex opere operato“?
Es beschreibt die objektive Wirksamkeit der Sakramente: Ein Sakrament wirkt „aus der vollzogenen Handlung heraus“, unabhängig von der persönlichen Würdigkeit des Spenders.
Wie unterscheidet sich die protestantische Sicht auf die Sakramente?
Die protestantische Lehre (Luther, Calvin, Zwingli) reduziert oft die Zahl der Sakramente (meist auf Taufe und Abendmahl) und betont stärker den Glauben (sola fides) als Voraussetzung.
Was ist der „character indelebilis“?
Dies ist ein „unauslöschliches Siegel“, das bei bestimmten Sakramenten (Taufe, Firmung, Weihe) der Seele eingeprägt wird und nicht wiederholt werden kann.
- Quote paper
- Dr. Thomas Klibengajtis (Author), 2008, Allgemeine Sakramentenlehre der katholischen Kirche , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190855