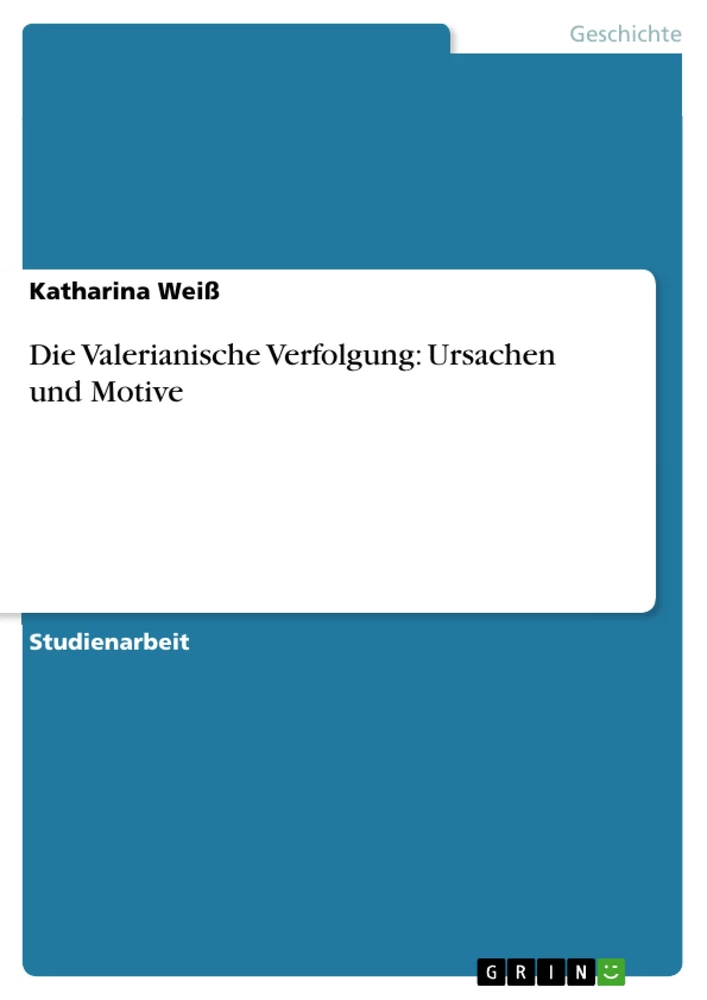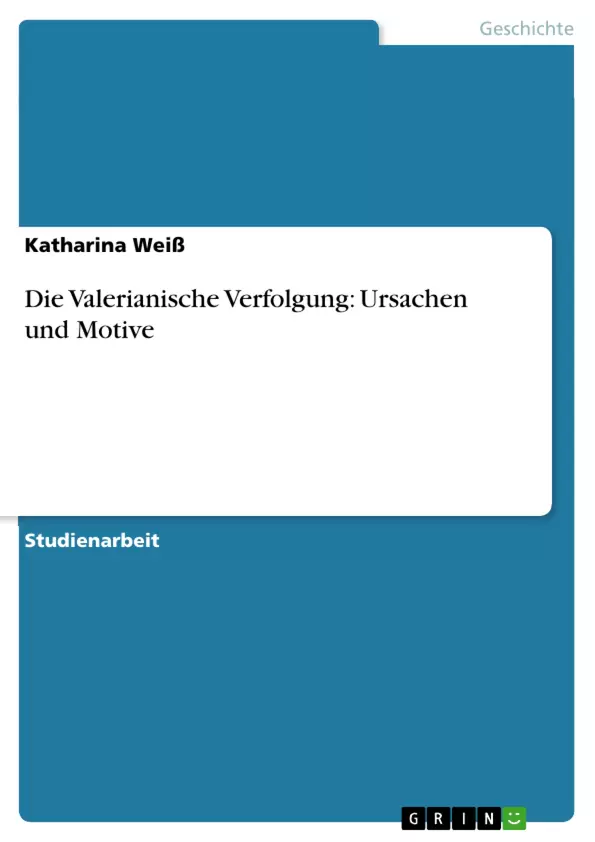Mit dem Begriff „Christenverfolgung“ im Imperium Romanum werden- meist eher einseitig- zahlreiche Foltermethoden, Kreuzigungen, Steinigungen und andere grausame körperliche Strafen sowie unzählige Todesopfer über einen Zeitraum von Jahrhunderten verbunden. Fast automatisch fallen dazu die Namen der berühmt-berüchtigten Kaiser Nero, Trajan oder „Der blutdürstige Tiger, der unbarmherzige Decius“, deren Verfolgungsdurst als schier unersättlich galt und in Literatur wie auch der älteren Forschung zum Teil verfälscht dargestellt wurde. Seltener aber wurden die Hintergründe dieser Verfolgungen genauer beleuchtet und hinterfragt; die religiösen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Situationen und Entscheidungen berücksichtigt. Eben jene komplexen Wirkzusammenhänge sollen in dieser Arbeit an ausgewählten Aspekten am Beispiel der Christenverfolgung Valerians verstärkt betrachtet werden.
Die valerianische Verfolgung war eine recht kurze, aber dennoch nicht minder heftige Welle der Christenverfolgung, die sich aufgrund ihres taktischen Strategiewechsels in der Krise des 3. Jahrhunderts von vorhergehenden Verfolgungen unterscheidet. Weg von der Masse der einfachen christlichen Bevölkerung und hin zu Führungspersönlichkeiten in Klerus und Gesellschaft lautete die Devise der Bekämpfung des Christentums, weshalb das Augenmerk der Forschung besonders darauf gerichtet ist. Doch wer war Valerian? Welche Motive haben ihn geleitet, in welcher Lage befand sich das riesige Reich, welche Rolle spielte sein Sohn Gallienus dabei und weshalb setzte die Verfolgung erst Jahre nach der Erhebung zum Augustus ein?
Zur Beantwortung dieser Fragen soll zunächst eine Einordnung des Valerian und seines Sohnes Gallienus erfolgen, die sich am Bild der älteren wie auch der neueren Forschung orientiert. Auf Grund dieser Basis wird anschließend den Ursachen der erst spät einsetzenden Verfolgung ab 257 n. Chr. nachgegangen; die Edikte und der taktische Wechsel sowie mögliche Motive werden dabei herausgestellt. Besonders im Hinblick auf Gallienus´ Toleranzedikt nach dem Tod des Vaters soll abschließend dessen Rolle und Motivation beurteilt und damit die Situation in der Krise noch einmal aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Die Valerianische Verfolgung: Ursachen und Motive
- 1. Das Bild des Valerian und des Gallienus im Spiegel der Forschung
- 2. Ursachen der späten Verfolgung ab 257: militärisch-geographische Krisenherde
- 3. Die Edikte: Taktikwechsel und Statuierung von Exempeln
- 4. Motive der Verfolgung
- a) Finanzielle Motive
- b) Religiöse und politische Beweggründe
- III Abschlussbetrachtung: Die Rolle des Toleranzediktes des Gallienus. Ideologische Abkehr vom Kurs des Vaters?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der valerianischen Verfolgung, einer recht kurzen, aber heftigen Welle der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert. Im Fokus stehen die Ursachen und Motive, die Valerian zu seiner Entscheidung für die Verfolgung führten. Dabei wird die politische und militärische Situation im Römischen Reich im Kontext der Krise des 3. Jahrhunderts, sowie die Rolle von Valerian und seinem Sohn Gallienus betrachtet.
- Das Bild des Valerian und des Gallienus in der Forschung
- Ursachen der späten Verfolgung ab 257
- Edikte und Taktikwechsel
- Motive der Verfolgung: finanzielle, religiöse und politische Beweggründe
- Die Rolle des Toleranzedikts des Gallienus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Christenverfolgungen im Römischen Reich und stellt die Besonderheit der valerianischen Verfolgung heraus. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Bilder von Valerian und Gallienus in der Forschung beleuchtet und die Ursachen der späten Verfolgung im Kontext der Krise des 3. Jahrhunderts analysiert. Des Weiteren werden die Edikte und die veränderte Taktik der Verfolgung sowie die Motive Valerians beleuchtet. Die Abschlussbetrachtung widmet sich der Rolle des Toleranzedikts des Gallienus und hinterfragt die ideologische Abkehr vom Kurs seines Vaters.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Christenverfolgung, Valerian, Gallienus, 3. Jahrhundert, Krise des Römischen Reiches, Edikte, Taktikwechsel, Motive, Toleranzedikt, historische Forschung.
- Arbeit zitieren
- Katharina Weiß (Autor:in), 2011, Die Valerianische Verfolgung: Ursachen und Motive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190884