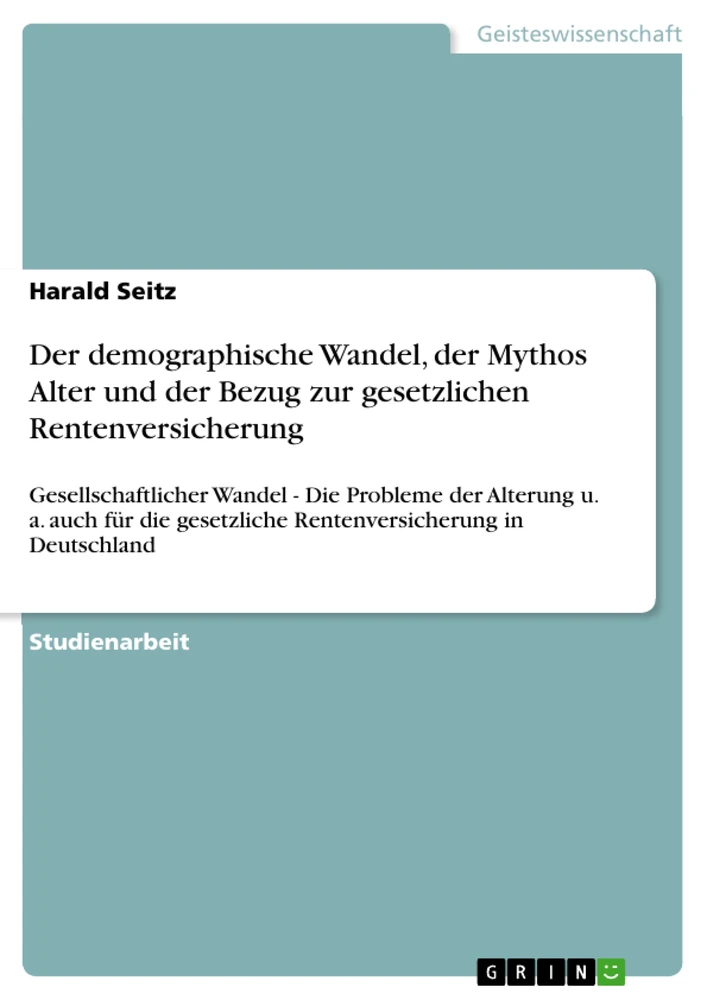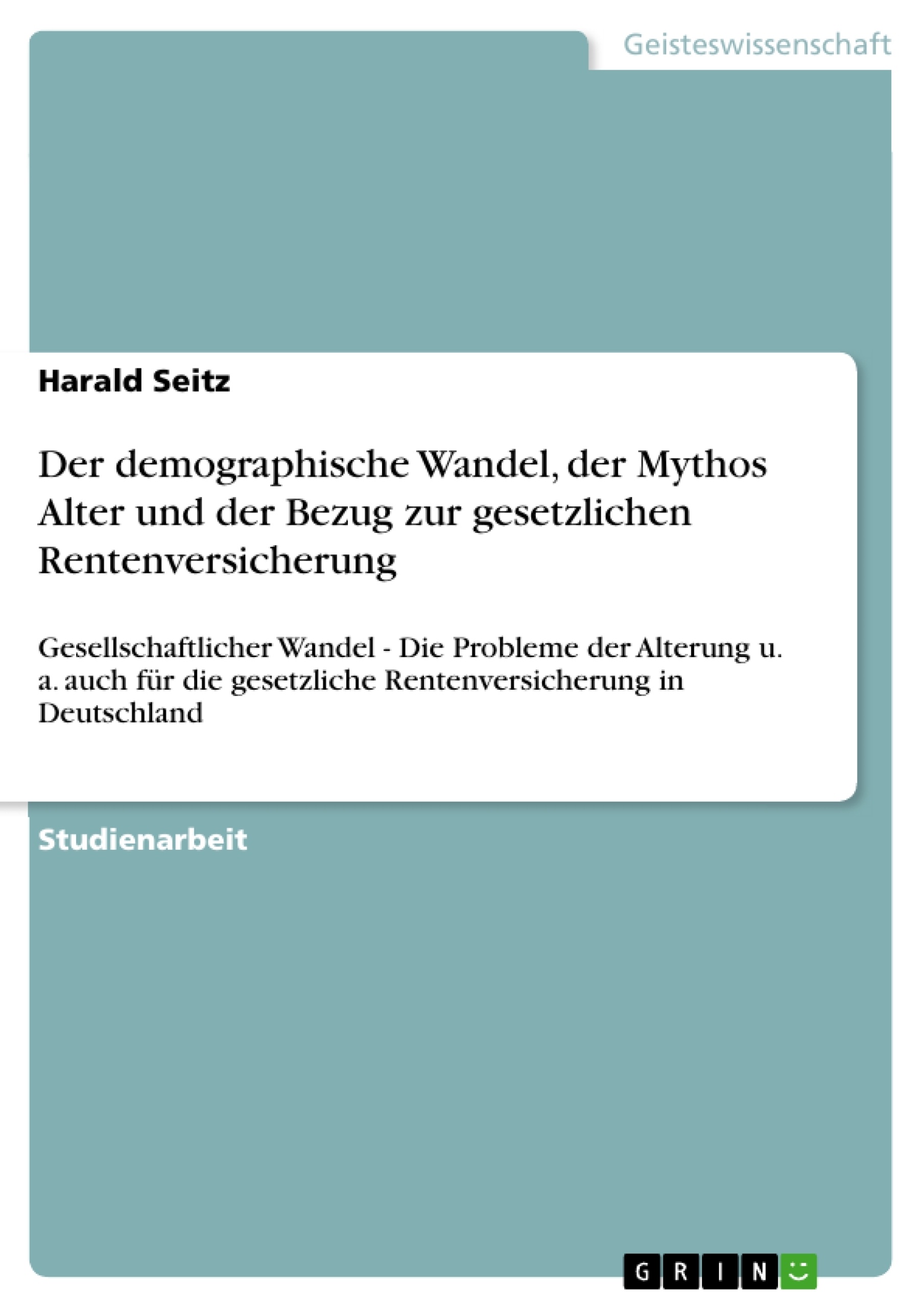In Deutschland wird viel über den demographischen Wandel diskutiert und geschrieben: „Diktatur der Alten“, „Rentnerberg“, „Alterslast“, „Greisen-Republik“, „Methusalem-Komplott“, „Der letzte Deutsche“, die „neuen Alten“ oder „Raum ohne Volk“. Diese Debattenbeiträge bieten manchmal interessante Einsichten, sind aber meist recht oberflächlich verfasst. In dieser Arbeit sollen gesicherte Fakten sprechen. Abzuklären ist, was demographischer Wandel bedeutet. Dazu zunächst ein Beispiel einer Umfrage unter jungen Erwachsenen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beauftragte im Jahr 2006 die TNS Emnid, eine Medien- und Sozialforschungs- GmbH, mit einer Umfrage zum Thema demographischer Wandel. 1000 Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren wurden telefonisch mittels CATI–Technik befragt. Die Interviews dauerten durchschnittlich 27 Minuten und fanden im Zeitraum vom 11.12.2006 bis 22.12.2006 statt. Das Ziel dieser Umfrage war es, den Kenntnisstand der jungen Erwachsenen über den demographischen Wandel zu erfragen. Es wurde die Frage gestellt, ob man schon einmal etwas über den Begriff des „demographischen Wandels“ gehört oder gelesen hat. Bemerkenswert war, dass 54 Prozent der jungen Erwachsenen den Begriff „Demographischer Wandel“ nicht kannten. „…nur jeder Fünfte …(wusste) um den Inhalt dieses Fachbegriffs. Einem Drittel der jungen Erwachsenen …(war) ferner nicht bekannt, dass sich Deutschland in einem Prozess des demographischen Wandels befindet“. Wer nicht weiß, was der demographische Wandel ist, kann auch nicht entsprechend vorsorgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der demographische Wandel in Deutschland
- 1.1 Einleitung und Definition des demographischen Wandels
- 1.1.1 Einleitung mit Umfrage
- 1.1.2 Definition des Begriffes „Demographie“ mit zwei Bevölkerungsvorausberechnungen
- 1.1.3 Entwicklung der Geburten
- 1.1.4 Ergebnis
- 1.2 Die Herausbildung des Dritten Alters
- 1.3 Bezug zur gesetzlichen Rentenversicherung
- 1.3.1 Die Alterssicherungssysteme
- 1.3.2 Der Nachhaltigkeitsfaktor und der Altenquotient
- 1.3.3 Die Problemstellung für die gesetzliche Rentenversicherung
- 2. Mein eigener Arbeitsbereich
- 2.1 Auskunft und Beratung der Kunden
- 2.2 Ziele und Inhalte meiner Dozententätigkeiten als Altersvorsorgeberater
- 3. Das „Defizitmodell“ des Alters oder das Altersbild der Gesellschaft¹
- 3.1 Der Mythos der Krankheit im Alter
- 3.2 Das Problem Alter
- 3.2.1 Der Lebensbogen
- 3.2.2 Ageism
- 3.2.3 Die Sichtweise der Bevölkerung
- 3.2.4 Die Realität
- 3.3 Teilzeitarbeiten im Alter
- 3.4 Alternsgerechtes Arbeiten
- 3.4.1 Die Einstellung der Gesellschaft und der Arbeitgeber gegenüber den älteren Arbeitnehmern
- 3.4.2 Das Erfahrungspotential
- 3.4.3 Die alternsgerechten Tätigkeiten
- 4. Die Probleme der Alterung der deutschen Gesellschaft u.a. auch für die gesetzliche Rentenversicherung
- 4.1 Die Disengagement-Theorie versus aufgeschobener Rentenbeginn aufgrund der Verlängerung des Dritten Alters
- 4.1.1 Einleitung
- 4.1.2 Der Gegenpol der positiven Einstellung zum Alter
- 4.1.3 Der aufgeschobene Rentenbeginn und die Einsicht der Betroffenen
- 4.1.4 Disengagement-Theorie versus Activity-Theorie
- 4.1.5 Die zwanghafte Altersgrenze als ein weiterer Punkt von Ageism
- 4.2 Bezahlbarkeit der zusätzlichen Altersvorsorge
- 5. Eigener Lösungsansatz und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den demografischen Wandel in Deutschland, den Mythos des Alterns und dessen Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung. Sie beleuchtet den eigenen Arbeitsbereich des Autors im Kontext der Altersvorsorgeberatung und analysiert gesellschaftliche Altersbilder.
- Der demografische Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen
- Das gesellschaftliche Altersbild und der Mythos von Krankheit und Unfähigkeit im Alter
- Die Herausforderungen für die gesetzliche Rentenversicherung
- Alternsgerechtes Arbeiten und die Rolle älterer Arbeitnehmer
- Mögliche Lösungsansätze für die zukünftigen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der demographische Wandel in Deutschland: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in den demografischen Wandel Deutschlands, definiert den Begriff der Demographie und analysiert die Entwicklung der Geburtenraten. Es untersucht die Herausbildung des "Dritten Alters" und dessen Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung, indem es die Alterssicherungssysteme, den Nachhaltigkeitsfaktor und den Altenquotienten beleuchtet. Die Problemstellung für die gesetzliche Rentenversicherung wird hier als zentrale Herausforderung identifiziert, die durch die demografische Entwicklung verstärkt wird. Die Einbindung von Umfragedaten zur Alterswahrnehmung liefert wichtige empirische Evidenz.
2. Mein eigener Arbeitsbereich: Dieses Kapitel beschreibt den Arbeitsbereich des Autors im Bereich der Auskunft und Beratung von Kunden zu Fragen der Altersvorsorge. Es werden die Ziele und Inhalte der Dozententätigkeit als Altersvorsorgeberater detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von Wissen im Bereich der Altersvorsorge und der direkten Interaktion mit Betroffenen.
3. Das „Defizitmodell“ des Alters oder das Altersbild der Gesellschaft¹: Dieses Kapitel analysiert kritisch das gesellschaftliche Bild vom Alter, das oft von einem „Defizitmodell“ geprägt ist, welches Krankheit und Unfähigkeit als selbstverständlich im Alter ansieht. Es untersucht den Mythos der Krankheit im Alter und beleuchtet das Phänomen des Ageismus. Es werden verschiedene Perspektiven – die Lebensbogen-Perspektive, die Sichtweise der Bevölkerung und die Realität – gegenübergestellt. Darüber hinaus werden Teilzeitarbeit und alternsgerechtes Arbeiten als wichtige Aspekte der Integration älterer Menschen in den Arbeitsmarkt diskutiert, wobei die Einstellungen der Gesellschaft und der Arbeitgeber eine zentrale Rolle spielen.
4. Die Probleme der Alterung der deutschen Gesellschaft u.a. auch für die gesetzliche Rentenversicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, die sich aus der Alterung der deutschen Gesellschaft für die gesetzliche Rentenversicherung ergeben. Es vergleicht die Disengagement-Theorie mit der Aktivität im Alter und dem aufgeschobenen Rentenbeginn. Die Bezahlbarkeit zusätzlicher Altersvorsorge wird als weitere zentrale Problematik hervorgehoben. Der Einfluss des Ageismus auf die Altersvorsorgepolitik wird kritisch beleuchtet, unter anderem anhand des Beispiels der zwanghaften Altersgrenze.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, Alter, Rentenversicherung, Altersvorsorge, Ageism, Disengagement-Theorie, Activity-Theorie, Altersbild, Alternsgerechtes Arbeiten, Nachhaltigkeit, Altenquotient.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Demografischer Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen auf die Altersvorsorge
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert den demografischen Wandel in Deutschland und dessen Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung. Es untersucht das gesellschaftliche Altersbild, den Mythos der Krankheit im Alter (Ageism) und beleuchtet Möglichkeiten alternsgerechten Arbeitens. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Erfahrung des Autors als Altersvorsorgeberater.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Der demografische Wandel in Deutschland; 2. Mein eigener Arbeitsbereich (Altersvorsorgeberatung); 3. Das „Defizitmodell“ des Alters oder das Altersbild der Gesellschaft; 4. Die Probleme der Alterung der deutschen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung; 5. Eigener Lösungsansatz und Resümee.
Wie wird der demografische Wandel in Deutschland dargestellt?
Kapitel 1 definiert den demografischen Wandel und analysiert die Entwicklung der Geburtenraten. Es untersucht die Herausbildung des „Dritten Alters“ und dessen Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere den Nachhaltigkeitsfaktor und den Altenquotienten. Umfragedaten zur Alterswahrnehmung werden zur empirischen Untermauerung verwendet.
Welchen Arbeitsbereich beschreibt der Autor?
Kapitel 2 beschreibt den Arbeitsbereich des Autors in der Auskunft und Beratung von Kunden zu Fragen der Altersvorsorge und detailliert seine Tätigkeit als Dozent im Bereich Altersvorsorgeberatung.
Wie wird das gesellschaftliche Altersbild beschrieben?
Kapitel 3 analysiert kritisch das oft negative „Defizitmodell“ des Alters, das Krankheit und Unfähigkeit als selbstverständlich im Alter darstellt. Es untersucht den Mythos der Krankheit im Alter (Ageism), die Lebensbogen-Perspektive, die Sichtweise der Bevölkerung und die Realität. Teilzeitarbeit und alternsgerechtes Arbeiten werden als wichtige Aspekte der Integration älterer Menschen in den Arbeitsmarkt diskutiert.
Welche Probleme werden im Zusammenhang mit der Alterung der Gesellschaft und der Rentenversicherung genannt?
Kapitel 4 befasst sich mit den Herausforderungen der Alterung der deutschen Gesellschaft für die gesetzliche Rentenversicherung. Es vergleicht die Disengagement-Theorie mit der Aktivität im Alter und dem aufgeschobenen Rentenbeginn und beleuchtet die Bezahlbarkeit zusätzlicher Altersvorsorge. Der Einfluss des Ageismus auf die Altersvorsorgepolitik wird kritisch beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Demografischer Wandel, Alter, Rentenversicherung, Altersvorsorge, Ageism, Disengagement-Theorie, Activity-Theorie, Altersbild, Alternsgerechtes Arbeiten, Nachhaltigkeit, Altenquotient.
Welche Lösungsansätze werden im Dokument vorgeschlagen?
Das Dokument enthält im 5. Kapitel einen eigenen Lösungsansatz des Autors, der aber im Detail in dieser FAQ nicht ausgeführt ist. Um detaillierte Lösungsansätze zu erfahren, muss das vollständige Dokument eingesehen werden.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit dem demografischen Wandel, der Altersvorsorge, der Rentenversicherung und dem gesellschaftlichen Altersbild auseinandersetzen, insbesondere für Wissenschaftler, Studenten, Altersvorsorgeberater und politische Entscheidungsträger.
- Quote paper
- Master of Public Administration Harald Seitz (Author), 2010, Der demographische Wandel, der Mythos Alter und der Bezug zur gesetzlichen Rentenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190931