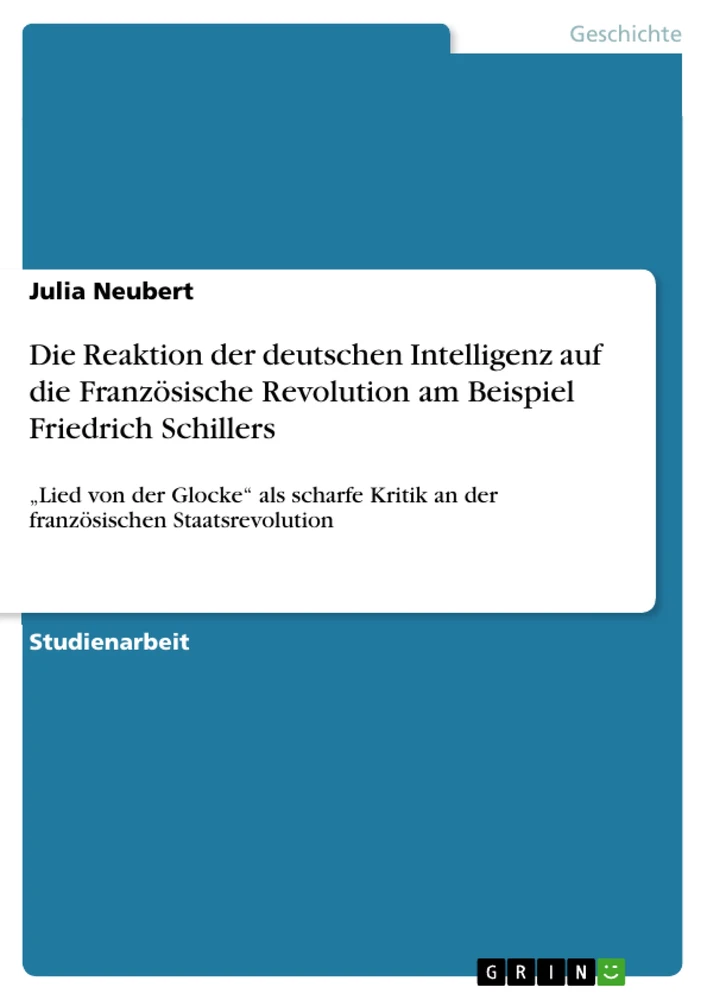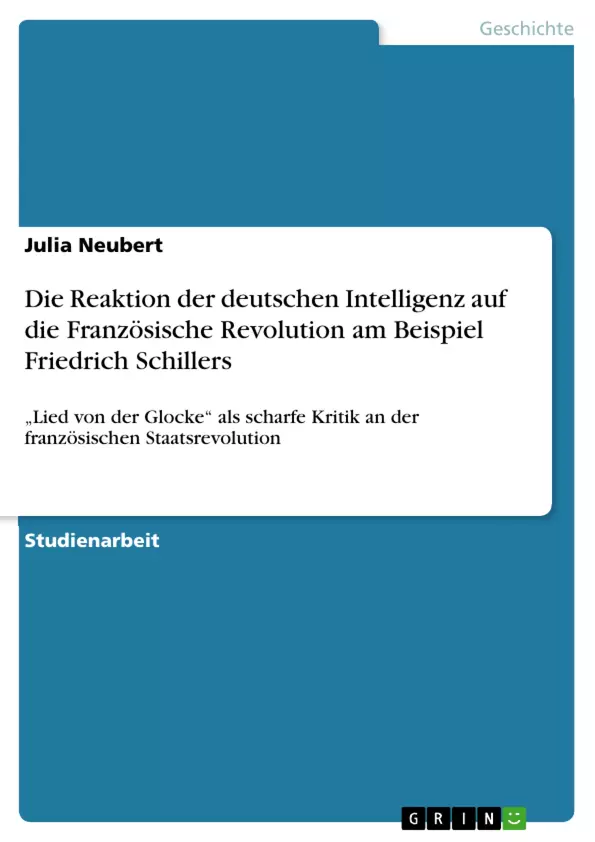1. Einleitung
Die Französische Revolution war Wegbereiter eines modernen Menschen-, Gesellschafts- und Politikbildes. Dieser 1789 begonnene Umwälzungsprozess, der sich über zehn Jahre bis 1799 hinzog, verbreitete noch einmal mehr die Motive der Aufklärung und ihrer berühmten Vertreter wie Rousseau, Mon-tesquieu und Voltaire. Da Frankreichs absolutistische Staatsform und die da-zugehörige gesellschaftliche Ordnung im Europa des späten 18. Jahrhunderts weit verbreitet war, hatten die Ideen der Aufklärung und deren beginnende Umsetzung für Europa Modellcharakter. Eine bis dato vermeintlich nicht um-setzbare Veränderung der seit Jahrhunderten herrschenden Vorstellung vom Monarchen als Alleinherrscher, vollzog sich in wenigen Monaten im Nachbar-land Frankreich.
Eine Reaktion des Gelehrtenkreises innerhalb Europas ließ folglich nicht lange auf sich warten. Die Pariser Ereignisse wurden durch Journale, Briefe oder sogar durch einen persönlichen Besuch vor Ort verfolgt: Das Interesse war enorm. Auch die deutschen Intellektuellen tauschten sich aus und positionier-ten sich. Über die lange Dauer der Revolution veränderte sich jedoch der an-fängliche Enthusiasmus vieler Befürworter/Gelehrter. Die Reaktionen reichten später von Skepsis und Kritik über Ablehnung und strikte Verurteilung dieser brutalen Umsetzung des Volkswillens v.a. unter der Jakobiner Herrschaft.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Schillers „Lied von der Glocke“. In diesem Gedicht sucht er den Pariser Ereignissen lyrisch beizukommen, wobei dem historisch interessierten Leser die eindeutige Kritik an der Französischen Re-volution nicht entgehen dürfte. Daher sucht diese Arbeit Schillers Weg in die-se scheinbare Ablehnung der Revolution in Zügen darzustellen und zu erklä-ren. Von besonderem Interesse für diese Arbeit soll dabei der Schlussteil des Gedichtes sein (Vers 299 bis 424), weil sich Schillers Kritik an der Französi-schen Revolution ab diesen Versen am deutlichsten erkennen lässt.
5. Fazit
Sowohl Schillers privaten Äußerungen - z.B. Briefen an seine Freunde und Kollegen - als auch seinen öffentlichen Aktivitäten wie die Verteidigungsrede für Ludwig XVI. ist politisches Engagement zu entnehmen, welches ein Selbstverständnis seiner Zeit widerspiegelt. Der gebildete, ebenso wie der un-gebildete Mensch, will ins aktuelle Geschehen eingreifen, mehr noch: Er will die Welt nach seinem Bilde formen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Französische Revolution und ihre Bedeutung
- Die Phasen der Französischen Revolution
- Die Reaktionen auf die Französische Revolution
- Schiller - Aufgeklärter Geist und Skeptiker der Französischen Revolution
- ,,Das Lied von der Glocke“ - Vielmehr ein historischer Kommentar als ein Gedicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Schillers „Lied von der Glocke“ im Kontext der Französischen Revolution und untersucht, wie Schiller die Pariser Ereignisse lyrisch verarbeitet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Kritik Schillers an der Revolution, die im Schlussteil des Gedichts (Vers 299 bis 424) deutlich wird. Die Arbeit soll Schillers Weg in diese scheinbare Ablehnung der Revolution beleuchten und erklären.
- Schillers Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution
- Schillers Vorstellung von Freiheit und Bildung im Kontext der Aufklärung
- Schillers Kritik an der Jakobinerherrschaft und der „Grande Terreur“
- Die Rolle des „Liedes von der Glocke“ als historischer Kommentar
- Schillers Vorstellung von staatlicher und gesellschaftlicher Umorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Französische Revolution als Wegbereiter eines modernen Menschen-, Gesellschafts- und Politikbildes vor und beleuchtet die Reaktionen deutscher Intellektueller auf die revolutionären Ereignisse.
Das Kapitel „Die Französische Revolution und ihre Bedeutung“ beschreibt die verschiedenen Phasen der Revolution und verdeutlicht die tiefgreifenden Veränderungen, die sie für die Staats- und Gesellschaftsform bedeuteten.
Das Kapitel „Schiller - Aufgeklärter Geist und Skeptiker der Französischen Revolution“ analysiert Schillers anfängliche Sympathien für die Revolution, die jedoch mit der zunehmenden Gewalt der Jakobinerherrschaft in Skepsis umschwenkten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Französische Revolution, Aufklärung, Schiller, „Lied von der Glocke“, Jakobinerherrschaft, Freiheit, Bildung, Kritik, historischer Kommentar.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte Friedrich Schiller auf die Französische Revolution?
Schiller war anfangs interessiert, entwickelte jedoch aufgrund der Gewalt der Jakobinerherrschaft eine kritische und ablehnende Haltung.
Welche Rolle spielt „Das Lied von der Glocke“ in diesem Kontext?
In dem Gedicht verarbeitet Schiller die Ereignisse lyrisch und übt insbesondere im Schlussteil deutliche Kritik an der revolutionären Gewalt.
Was war Schillers Ideal von Freiheit?
Für Schiller war wahre Freiheit untrennbar mit Bildung und moralischer Veredelung verbunden, nicht mit bloßem gewaltsamem Umsturz.
Wie sahen andere deutsche Intellektuelle die Revolution?
Die Reaktionen reichten von anfänglichem Enthusiasmus bis hin zu tiefer Skepsis und strikter Verurteilung der „Grande Terreur“.
Warum wird „Das Lied von der Glocke“ als historischer Kommentar gesehen?
Weil es die gesellschaftliche Ordnung beschreibt und die Gefahren einer unkontrollierten Volksherrschaft metaphorisch darstellt.
- Quote paper
- Julia Neubert (Author), 2011, Die Reaktion der deutschen Intelligenz auf die Französische Revolution am Beispiel Friedrich Schillers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190951