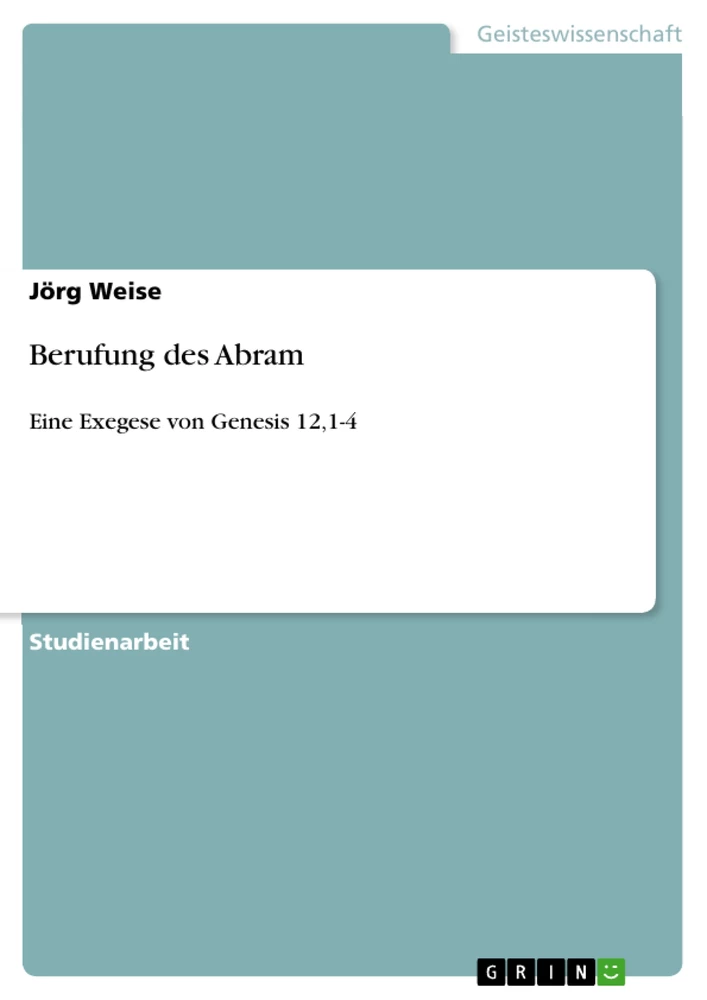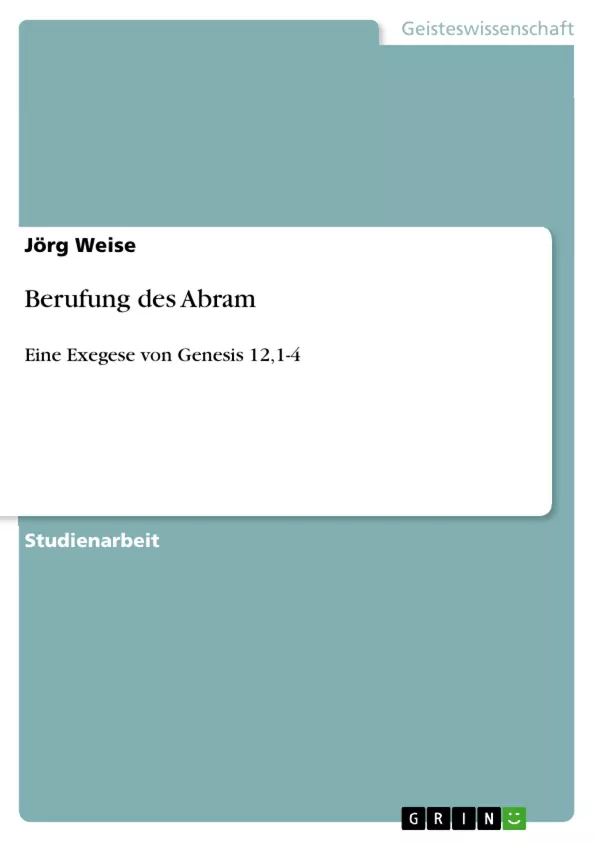Die Berufunng des Abram ist der Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Schöpfung ist zerstört, die Menschen lehnen sich wieder und wieder gegen Gott auf. Denken wir doch nur an Kain und Abel, Noah oder den Turmbau zu Babel. Wie soll es da jetzt noch weitergehen? Wieder eine Sintflut? Dazu hatte Gott - Nein - gesagt. Der Krimi mit Gottes Volk beginnt mit der Einberufung Abrams.
Diese Exegese wirft eine detailierte, wissenschaftliche Betrachtung auf diesen Berufungstext und schlussfolgert erste Erwähnungen für eine heutige Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbesinnung des Textes
- Übersetzungsvergleich
- Abgrenzung und Kontext des Textes
- Abgrenzung des Textes
- Kontext des Textes
- Gliederung des Textabschnittes
- Literarkritik
- Formkritik und Sitz im Leben
- Mündliche Überlieferungsgeschichte
- Redaktionsgeschichte
- Traditionsgeschichte
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Einzelexegese
- Skopus
- Verkündigungsansatz für heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert den Bibeltext Genesis 12, 1-4a und untersucht ihn unter verschiedenen exegetischen Gesichtspunkten. Der Text fokussiert auf die Geschichte von Abram und Gottes Verheißung an ihn.
- Gottes Verheißung an Abram und die Bedeutung des Abrufs aus der Heimat
- Die Rolle von Segen und Fluch in Gottes Plan
- Die Interpretation und Bedeutung des Gottesnamens "Jahwe"
- Die Herausforderungen und Chancen des Vertrauens auf Gott
- Die literarische Struktur und die Redaktionsgeschichte des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorbesinnung des Textes: Diese Einleitung erforscht die persönlichen Eindrücke und Reflektionen, die der Text beim Leser hervorruft, insbesondere hinsichtlich des Themas Heimatverlust und Vertrauen in Gott.
- Übersetzungsvergleich: Dieser Abschnitt vergleicht verschiedene Bibelübersetzungen des Textes und analysiert Unterschiede in der Sprache und der Interpretation des Gottesnamens.
- Abgrenzung und Kontext des Textes: Dieser Abschnitt beleuchtet die literarische Einordnung des Textes in der Genesis und identifiziert die unterschiedlichen Verfasser der umliegenden Texte.
- Gliederung des Textabschnittes: Dieser Abschnitt bietet eine strukturelle Analyse des Bibeltextes, um die einzelnen Teile und ihre Beziehung zueinander zu verstehen.
- Literarkritik: Diese Analyse betrachtet die literarische Form des Textes und untersucht verschiedene Ansätze zur Interpretation.
- Formkritik und Sitz im Leben: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, wie der Text ursprünglich in der mündlichen Überlieferung funktioniert hat und in welchem kulturellen Kontext er entstanden ist.
- Mündliche Überlieferungsgeschichte: Dieser Abschnitt betrachtet die mündliche Tradition, die dem Text zugrunde liegt und untersucht die Entwicklung des Textes im Laufe der Zeit.
- Redaktionsgeschichte: Dieser Abschnitt analysiert die verschiedenen redaktionellen Bearbeitungen, die der Text erfahren hat.
- Traditionsgeschichte: Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklung des Textes in der Geschichte der christlichen Tradition und seine Interpretation in verschiedenen Epochen.
- Religionsgeschichtlicher Vergleich: Dieser Abschnitt vergleicht den Text mit anderen religiösen Traditionen und analysiert Parallelen und Unterschiede.
- Einzelexegese: Dieser Abschnitt untersucht den Text detailliert auf Wortebene, um die Bedeutung der einzelnen Verse zu entschlüsseln.
- Skopus: Dieser Abschnitt untersucht den Zweck und die Botschaft des Textes als Ganzes.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die Verheißung Gottes, die Bedeutung des Abrufs aus der Heimat, die Rolle von Segen und Fluch, die Interpretation des Gottesnamens "Jahwe" und die Herausforderungen des Glaubens. Die Exegese des Textes konzentriert sich auf die literarische Struktur, die Redaktionsgeschichte und die mündliche Tradition.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Berufung Abrams in Genesis 12?
Es markiert den Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk nach der Zerstörung der Schöpfungsordnung durch den Sündenfall und den Turmbau zu Babel.
Welche Bedeutung hat der Heimatverlust für Abram?
Gott fordert Abram auf, sein Land und seine Verwandtschaft zu verlassen, was ein radikales Vertrauen in die göttliche Verheißung voraussetzt.
Welche Rolle spielen Segen und Fluch in diesem Text?
Gott verspricht Abram, ihn zum Segen für alle Geschlechter der Erde zu machen, wobei der Segen als zentrales Motiv des göttlichen Plans fungiert.
Wie wird der Gottesname „Jahwe“ in der Exegese interpretiert?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Übersetzungen und analysiert die theologische Bedeutung des Namens im Kontext der Berufungsgeschichte.
Was ist der „Skopus“ dieser biblischen Erzählung?
Der Skopus bezeichnet die Hauptabsicht des Textes: die Darstellung von Gottes Initiative zur Rettung der Menschheit durch die Erwählung eines Einzelnen.
- Quote paper
- Jörg Weise (Author), 2007, Berufung des Abram, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190956