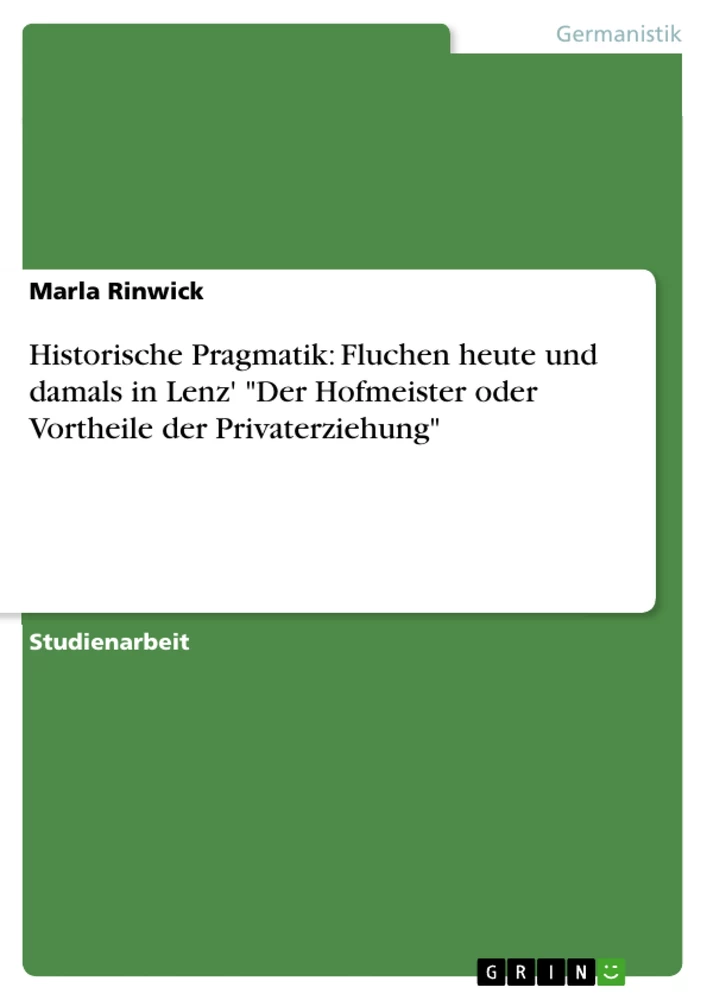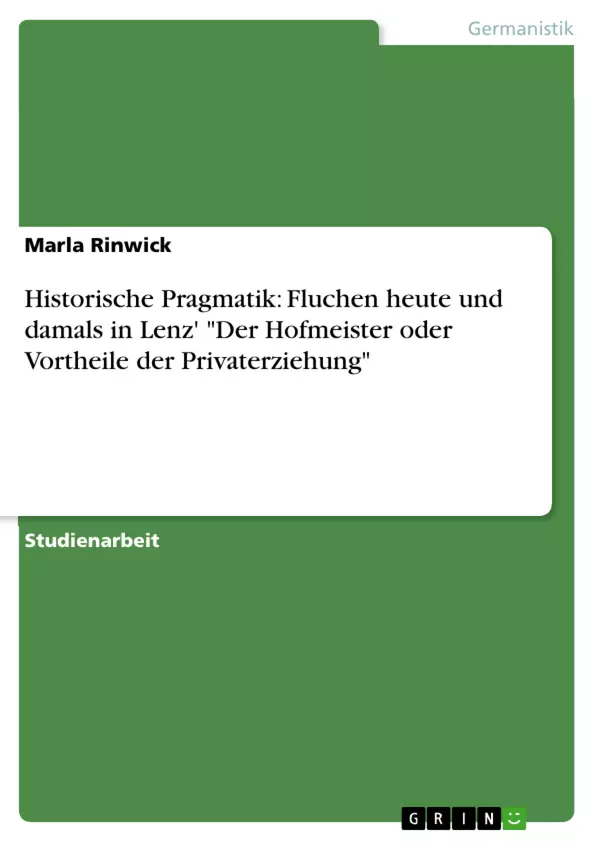"Fluchen tut gut" übertitelt Sebastian Herrmann (2005) seinen Artikel im Spiegel Online und berichtet darin von einem Gesetz in den USA, welches öffentliches Fluchen seit 1897 unter Strafe stellt. Allerdings, sagt Herrmann (2005), sei Fluchen ein „menschlicher Urtrieb[, der nicht zu unterdrücken ist, da] in der neuronalen Struktur des Hirns verankert“ (Herrmann 2005: 1).
Laut Nübling/Vogel (2004) werden die Termini 'fluchen' und 'schimpfen' im heutigen Sprachgebrauch ähnlich verwendet. Sie untermauern diese Behauptung mit den Einträgen aus dem Duden-Bedeutungswörterbuch 2002, in dem unter 'fluchen' (‚mit heftigen und derben Ausdrücken schimpfen‘) auf 'schimpfen' verwiesen und unter 'schimpfen' (‚seinem Unwillen in heftigen Worten Ausdruck geben‘) als Synonym 'fluchen' genannt wird. (vgl. Nübling/Vogel 2004: 19 f.)
Unter dem Oberbegriff fluchen lässt sich wiederum zwischen Blasphemie und profaner Sprache unterscheiden. [...]
Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich das Phänomen fluchen aus pragmatischer Sicht beschreiben. Dazu erkläre ich die Geschichte des Begriffes und seinen Bedeutungswandel näher. Danach widme ich mich den Euphemismen, welche unabdingbar für ein harmonisches Miteinander in jeder Gesellschaft sind. Im Laufe der Zeit erfahren die meisten Tabuworte eine Abschwächung und Desemantisierung, welche ich im darauf folgenden Absatz erläutern werde. Weiterhin grenze ich den Sprechakt „Fluch“ von den beiden ähnlichen aggressiven Sprechakten „Beschimpfung“ und „Verwünschung“ ab, um danach Flüche als Wortart einzuordnen. Die Begriffe „Verwünschung“ und „Verfluchung“ werde ich in dieser Arbeit synonym benutzen. Außerdem möchte ich darlegen, warum und in welchen Situationen wir fluchen.
Interessant ist auch die Tatsache, dass jede Kultur eine bestimmte semantische Fluchwortquelle hat, aus welcher der Großteil ihrer Fluchworte kommt. Dies werde ich im zweiten Teil dieser Arbeit genauer erklären, um im Anschluss daran den skatologischen Bereich im deutschsprachigen Raum sowie die Hauptfluchwortquelle sexueller Körperfunktionen im angelsächsischen Sprachraum vorzustellen.
Im dritten Teil dieser Arbeit werde ich die gewonnenen Erkenntnisse auf das Werk "Der Hofmeister oder Vortheile der Privaterziehung" von J.M.R. Lenz anwenden. Ich möchte aufzeigen, inwieweit sich unsere heutigen Fluchgewohnheiten von jenen vor knapp 240 Jahren unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fluchworte aus pragmatischer Sicht
- Bedeutungswandel des Begriffs fluchen
- Sprachtabus und wie man sie umgehen kann
- Abschwächung und Desemantisierung von Fluchworten
- Der Sprechakt „Fluch“
- Die Wortart der Flüche: Interjektionen
- Warum und in welchen Situationen fluchen wir?
- Andere Kulturen, andere Fluchwortbereiche
- Der skatologische Fluchwortbereich im deutschsprachigen Raum
- Sexuelle Körperfunktionen als Fluchwortquelle im angelsächsischen Raum
- Die Verwendung von Fluchworten in J.M.R. Lenz' Der Hofmeister oder Vortheile der Privaterziehung
- Wer flucht wie, wann und wo? – kontextabhängiges Fluchen im Hofmeister
- Die Vermeidung von Sprachtabus im Hofmeister
- Aggressive Sprechakte im Hofmeister
- Flüche als Interjektionen im Hofmeister
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Fluchens aus historischer und pragmatischer Perspektive, mit besonderem Fokus auf die Entwicklung des Fluchens und seiner Verwendung in J.M.R. Lenz' "Der Hofmeister".
- Der Bedeutungswandel des Fluchens im Laufe der Zeit.
- Die Rolle von Sprachtabus und Euphemismen.
- Kulturelle Unterschiede in der Verwendung von Fluchworten.
- Der Sprechakt "Fluch" und seine pragmatischen Funktionen.
- Die Verwendung von Fluchworten in J.M.R. Lenz' "Der Hofmeister".
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den gesellschaftlichen Umgang mit Fluchen, unter Bezugnahme auf aktuelle und historische Beispiele. Sie skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der das Fluchen aus pragmalinguistischer Sicht beleuchtet und einen Vergleich zwischen dem heutigen Sprachgebrauch und der Verwendung von Fluchworten in J.M.R. Lenz' "Der Hofmeister" anstrebt. Die Einleitung umreißt die einzelnen Kapitel und deren thematischen Fokus.
Fluchworte aus pragmatischer Sicht: Dieses Kapitel analysiert den Begriff "Fluchen" aus pragmatischer Sicht. Es beleuchtet den historischen Bedeutungswandel des Begriffs, von der magischen Verwünschung bis hin zur heutigen expressiven Verwendung. Der Umgang mit Sprachtabus und die Verwendung von Euphemismen werden ebenso untersucht wie die Abschwächung und Desemantisierung von Fluchworten im Laufe der Zeit. Das Kapitel beschreibt den Sprechakt "Fluch" und ordnet Flüche als Wortart ein, bevor es abschließend die Situationen und Gründe für das Fluchen beleuchtet.
Andere Kulturen, andere Fluchwortbereiche: Dieses Kapitel vergleicht den Umgang mit Fluchworten in verschiedenen Kulturen. Es konzentriert sich auf den skatologischen Fluchwortbereich im deutschsprachigen Raum und die Bedeutung sexueller Körperfunktionen als Fluchwortquelle im angelsächsischen Raum. Der Vergleich verdeutlicht die kulturelle Bedingtheit des Fluchens und dessen semantische Variationen.
Die Verwendung von Fluchworten in J.M.R. Lenz' Der Hofmeister oder Vortheile der Privaterziehung: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Fluchworten in J.M.R. Lenz' Werk "Der Hofmeister". Es untersucht, wer wann, wie und wo flucht und betrachtet die Vermeidung von Sprachtabus im Kontext des Stücks. Die Analyse umfasst aggressive Sprechakte und die Funktion von Flüchen als Interjektionen im Hofmeister, um einen Vergleich mit dem modernen Sprachgebrauch zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Fluchen, Pragmatik, Sprachtabus, Euphemismen, Bedeutungswandel, Interjektionen, Kulturvergleich, J.M.R. Lenz, Der Hofmeister, Blasphemie, Profane Sprache, Sprechakte.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Hofmeister" und dem Fluchen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Fluchens aus historischer und pragmatischer Perspektive. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung des Fluchens und seiner Verwendung im Werk J.M.R. Lenz' "Der Hofmeister".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Bedeutungswandel des Fluchens im Laufe der Zeit, die Rolle von Sprachtabus und Euphemismen, kulturelle Unterschiede in der Verwendung von Fluchworten, den Sprechakt "Fluch" und seine pragmatischen Funktionen sowie die konkrete Verwendung von Fluchworten in J.M.R. Lenz' "Der Hofmeister".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Fluchworte aus pragmatischer Sicht, ein Kapitel zum kulturellen Vergleich des Umgangs mit Fluchwörtern, ein Kapitel zur Analyse der Fluchwortverwendung in "Der Hofmeister" und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte des Themas, wie den Bedeutungswandel, Sprachtabus, Euphemismen, Sprechakte und kulturelle Unterschiede.
Wie wird das Fluchen in der Arbeit analysiert?
Das Fluchen wird aus pragmalinguistischer Sicht analysiert. Die Arbeit untersucht den historischen Bedeutungswandel, den Umgang mit Sprachtabus, die Verwendung von Euphemismen und die Abschwächung von Fluchworten. Der Sprechakt "Fluch" wird beschrieben und seine Funktion in verschiedenen Kontexten beleuchtet.
Welche Rolle spielt "Der Hofmeister" in der Arbeit?
In "Der Hofmeister" wird untersucht, wer, wann, wie und wo flucht. Die Analyse umfasst die Vermeidung von Sprachtabus, aggressive Sprechakte und die Funktion von Flüchen als Interjektionen. Ein Vergleich mit dem modernen Sprachgebrauch wird angestrebt.
Welche Kulturen werden im Vergleich betrachtet?
Die Arbeit vergleicht den Umgang mit Fluchworten im deutschsprachigen Raum (fokussiert auf den skatologischen Bereich) und im angelsächsischen Raum (fokussiert auf sexuelle Körperfunktionen als Fluchwortquelle).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fluchen, Pragmatik, Sprachtabus, Euphemismen, Bedeutungswandel, Interjektionen, Kulturvergleich, J.M.R. Lenz, Der Hofmeister, Blasphemie, Profane Sprache, Sprechakte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen des Fluchens aus historischer und pragmatischer Perspektive, mit besonderem Fokus auf die Entwicklung des Fluchens und seiner Verwendung in J.M.R. Lenz' "Der Hofmeister".
- Arbeit zitieren
- Marla Rinwick (Autor:in), 2011, Historische Pragmatik: Fluchen heute und damals in Lenz' "Der Hofmeister oder Vortheile der Privaterziehung", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190980