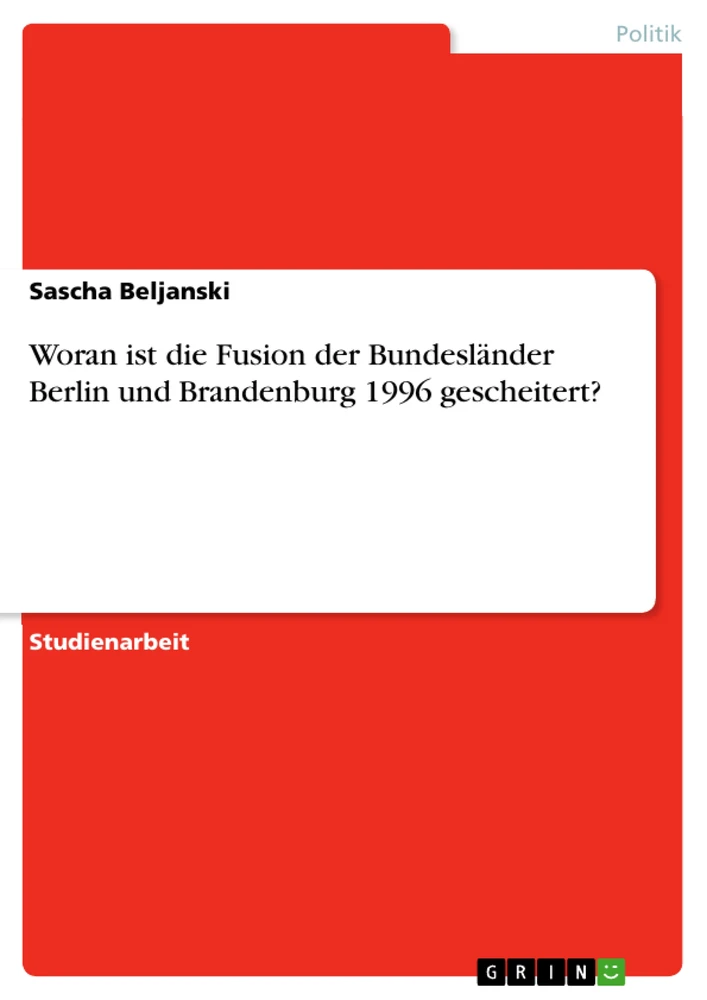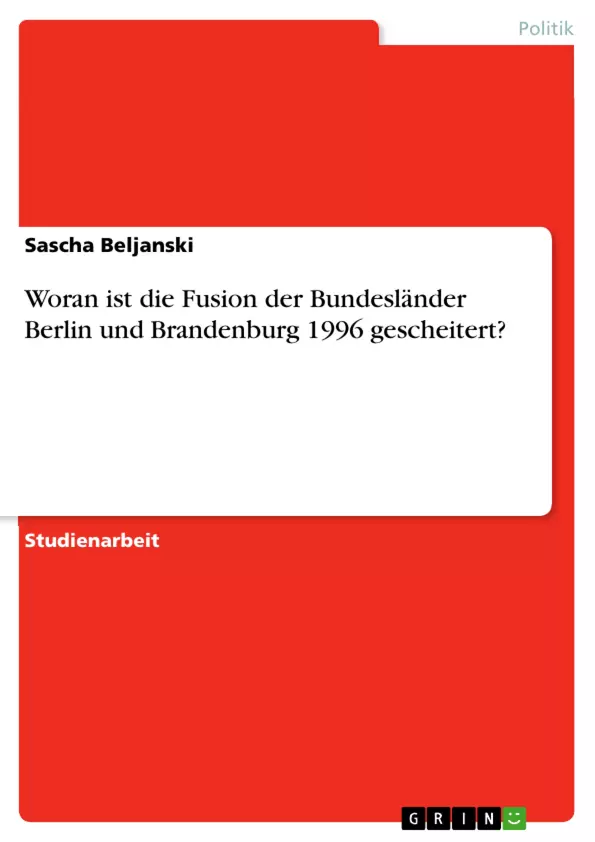Deutschland steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor einigen ungelösten strukturellen Problemen und „Reformbaustellen“ im globalen Wettstreit der Märkte. Moderne Staatsstrukturen mit klarer Kompetenzaufteilung und kurzen Entscheidungswegen können gegebenenfalls entscheidende Standortfaktoren für Investitionen sein. Die Vereinigung Deutschlands machte 1990 föderale Strukturen erforderlich. Eine grundlegende Neugliederung des Staatsgebiets hätte sich damals angeboten, wurde jedoch nach kurzer Diskussion ad acta gelegt. Angesichts des Handlungsdrucks in Ostdeutschland und der wirtschaftlichen Entwicklung einigte man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Die fünf neuen Länder (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) entstanden in den Grenzen der 1952 von der DDR aufgelösten ostdeutschen Länder. Ein gemeinsames Land Berlin-Brandenburg konnte nicht konstituiert werden, da Berlin zu diesem Zeitpunkt noch unter alliierten Vier-Mächte-Status stand. Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, woran die mögliche Neugliederung und Schaffung eines leistungsfähigen und modernen Bundeslandes Berlin-Brandenburg im Jahre 1996 gescheitert ist?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Rückblick
- Ausgangslage der beiden Länder nach 1990
- Das (wieder)-vereinigte Berlin
- Brandenburg ein lebensfähiges Bundesland?
- Pro- und Contra-Argumente einer Länderfusion
- Die Schaffung eines lebensfähigen Landes
- Ein gerechter Finanzausgleich
- Die Schaffung einer modernen Verwaltung
- Zweifel an den ökonomischen Vorteilen einer Fusion
- Die fehlende Identität eines Landes Berlin-Brandenburg
- Die wechselseitige Befürchtung einer Dominanz des Partners
- Ergebnisse der Volksabstimmung zur Länderfusion
- Der Neugliederungsvertrag
- Die Ergebnisse der Volksabstimmung in Berlin
- Die Ergebnisse der Volksabstimmung in Brandenburg
- Die Ursachen des Scheiterns der Länderfusion Berlin/Brandenburg
- Verfassungsrechtliche Fragen einer Länderehe
- Finanzielle Folgen beim Länderfinanzausgleich
- Die Verwaltung
- Die unzureichende Aufklärung und Mobilisierung des Wählervolks
- Fehlende Kooperations- und Konsensbereitschaft der politischen Akteure
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die gescheiterte Fusion der Bundesländer Berlin und Brandenburg im Jahr 1996. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der beiden Länder nach der Wiedervereinigung und untersucht die Argumente für und gegen eine Fusion. Die Arbeit untersucht auch die Ergebnisse der Volksabstimmung zur Länderfusion, die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie die finanziellen und administrativen Aspekte einer möglichen Fusion.
- Historische Entwicklung von Berlin und Brandenburg nach der Wiedervereinigung
- Pro- und Contra-Argumente für eine Länderfusion
- Ergebnisse der Volksabstimmung zur Länderfusion
- Verfassungsrechtliche Aspekte einer Länderfusion
- Finanzielle und administrative Folgen einer möglichen Fusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Rückblick auf die historische Entwicklung der beiden Länder nach 1990. Sie beleuchtet die Ausgangslage in Berlin und Brandenburg sowie die Besonderheiten der beiden Länder nach der Wiedervereinigung. Das zweite Kapitel widmet sich den Pro- und Contra-Argumenten einer Länderfusion. Es werden die Argumente für die Schaffung eines lebensfähigen Landes, einen gerechten Finanzausgleich und eine moderne Verwaltung sowie die Zweifel an den ökonomischen Vorteilen einer Fusion, die fehlende Identität eines Landes Berlin-Brandenburg und die wechselseitige Befürchtung einer Dominanz des Partners diskutiert. Das dritte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Volksabstimmung zur Länderfusion, wobei der Neugliederungsvertrag beleuchtet und das unterschiedliche Wählerverhalten in Berlin und Brandenburg analysiert wird. Der vierte Teil untersucht die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Länderehe, die finanziellen Folgen beim Länderfinanzausgleich und die Verwaltung. Er beleuchtet zudem die unzureichende Aufklärung und Mobilisierung des Wählervolks sowie die fehlende Kooperations- und Konsensbereitschaft der politischen Akteure, um die Ursachen des Scheiterns der Länderfusion zu analysieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Länderfusion, Föderalismus, Berlin, Brandenburg, Wiedervereinigung, Volksabstimmung, verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen, Finanzausgleich, Verwaltung, politische Akteure, Kooperationsbereitschaft, Konsensfähigkeit, Desorganisation und mangelnde Aufklärung. Sie analysiert die Ursachen für das Scheitern der Länderfusion und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gestaltung der deutschen Föderalstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte die Fusion von Berlin und Brandenburg 1996?
Das Scheitern lag vor allem an der Ablehnung durch die brandenburgische Bevölkerung, finanziellen Ängsten und mangelnder politischer Konsensbereitschaft.
Wie fiel die Volksabstimmung 1996 aus?
In Berlin stimmte eine Mehrheit für die Fusion, während in Brandenburg die Mehrheit der Wähler den Neugliederungsvertrag ablehnte.
Welche Rolle spielte der Länderfinanzausgleich?
Es gab große Befürchtungen, dass ein gemeinsames Land finanziell schlechter gestellt sein könnte oder dass Brandenburg die Schulden Berlins mittragen müsste.
Gab es eine gemeinsame Identität für ein Bundesland Berlin-Brandenburg?
Nein, die fehlende gemeinsame Identität und die Sorge vor einer Dominanz Berlins waren wesentliche emotionale Hindernisse für die Fusion.
Warum wurde die Fusion direkt nach der Wende 1990 nicht vollzogen?
Berlin stand 1990 noch unter dem alliierten Viermächte-Status, was eine sofortige Konstituierung als gemeinsames Land mit Brandenburg erschwerte.
- Quote paper
- B.A. Sascha Beljanski (Author), 2005, Woran ist die Fusion der Bundesländer Berlin und Brandenburg 1996 gescheitert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190987