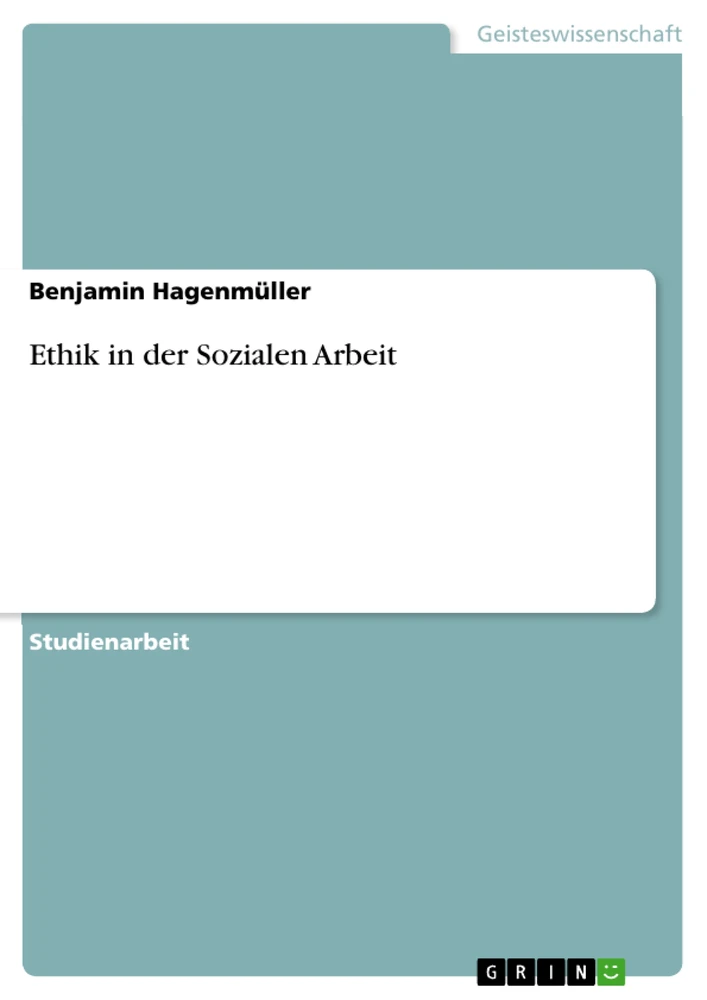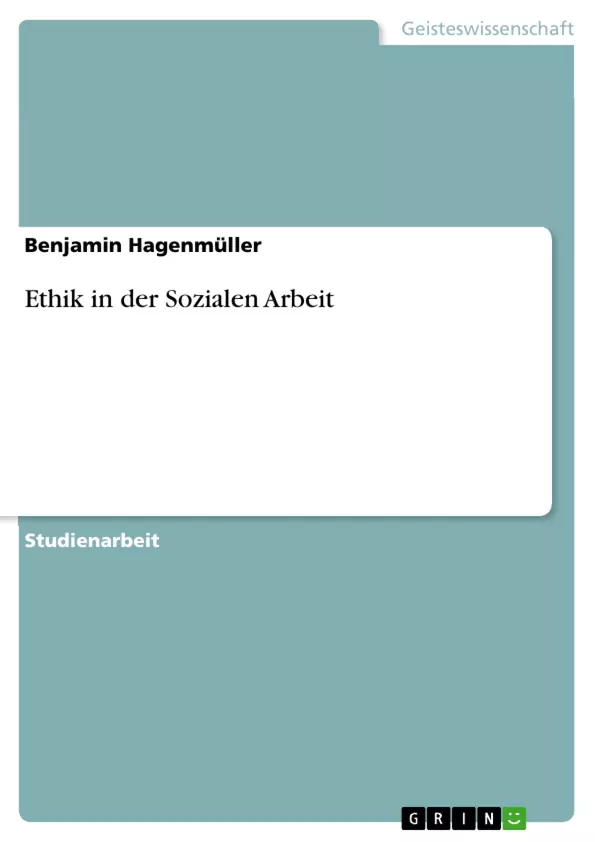Ich möchte meine Hausarbeit damit beginnen, zu erläutern, warum Ethik in der Sozialen Arbeit wichtig ist und welchen Bezug sie dazu hat.
Später werde ich auf die Moral und auf die Ethik an sich eingehen. Ich beschreibe die philosophischen Lehren der Stoa, von Thomas von Aquin und Jeremy Bentham. Diese
Lehren werden erst von mir beschrieben und im nächsten Kapitel auf das Fallbeispiel angewandt.
Zu Anfang möchte ich aber erst einmal erklären was Ethik bedeutet. Ethik kommt aus dem griechischen éthos und bedeutet gewohnter Ort des Lebens, Sitte, Charakter.
Die Ethik wird in drei Formen unterschieden. Die erste ist die Empirische Ethik. Diese lässt sich wiederum in die deskriptive und die explanatorische Ethik untergliedern. Die deskriptive Ethik ist eine beschreibende Ethik. Sie beschreibt Ethik in Hinsicht auf die Gruppe oder Institution, die Ethik anwendet. Die explanatorische Ethik erklärt die Ethik in Hinsicht auf die Herkunft und versucht diese zu verallgemeinern. Neben der Empirischen Ethik gibt es noch die Normative Ethik. Die Normative Ethik wird auch wieder in die evaluative und präskriptive Ethik untergliedert. Die evaluative Ethik beurteilt die vorherrschende Moral kritisch. Die präskriptive Ethik dagegen schreibt eine begründete Moral vor. Neben diesen zwei Ethikformen gibt es noch die Metaethik. Die Metaethik untersucht die sprachliche Form der Normativen Ethik auf sittliche Prädikate.
Nun möchte ich kurz auf die Verbindung zwischen Ethik und Philosophie eingehen. Philosophie kommt von dem griechischen Wort philosophia und bedeutet die Liebe zur Weisheit. Die Philosophie ist die allgemeine Wissenschaft des Wissens und des Handelns Hier wurden drei Eigenarten herausgearbeitet. Erstens, die Systematik. Die philosophische Ethik hat klar definierte Ziele. Sie möchte die Moral in allen Variationen kennenlernen und diese auch verstehen. Zweitens, die Argumentation. Die Ethik bedarf keiner Religion, sondern beruht auf Argumenten, die sorgfältig ausgearbeitet und dann vorgetragen werden. Und drittens, die Intersubjektivität. Die Ethik muss für alle Menschen gelten. Die ethischen Urteile müssen allgemeingültig für alle Menschen sein. Aus der Philosophie heraus resultiert die Ethik, denn die Ethik ist eine philosophische Disziplin.
Inhaltsverzeichnis
- Ethik in der Sozialen Arbeit
- Was ist Moral?
- Was bedeutet Ethik für die Soziale Arbeit
- Mein weiteres Vorgehen
- Mein Fall
- Dilemma
- Die Stoá
- Die Anwendung der Stoá auf das Fallbeispiel
- Thomas von Aquin
- Die Anwendung von Thomas von Aquin auf meinen Fall
- Jeremy Bentham
- Die Anwendung von Jeremy Bentham auf meinen Fall
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Ethik in der Sozialen Arbeit zu untersuchen und den Bezug zwischen Ethik und Moral zu beleuchten. Sie analysiert die philosophischen Lehren der Stoá, Thomas von Aquin und Jeremy Bentham und wendet diese Lehren auf ein Fallbeispiel an.
- Definition und Bedeutung von Ethik in der Sozialen Arbeit
- Unterscheidung zwischen Moral und Ethik
- Analyse philosophischer Ansätze zur Ethik
- Anwendung der Lehren auf ein Fallbeispiel
- Ethische Entscheidungsfindung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Ethik in der Sozialen Arbeit
Das Kapitel erläutert die Bedeutung von Ethik in der Sozialen Arbeit und definiert die Begriffe Moral und Ethik. Es beschreibt die drei Formen der Ethik: Empirische Ethik, Normative Ethik und Metaethik. Des Weiteren wird die Verbindung zwischen Ethik und Philosophie beleuchtet und die Bedeutung der Philosophie für die ethische Reflexion hervorgehoben.
Was ist Moral?
Das Kapitel behandelt die Verbindung zwischen Moral und Freiheit. Es werden unterschiedliche Aspekte der Moral beleuchtet: der religiöse, der literarische, der philosophische und der psychiatrische Aspekt. Die Moral wird als das Gewissen des Menschen definiert, das zwischen Gut und Böse entscheidet. Es wird zudem die Bedeutung der Gesellschaft für die Entwicklung moralischer Normen hervorgehoben.
Was bedeutet Ethik für die Soziale Arbeit?
Das Kapitel beschäftigt sich mit den Berufsethischen Prinzipien des DBSH, die als Grundlage des sozialpädagogischen Handelns dienen. Es werden verschiedene Verhaltensempfehlungen für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in verschiedenen Situationen, wie dem Umgang mit Klienten, Berufskolleginnen und Berufskollegen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie in der Öffentlichkeit, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Ethik, Moral, Philosophie, Soziale Arbeit, Berufsethische Prinzipien, Stoá, Thomas von Aquin, Jeremy Bentham, Fallbeispiel, Entscheidungsethik, Handlungsethik.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Ethik in der Sozialen Arbeit so wichtig?
Ethik dient als Orientierungshilfe für professionelles Handeln, insbesondere in Dilemmasituationen, in denen zwischen verschiedenen Werten und Interessen abgewogen werden muss.
Was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik?
Moral beschreibt die faktischen Sitten und Werte einer Gruppe, während Ethik die philosophische Reflexion und wissenschaftliche Untersuchung dieser Moral ist.
Wie wendet man die Stoa auf die Soziale Arbeit an?
Die stoische Ethik betont die Gelassenheit und die Konzentration auf das, was man selbst beeinflussen kann. Im Fallbeispiel hilft sie, professionelle Distanz und innere Ruhe zu bewahren.
Was besagt der Utilitarismus nach Jeremy Bentham für Sozialarbeiter?
Nach Bentham sollte so gehandelt werden, dass das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl entsteht. In der Sozialen Arbeit bedeutet dies oft eine Nutzenabwägung bei begrenzten Ressourcen.
Welche Rolle spielen die Berufsethischen Prinzipien des DBSH?
Sie bilden die offizielle Grundlage für das Handeln von Sozialarbeitern in Deutschland und geben Empfehlungen für den Umgang mit Klienten, Kollegen und der Öffentlichkeit.
- Quote paper
- Benjamin Hagenmüller (Author), 2011, Ethik in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191073