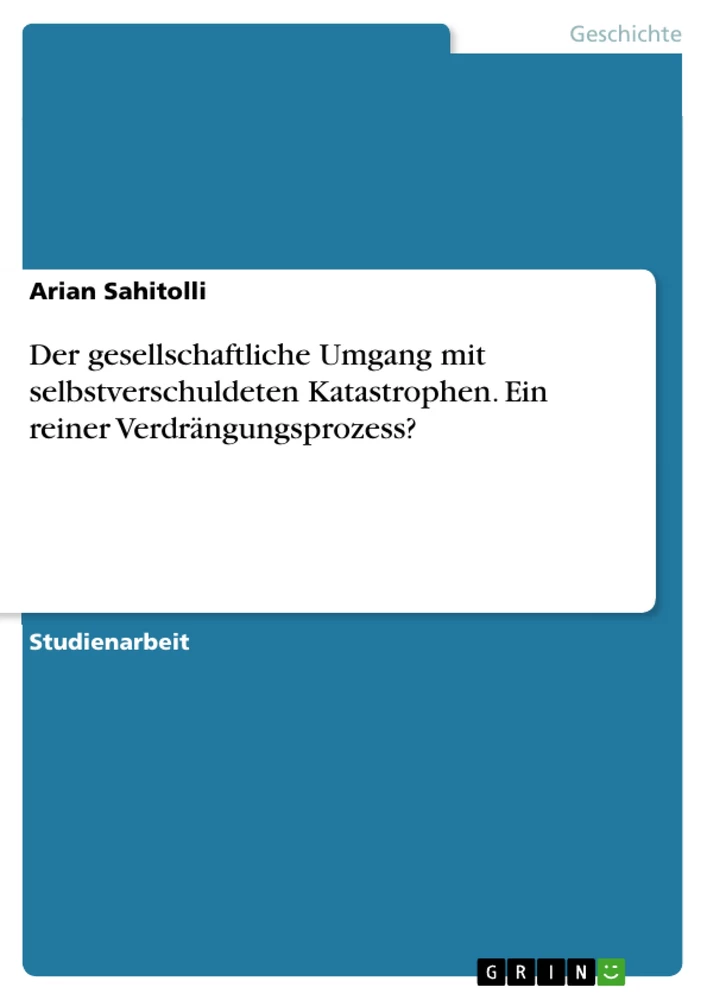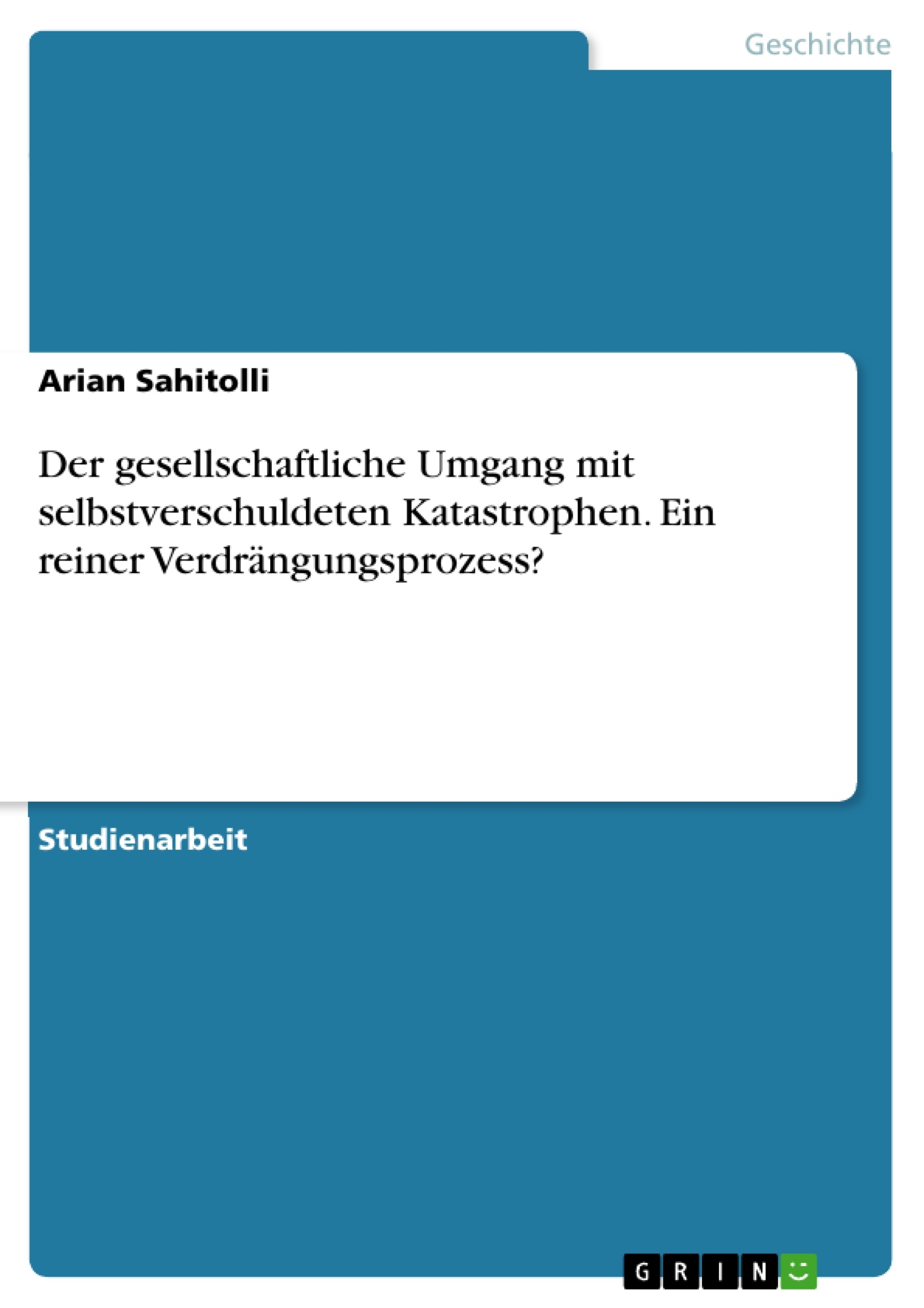Sie sind leise, klopfen nicht an und fallen oftmals gewaltig mit der Tür ins Haus. Sie sind nicht ständig da und doch irgendwie immer unter uns, denn sie haben einen Ruf wie Donnerhall. Sie stehen jenseits von Gewöhnlichkeit und Systematik, denn sie sind das Gegenstück zur Routinisierung und der Monotonie der Alltagserfahrungen. Wir rechnen mit ihnen und hoffen zugleich, dass sie -ähnlich wie Phantome- nur Hirngespinste bleiben. Sie besitzen die Kraft, die menschlichen Errungenschaften wie Kartenhäuser zusammenbrechen zu lassen: Katastrophen!
Der Mensch ist Bewohner eines unruhigen Feuerballs.Naturereignisse wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hochwasser oder die zu den Sommerperioden vermehrt aufkommenden Dürren führen den Menschen immer wieder vor Augen, dass sie keinen Einfluss auf die innerweltlichen, natürlichen Prozessvorgänge haben. Korrelieren hierbei die natürlichen Ereignisse mit den menschlichen Lebensräumen, so sind eine soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Katastrophe nur unmittelbare Folgen. In der heutigen Zeit der weltweiten Vernetzung bzw. Verflechtung aller Lebensbereiche des Menschen hat eine Katastrophe unmittelbar fatale Folgen für den größten Teil der Welt.Der Begriff der ,,Katastrophe“, der in der Medienlandschaft bei solchen Schicksalsschlägen geradewegs die Schlagzeilen füllt, ist in der breiten Bevölkerung bekannt: ein persönliches Unglück oder ein dramatisches Ereignis, dass eine unvorhersehbare, negative Wendung des persönlichen oder gesellschaftlichen Lebens einläutet, würde man im Alltagsverständnis wohl als ,,Katastrophe“ bezeichnen.Beim Umgang des Menschen mit Katastrophen zeigt sich jedoch zumeist eine besondere und unerschütterliche gesellschaftliche Mentalität: Licht am Ende des Tunnels zu sehen und den Wiederaufbau einzuläuten. Interessant ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass die Weltbevölkerung bei selbst-verschuldeten ,,Katastrophen“, wie den Reaktorunfällen, semantisch gar keinen Unterschied macht. Auch in solchen Fällen, in denen der Mensch und die Technik konvergieren, wird nur von einem unglücklichen, förmlich tragischen Schicksalsschlag gesprochen. Es scheint so, dass der Mensch –und mit ihm die gesamte Gesellschaft- solche Katastrophen scheinbar vergisst, denn die Krallen des Alltags holen ihn schnell wieder ein. Findet nach selbstverschuldeten Katastrophen also ein reiner Verdrängungsprozess im menschlichen Bewusstsein statt? Diese Frage soll wissenschaftlich erörtert und beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die ambivalente Moderne - Selbstgefährdung im Schatten der Kontinuität des Fortschritts..
- 2. Die menschliche Existenz in einer risikoreich[er]en Umwelt ....
- 2.1 Risiken und Katastrophen - Fundamentale Bestandteile der modernen Gesellschaft...
- 2.2 Katastrophen- Unabwendbare Ereignisse?.
- 3. Die geruchlose und unsichtbare Gefahr.
- 3.1 Der Zusammenbruch eines Irrglaubens..
- 4. Fazit: Das menschliche Kurzzeitgedächtnis für Katastrophen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob der Mensch selbstverschuldete Katastrophen verdrängt, indem sie den gesellschaftlichen Umgang mit solchen Ereignissen analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz der Moderne, die durch die Fortschritte der Technologie zwar Wohlstand und Komfort bringt, aber gleichzeitig die Gefahr von selbstverschuldeten Katastrophen birgt.
- Die Ambivalenz der Moderne: Fortschritt und Risiko
- Der gesellschaftliche Umgang mit Katastrophen
- Verdrängung als Reaktion auf Katastrophen
- Risikoforschung und Katastrophenforschung
- Das menschliche Kurzzeitgedächtnis für Katastrophen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der selbstverschuldeten Katastrophen in den Kontext der modernen Gesellschaft und ihrer ambivalenten Beziehung zu Fortschritt und Risiko. Sie führt den Leser in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor.
- Kapitel 2: Die menschliche Existenz in einer risikoreicheren Umwelt: Dieses Kapitel beleuchtet die Risiken und Katastrophen, die im modernen Kontext eine fundamentale Rolle spielen. Es werden verschiedene Arten von Risiken und Katastrophen betrachtet und die Frage nach deren Unausweichlichkeit diskutiert.
- Kapitel 3: Die geruchlose und unsichtbare Gefahr: Dieses Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel aus der Geschichte, um zu zeigen, dass der Mensch anscheinend Ängste verdrängt. Es analysiert das Reaktorunglück in Fukushima im Kontext der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und untersucht die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Ereignisse.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die Themen Katastrophe, Risiko, Verdrängung, moderne Gesellschaft, Fortschritt, Technikgeschichte, Reaktorkatastrophe, Tschernobyl, Fukushima, Risikoforschung und soziologische Katastrophenforschung.
Häufig gestellte Fragen
Verdrängt die Gesellschaft selbstverschuldete Katastrophen?
Die Arbeit untersucht, ob ein "menschliches Kurzzeitgedächtnis" dazu führt, dass technische Katastrophen (wie Fukushima) trotz ihrer Tragweite schnell wieder vergessen werden.
Was unterscheidet Naturkatastrophen von selbstverschuldeten Katastrophen?
Naturkatastrophen gelten als unabwendbar, während selbstverschuldete Katastrophen aus der Konvergenz von Mensch und Technik resultieren.
Welche Rolle spielt die Ambivalenz der Moderne?
Der technologische Fortschritt bringt Wohlstand, erzeugt aber gleichzeitig neue, oft unsichtbare Risiken für die gesamte Gesellschaft.
Warum wird oft von einem "unglücklichen Schicksal" gesprochen?
Diese Semantik dient oft der Verdrängung menschlichen Versagens, indem technische Katastrophen sprachlich wie unabwendbare Naturereignisse behandelt werden.
Was lehrt uns der Vergleich zwischen Tschernobyl und Fukushima?
Er zeigt, dass trotz historischer Erfahrungen ähnliche Risiken eingegangen werden und der gesellschaftliche Verdrängungsprozess nach einiger Zeit wieder einsetzt.
- Arbeit zitieren
- Arian Sahitolli (Autor:in), 2011, Der gesellschaftliche Umgang mit selbstverschuldeten Katastrophen. Ein reiner Verdrängungsprozess?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191112