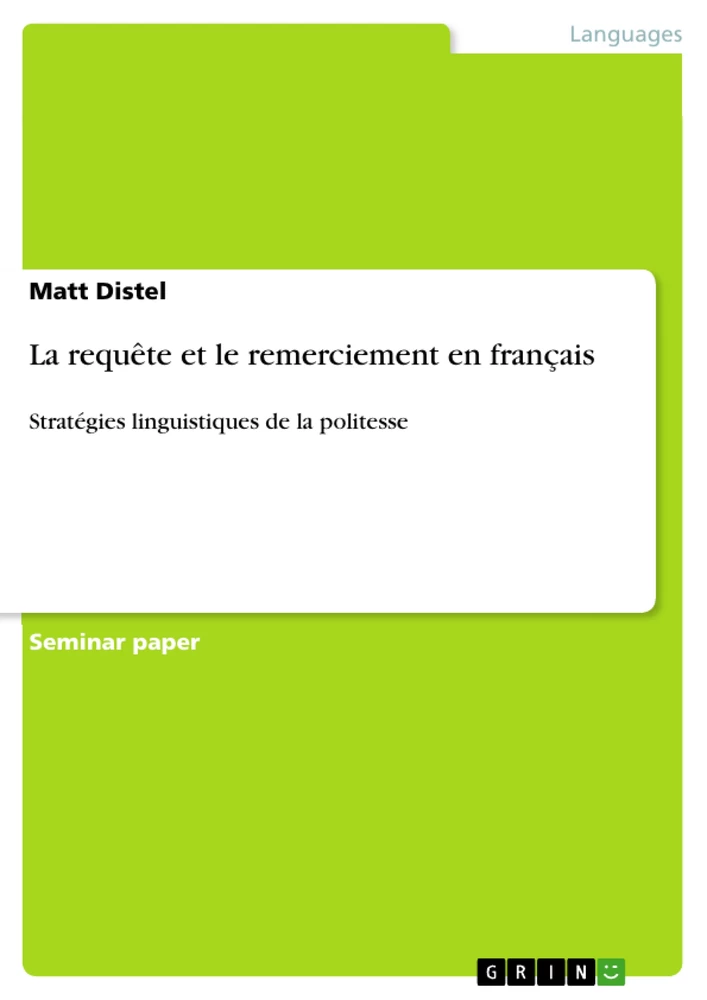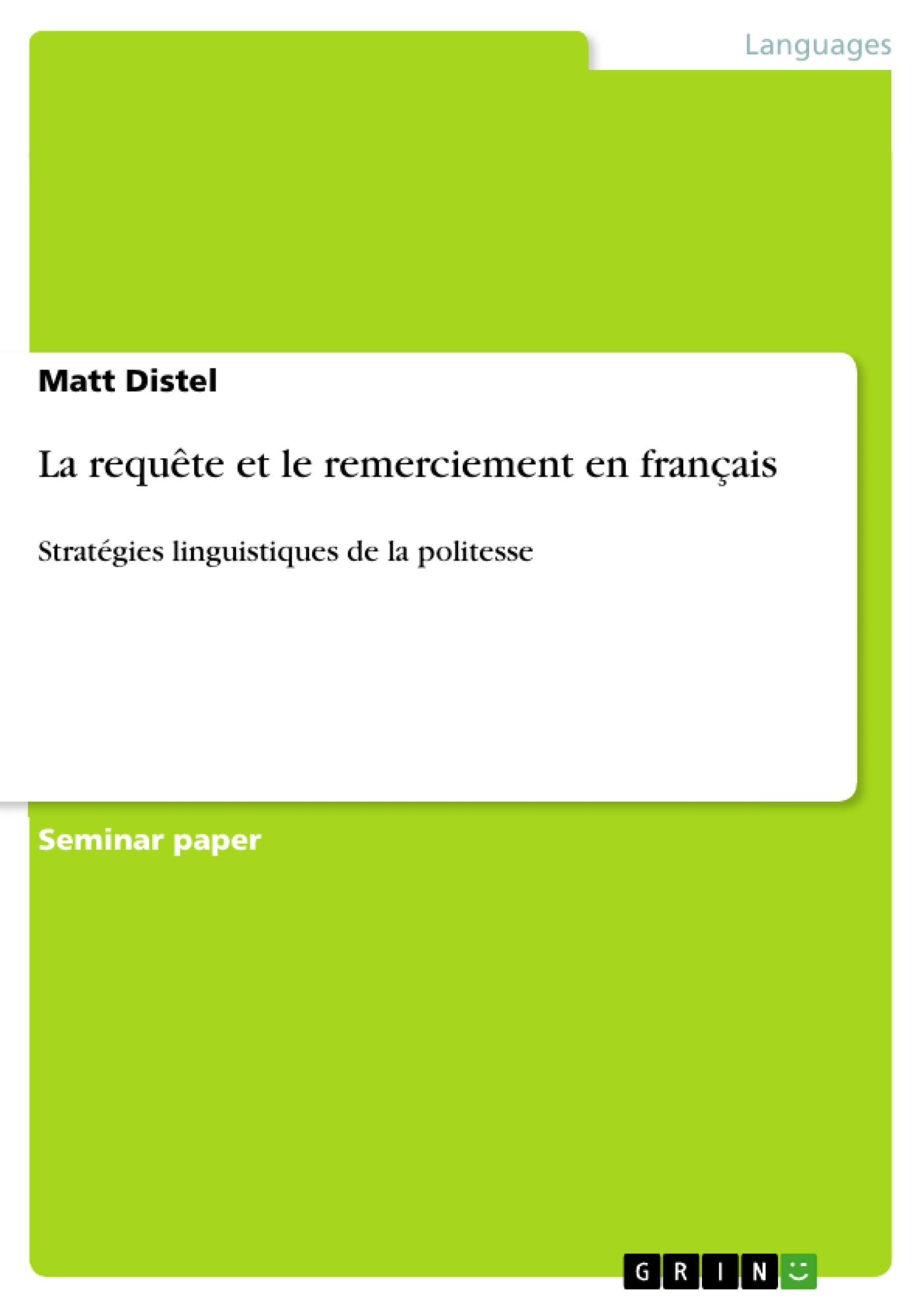Au quotidien, cela arrive très fréquemment, de rencontrer des expressions de requête ou de remerciement. Par exemple, on demande de la viande chez le boucher, du pain chez le boulanger, des crayons à la papèterie. Le commerçant peut avoir ce dont on a besoin (ou pas, et le cas échéant nous proposer autre chose en remplacement); dans ce cas là une série de normes conventionnelles nous obligent à le remercier pour le service reçu.
Nous analyserons ici les catégories de la requête et du remerciement en commençant par figer une base théorique, qui se fonde sur les études de Brown/Levinson1.
Après nous verrons plus en détail les définitions de chaque acte, en en approfondissant toutes les composants, même avec des exemples.
Fondamentale pour ce mémoire sera l’œuvre de Gudrun Held2, de laquelle on tirera la plupart des catégorisations qui concernent notre sujet, en y intégrant des considérations et des approfondissements d’autres chercheurs.
Nous conclurons avec des considérations générales sur le rôle que jouent ces deux actes.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Die Höflichkeitstheorie nach Brown und Levinson
- Eine wichtige Integration: die FFAs
- Ein dichotomisches und ausgeglichenes System
- Die Bitte
- Die Vorbereitungsphasen
- Die Fokalphasen
- Die Abschlussphasen
- Der Dank
- Die Belohnungsphase
- Die Fokalphasen
- Die Anerkennungsphase
- Die Entschädigungsphase
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die sprachlichen Akte der Bitte und des Dankes im Kontext der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson. Ziel ist es, die Struktur und Funktion dieser Akte detailliert darzustellen und anhand theoretischer Modelle zu beleuchten.
- Brown und Levinsons Höflichkeitstheorie und deren Anwendung auf Bitten und Dank
- Die Unterscheidung zwischen Face-Threatening Acts (FTAs) und Face-Flattering Acts (FFAs)
- Die Phasenstruktur von Bitten und Dankesäußerungen
- Positive und negative Höflichkeit im Kontext von Bitten und Dank
- Pragmatische und formale Variabilität von Bitten und Dank
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Akte der Bitte und des Dankes ein und beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit. Es wird die Relevanz dieser alltäglichen Interaktionsformen hervorgehoben und auf die theoretische Grundlage der Arbeit, die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson, verwiesen. Die Arbeit verspricht eine detaillierte Analyse der Komponenten von Bitten und Dankesäußerungen, unterstützt durch die Kategorisierung von Gudrun Held und weiteren Forschern.
Die Theorie der Höflichkeit (Politeness theory) nach Brown und Levinson: Dieses Kapitel erläutert die Kernkonzepte der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson. Es beschreibt den Begriff der „Face“, die Unterscheidung zwischen positiver und negativer Face sowie die Konzepte von Face-Threatening Acts (FTAs) und Face-Flattering Acts (FFAs). Die Theorie wird als Grundlage für die anschließende Analyse der Bitten und des Dankes verwendet. Die Bedeutung der Aufrechterhaltung des eigenen und des fremden Gesichts im sozialen Austausch wird hervorgehoben und wie FTAs durch verschiedene Strategien minimiert werden können.
Die Bitte: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem sprachlichen Akt der Bitte. Es wird die Bitte als „Anfrage nach einer Handlung“ definiert und in verschiedene Phasen unterteilt (Vorbereitung, Fokus, Abschluss). Die Analyse berücksichtigt die pragmatische und formale Variabilität von Bitten und deren Abhängigkeit vom Kontext. Die Einordnung der Bitte als direktiver Sprechakt nach Searle wird diskutiert, ebenso wie die möglichen Bedrohungen der negativen Face des Angesprochenen und Strategien zur Minimierung dieser Bedrohungen.
Der Dank: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Dankes. Ähnlich wie bei der Bitte werden verschiedene Phasen (Belohnung, Fokus, Anerkennung, Entschädigung) unterschieden. Der Dank wird als Face-Flattering Act (FFA) beschrieben, der die positive Face des Angesprochenen stärkt. Die Analyse berücksichtigt die vielfältigen Ausdrucksformen des Dankes und die jeweilige Kontextualisierung, um die Funktionen und Intentionen des Dankes zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Höflichkeitstheorie, Brown und Levinson, Face, Face-Threatening Acts (FTAs), Face-Flattering Acts (FFAs), positive Höflichkeit, negative Höflichkeit, Bitte, Dank, Sprechakte, Pragmatik, Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse von Bitten und Danken im Kontext der Höflichkeitstheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sprachlichen Akte des Bitten und Dankens im Detail. Sie untersucht die Struktur und Funktion dieser Akte und beleuchtet sie anhand der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson.
Welche Theorie bildet die Grundlage der Analyse?
Die Arbeit basiert auf der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson. Zentrale Konzepte dieser Theorie, wie „Face“, positive und negative Höflichkeit, Face-Threatening Acts (FTAs) und Face-Flattering Acts (FFAs), werden erläutert und auf die Analyse von Bitten und Danken angewendet.
Wie werden Bitten in der Arbeit kategorisiert?
Bitten werden als „Anfrage nach einer Handlung“ definiert und in drei Phasen unterteilt: Vorbereitung, Fokus und Abschluss. Die Analyse berücksichtigt dabei die pragmatische und formale Variabilität von Bitten und ihre Abhängigkeit vom Kontext. Die Einordnung der Bitte als direktiver Sprechakt nach Searle wird ebenfalls diskutiert.
Wie werden Dankesäußerungen in der Arbeit kategorisiert?
Dankesäußerungen werden als Face-Flattering Acts (FFAs) beschrieben, die die positive Face des Angesprochenen stärken. Die Analyse unterscheidet verschiedene Phasen: Belohnung, Fokus, Anerkennung und Entschädigung. Die vielfältigen Ausdrucksformen des Dankes und deren Kontextualisierung werden berücksichtigt, um Funktionen und Intentionen zu beleuchten.
Welche Schlüsselkonzepte der Höflichkeitstheorie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Konzepte wie „Face“, positive und negative Höflichkeit, Face-Threatening Acts (FTAs) und Face-Flattering Acts (FFAs). Es wird erläutert, wie diese Konzepte zur Analyse von Bitten und Danken angewendet werden können und wie FTAs durch verschiedene Strategien minimiert werden.
Welche Aspekte der Bitten und des Dankens werden untersucht?
Die Analyse umfasst die pragmatische und formale Variabilität von Bitten und Dank, die Phasenstruktur beider Akte, die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Höflichkeitsstrategien im Kontext von Bitten und Dank und die mögliche Bedrohung der negativen Face des Angesprochenen bei Bitten.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen detaillierten, analytischen Ansatz, der auf der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson basiert. Die Kategorisierung von Gudrun Held und weiteren Forschern wird zur Unterstützung der Analyse herangezogen.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Höflichkeitstheorie nach Brown und Levinson, ein Kapitel zur Analyse von Bitten und ein Kapitel zur Analyse von Dankesäußerungen. Es schließt mit einer Zusammenfassung der Schlüsselwörter ab.
Wo finde ich Schlüsselwörter zu diesem Thema?
Schlüsselwörter umfassen: Höflichkeitstheorie, Brown und Levinson, Face, Face-Threatening Acts (FTAs), Face-Flattering Acts (FFAs), positive Höflichkeit, negative Höflichkeit, Bitte, Dank, Sprechakte, Pragmatik, Interaktion.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die detaillierte Darstellung der Struktur und Funktion von Bitten und Danken und deren Beleuchtung anhand theoretischer Modelle, insbesondere der Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson.
- Arbeit zitieren
- Matt Distel (Autor:in), 2011, La requête et le remerciement en français, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191232