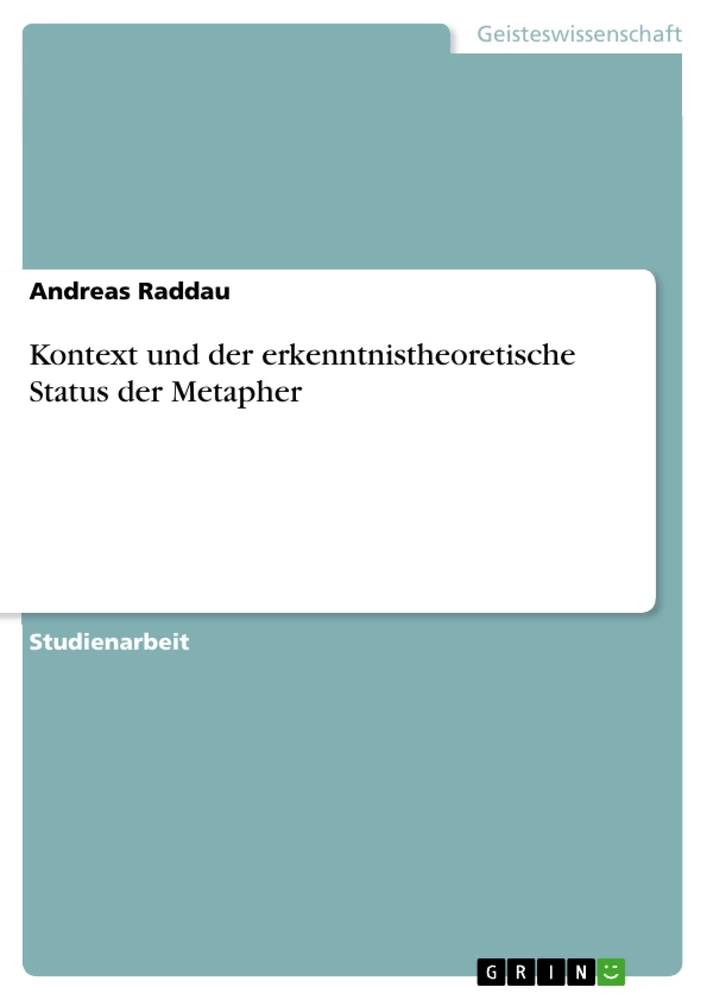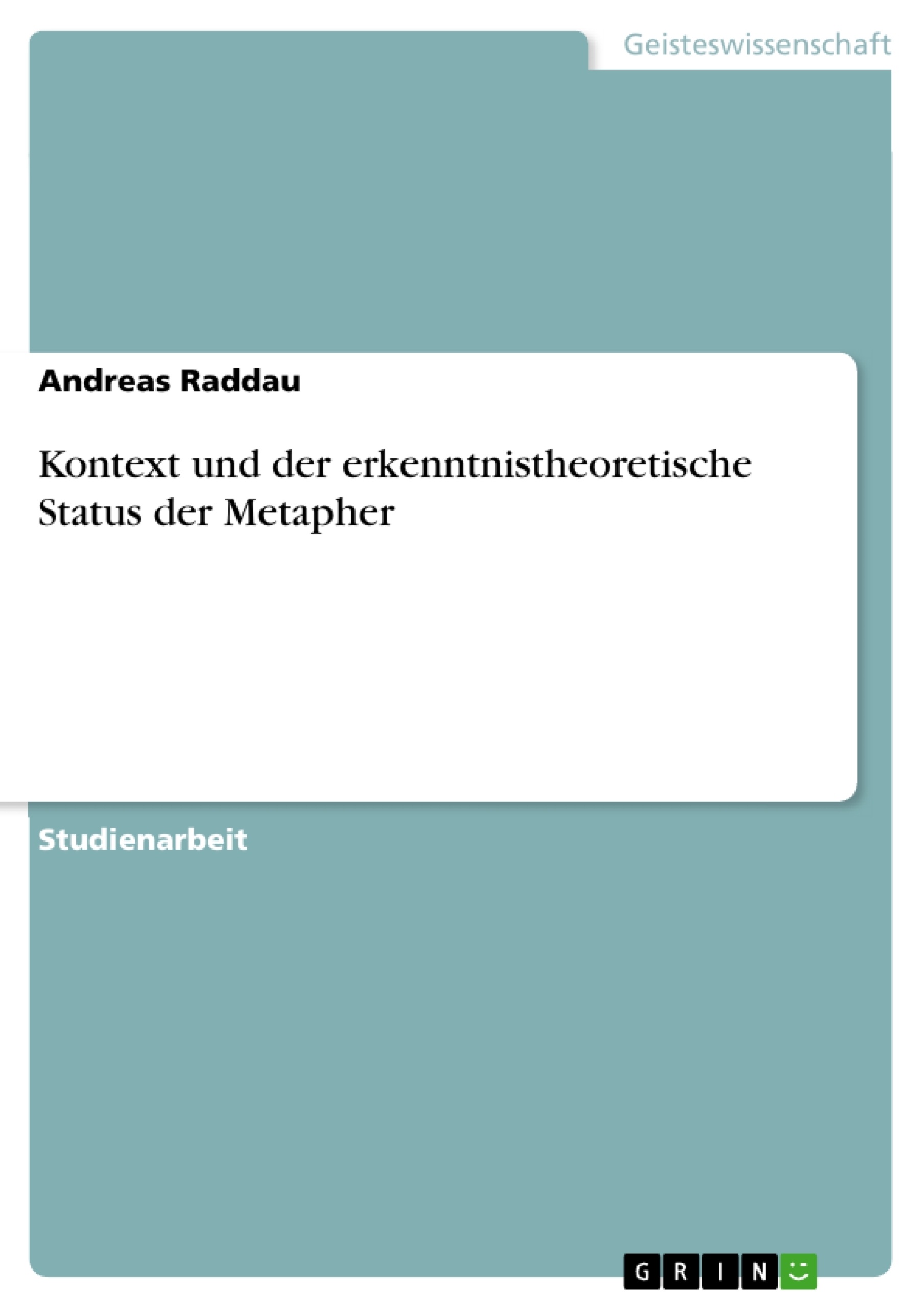Die Metapher als Unterscheidungskriterium teilt literarische Genres in zwei Gruppen auf: wissenschaftliche, akademische Werke, stets um die Abwesenheit aller Metaphorik und Mehrdeutigkeit bemüht, auf der einen und alle weiteren – Prosa, Poesie, Rhetorik etc. - auf der anderen Seite, dort, wo auch die Metapher ihren rechtmäßigen Platz hat.
So oder so ähnlich kann wohl die zeitgenössische Vorstellung in Alltag und weiten Teilen akademischer Praxis insbesondere der Geisteswissenschaften über den Status der Metapher und das ihr angestammte Terrain beschrieben werden. Dabei bedienen sich Philosophen seit der Antike zahlreicher künstlerischer Gestaltungsmöglichkeiten, um ihr Anliegen vorzubringen. Mit Vorbehalt zu äußern ist die These aber aus ganz anderen, sehr viel schwerwiegenderen Gründen. Sofern sie für wahr gehalten wird, verhindert sie sowohl aufgrund ihrer Voraussetzungen als auch durch ihre Folgen die Anerkennung des Potenzials, das der Metapher innewohnt und für das Verständnis von sprachlicher Kommunikation im Allgemeinen, das Verhältnis von akademischer und künstlerischer Textproduktion im Besonderen und den Nutzen der Metapher im Bereich der Ersteren fruchtbar gemacht werden kann.
Das Ziel dieser Arbeit ist die genauere Betrachtung hauptsächlich eines der genannten Aspekte, nämlich Nutzen, Effekt und Wert der Metapher, sobald sie in akademischer Textproduktion Verwendung findet. Daraus ergeben sich einige bemerkenswerte Folgen für künstlerische Literatur, und ihre Fähigkeit, Erkenntnisgewinn und -vermittlung im wissenschaftlichen Betrieb entscheidend modifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wörtliche und metaphorische Interpretation
- Die zeitliche Priorität wörtlicher Interpretation
- Kognitiver Ressourcenbedarf der Metapher
- Metapher als Substitution
- Das erkenntnistheoretische Potenzial der Metapher
- Metapher in der Wissenschaft
- Die Wissenschaftlichkeit der Kunst
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Metapher und ihrem erkenntnistheoretischen Status. Sie zielt darauf ab, das Potenzial der Metapher für das Verständnis von sprachlicher Kommunikation und das Verhältnis von akademischer und künstlerischer Textproduktion aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Verwendung der Metapher in akademischen Texten und untersucht ihre Auswirkungen auf die Bewertung und den Umgang mit künstlerischer Literatur.
- Die Unterscheidung zwischen wörtlicher und metaphorischer Interpretation
- Die Rolle der Metapher in der Wissenschafts- und Literaturproduktion
- Das erkenntnistheoretische Potenzial der Metapher
- Die Anwendung von Metaphern in akademischen Texten
- Die Folgen der Verwendung von Metaphern für die Bewertung und den Umgang mit künstlerischer Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Metapher als Unterscheidungskriterium zwischen wissenschaftlichen und künstlerischen Werken vor und erläutert das Ziel der Arbeit, das Potenzial der Metapher für akademische und künstlerische Texte zu beleuchten.
- Wörtliche und metaphorische Interpretation: Dieses Kapitel analysiert die Argumente, die zur Trennung von wörtlicher und figurativer Sprache angeführt wurden. Dabei werden insbesondere die Behauptungen untersucht, dass metaphorische Interpretation schwieriger sei als wörtliche, erst nach dem Scheitern wörtlicher Interpretation angewendet werde und lediglich eine Substitution von Wörtern darstelle.
- Das erkenntnistheoretische Potenzial der Metapher: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der Metapher auf wissenschaftliche und künstlerische Texte. Es wird untersucht, wie die Metapher zur Erzeugung neuer Erkenntnisse und zur Erweiterung des Verständnisses von Sachverhalten beitragen kann.
Schlüsselwörter
Metapher, Erkenntnistheorie, Sprachliche Kommunikation, Wissenschaftliche Textproduktion, Künstlerische Literatur, Wörtliche Interpretation, Figurative Sprache, Tenor, Vehikel, Basis.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Stellenwert hat die Metapher in wissenschaftlichen Texten?
Entgegen der Ansicht, Metaphern gehörten nur in die Kunst, zeigt die Arbeit, dass sie ein hohes erkenntnistheoretisches Potenzial für die Wissenschaft besitzen.
Was ist der Unterschied zwischen wörtlicher und metaphorischer Interpretation?
Die Arbeit analysiert die These der zeitlichen Priorität, nach der das Gehirn erst eine wörtliche Deutung versucht, bevor es auf eine metaphorische Ebene wechselt.
Können Metaphern neue Erkenntnisse generieren?
Ja, Metaphern dienen nicht nur als sprachlicher Schmuck (Substitution), sondern können Sachverhalte neu strukturieren und so den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn modifizieren.
Was bedeutet „kognitiver Ressourcenbedarf“ bei Metaphern?
Es wird untersucht, ob das Verstehen von Metaphern mehr geistige Anstrengung erfordert als die Verarbeitung rein wörtlicher Sprache.
Wie beeinflusst die Metapher das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft?
Die Arbeit hinterfragt die strikte Trennung und beleuchtet die „Wissenschaftlichkeit der Kunst“ sowie den Nutzen poetischer Elemente in akademischen Werken.
- Citation du texte
- Andreas Raddau (Auteur), 2011, Kontext und der erkenntnistheoretische Status der Metapher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191242