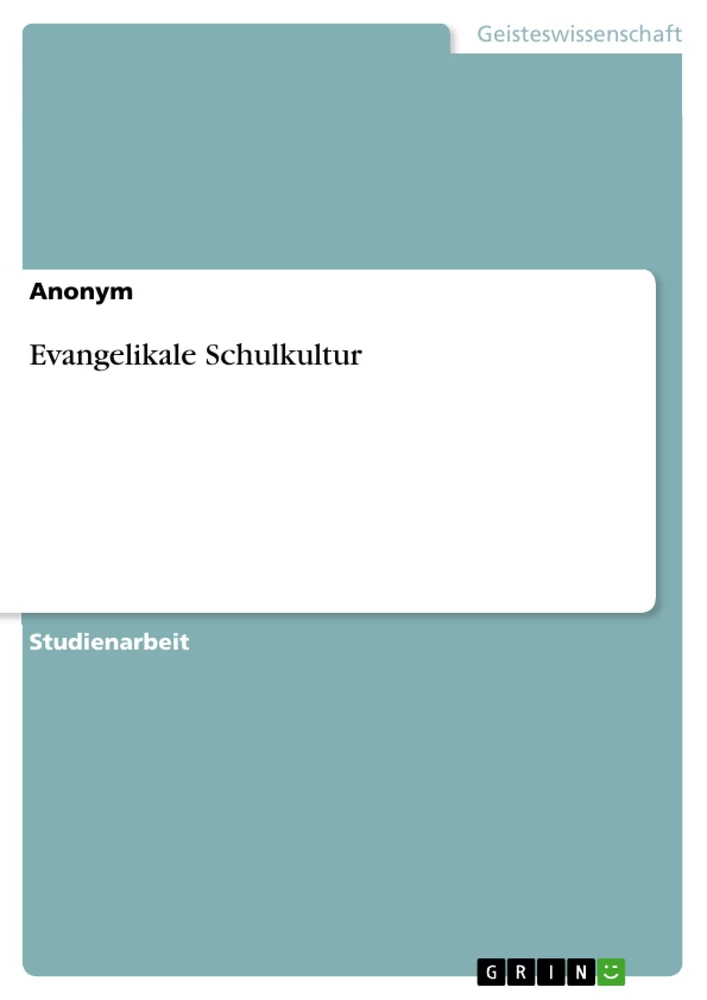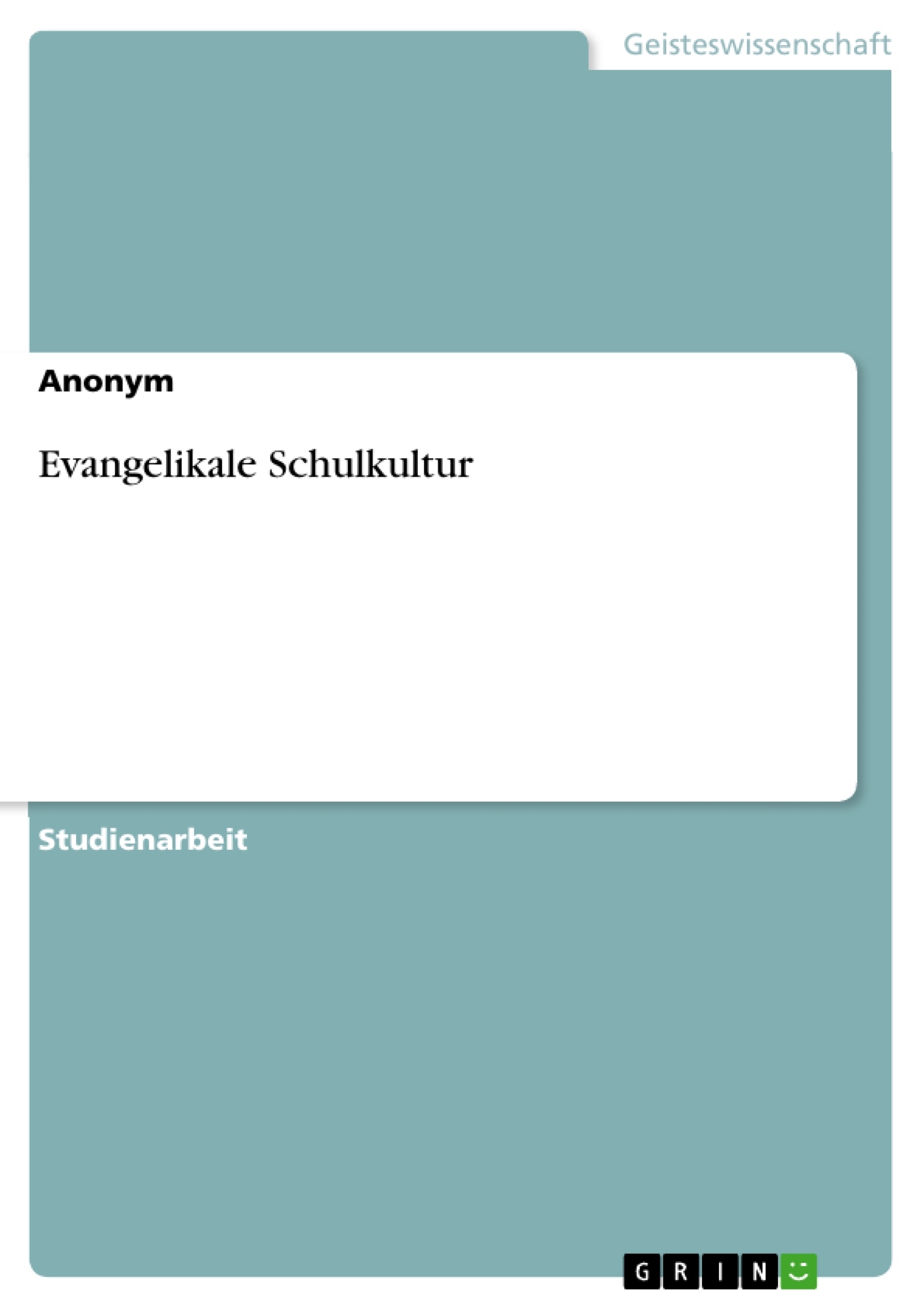Evangelikale Schulkultur? – Eine qualitativ-empirische Studie einer Frei-Christlichen Schule. Die folgende Studie soll aufschlüsseln, welche Besonderheiten die Georg-Müller-Schulen als Frei-Christliche Schule vorzuweisen hat. Gibt es überhaupt Besonderheiten, die die Schule ausmachen? Und wenn es welche gibt, wie werden sie von Schülern und Lehrern wahrgenommen und beurteilt?
Die folgende qualitativ-empirische Studie dient dazu, diesen Fragen
nachzugehen. Als Methode wurde die Soziale Photo-Matrix ausgewählt, da sie Zugang zum Unbewussten der Schule verschafft und somit zum Denken anregen kann. Vorbereitend werden Evangelikale Schulen vorgestellt. Zum einen werden vier Schulen und ihre Entstehung sowie deren Motivation zur Gründung erläutert, eine Frei-Christliche Schule zu errichten. Darauf folgt die Präsentation der Georg-Müller-Schulen selbst, vor allem in Bezug auf deren Schulprofil, das sich in ein geistliches und ein pädagogisches Konzept aufteilt. Im Anschluss wird die Methode der Sozialen Photo-Matrix von Burkard Sievers eingehend beschrieben. Woraufhin im vierten Abschnitt die methodische Vorgehensweise vor, während und nach der Durchführung der Sozialen Photo-Matrix erläutert wird. Es folgt eine Darstellung einzelner Bilder mit den dazugehörigen Assoziationen, um einen besseren Einblick in die von den Schülern gewählten Motive zu erhalten. Eine quantitative Auswertung der Motive schließt sich an. Sie dient dazu, um herauszufiltern, welche Motive die Schülerinnen und Schüler als das Besondere für ihre Schule empfinden. Darauf folgt eine Kategorisierung der Assoziationen, woran die Auswertung und Interpretation der aus der quantitativen und qualitativen Auswertung gewonnen Daten anschließt, um dann mit einem Fazit zu schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Evangelikale Schulen
- Entstehung evangelikaler Bekenntnisschulen
- Vorstellung der GMS in Bielefeld
- Die Methode der Sozialen Photo-Matrix von Burkard Sievers
- Darstellung einzelner Bilder mit den entsprechenden Assoziationen
- Quantitative Auswertung der Bilder
- Kategorisierung der Assoziationen
- Auswertung und Interpretation der gewonnen Daten aus der quantitativen und qualitativen Untersuchung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese qualitativ-empirische Studie untersucht die Besonderheiten der Georg-Müller-Schulen als Frei-Christliche Schule. Die Studie analysiert, welche Merkmale die Schule ausmachen und wie diese von Schülern und Lehrern wahrgenommen und beurteilt werden. Die Soziale Photo-Matrix wurde als Methode ausgewählt, um Zugang zum Unbewussten der Schule zu erhalten und zum Nachdenken anzuregen.
- Motivation zur Gründung evangelikaler Bekenntnisschulen
- Vorstellung der Georg-Müller-Schulen (GMS)
- Die Methode der Sozialen Photo-Matrix
- Analyse der von Schülern gewählten Motive
- Interpretation der Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Auswertung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Besonderheiten der Georg-Müller-Schulen als Frei-Christliche Schule vor und erläutert die Methodik der Sozialen Photo-Matrix.
- Das Kapitel „Evangelikale Schulen“ widmet sich der Entstehung evangelikaler Bekenntnisschulen und stellt die Georg-Müller-Schulen (GMS) in Bielefeld vor.
- Das Kapitel „Die Methode der Sozialen Photo-Matrix von Burkard Sievers“ beschreibt die Methode der Sozialen Photo-Matrix und ihre Anwendung in der Studie.
- Das Kapitel „Darstellung einzelner Bilder mit den entsprechenden Assoziationen“ präsentiert einzelne Bilder und die dazugehörigen Assoziationen, die von den Schülern in der Studie gewählt wurden.
- Das Kapitel „Quantitative Auswertung der Bilder“ analysiert die von den Schülern gewählten Motive und zeigt, welche Motive als besonders für ihre Schule empfunden werden.
- Das Kapitel „Kategorisierung der Assoziationen“ kategorisiert die Assoziationen und bereitet die Daten für die Auswertung und Interpretation vor.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Studie sind: Evangelikale Schulen, Frei-Christliche Schulen, Soziale Photo-Matrix, Schulprofil, Schulkonzept, geistliches Konzept, pädagogisches Konzept, Wertevermittlung, christliche Werte, Normen, Schülerperspektive, Lehrerperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was sind evangelikale Bekenntnisschulen?
Es sind frei-christliche Schulen, die auf einem evangelikalen Glaubensbekenntnis basieren und christliche Werte fest in ihr pädagogisches Konzept integrieren.
Was ist die "Soziale Photo-Matrix"?
Eine qualitativ-empirische Forschungsmethode von Burkard Sievers, die über Bilder und Assoziationen Zugang zum Unbewussten einer Organisation (wie einer Schule) sucht.
Was macht die Georg-Müller-Schulen (GMS) besonders?
Die GMS zeichnen sich durch ein spezifisches geistliches Profil und eine starke Wertevermittlung aus, die von Schülern oft als Alleinstellungsmerkmal wahrgenommen wird.
Wie nehmen Schüler ihre christliche Schule wahr?
Die Studie untersucht über Bildmotive, welche Symbole und Orte in der Schule für die Schüler eine besondere religiöse oder pädagogische Bedeutung haben.
Welchen Zweck dient die quantitative Auswertung in dieser Studie?
Sie hilft dabei herauszufiltern, welche Motive am häufigsten mit dem "Besonderen" der Schule assoziiert werden, um Schwerpunkte der Schulkultur zu identifizieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Evangelikale Schulkultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191282