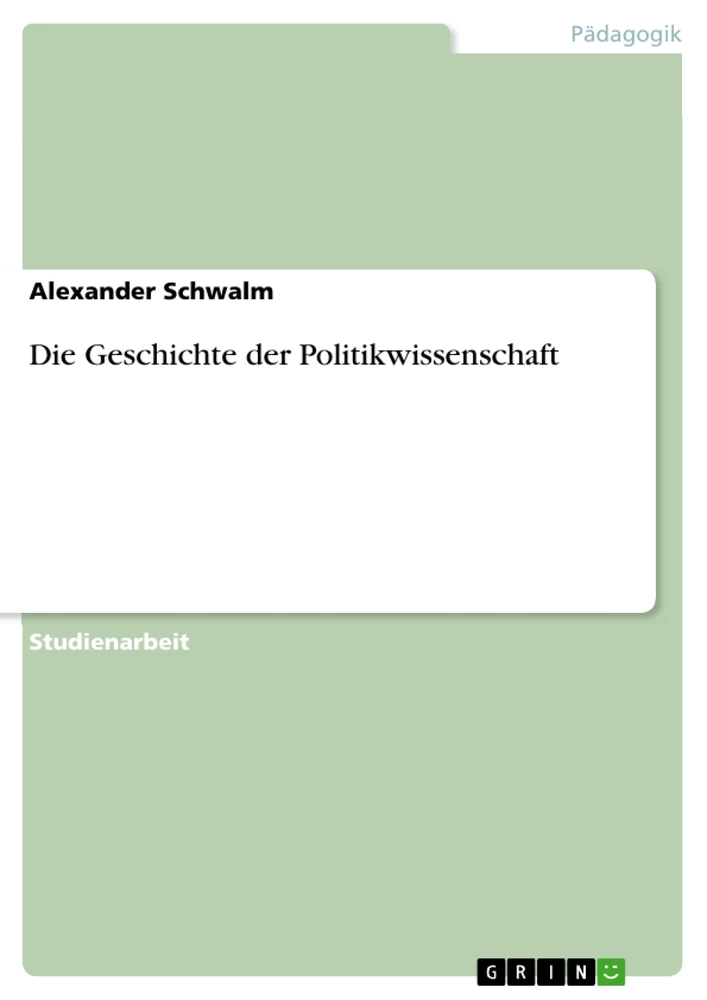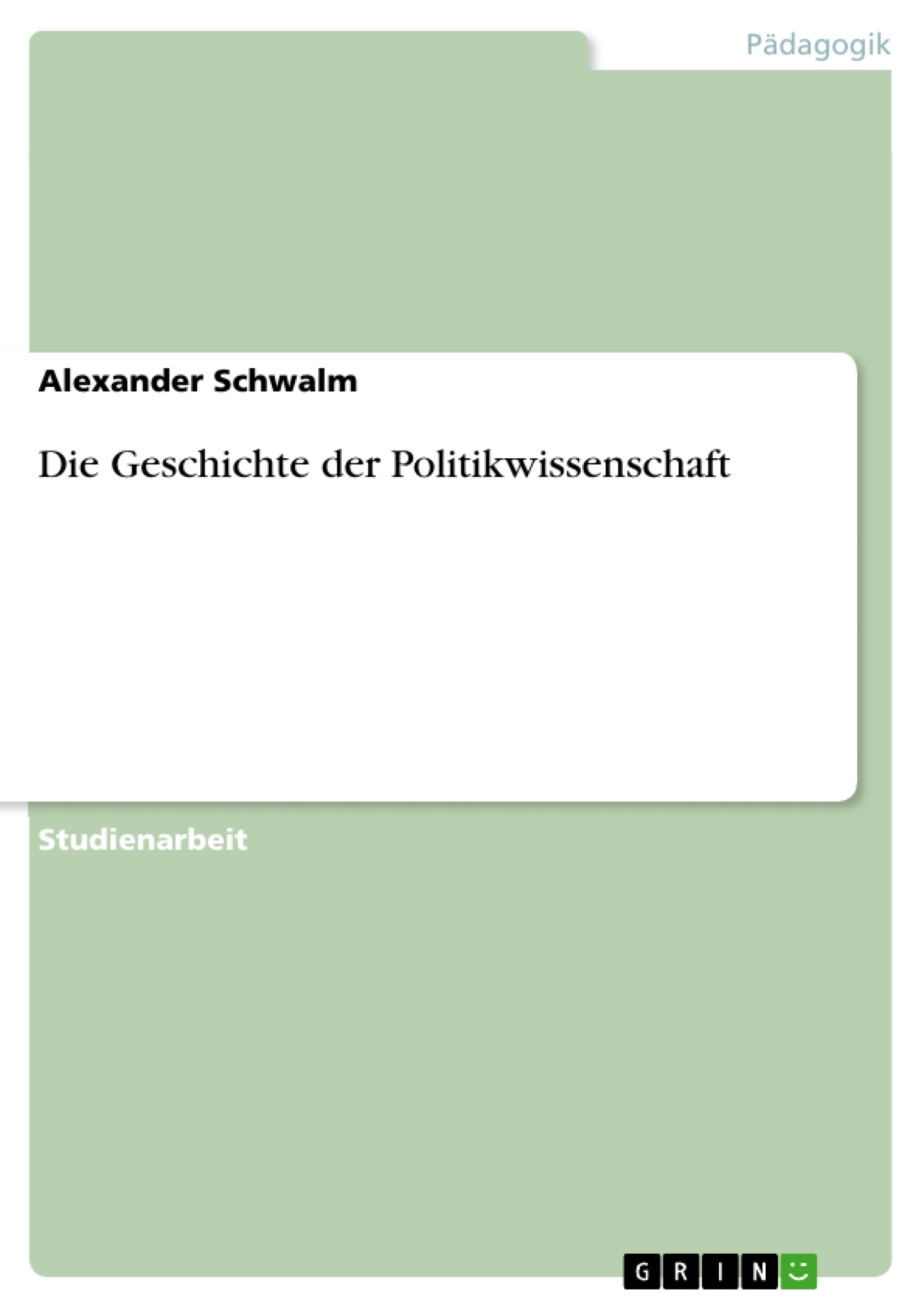Die Wissenschaft der Politik unterliegt verschiedensten Vorurteilen. Das mag daran liegen, dass Politik und Wissenschaft zwei unterschiedliche Welten sind. Allerdings ist das im Bewusstsein der Öffentlichkeit wohl noch nicht angekommen. Politikwissenschaftler haben also die Aufgabe, die Politik wissenschaftlich zu betrachten. Sie „helfen zu planen, zu prognostizieren, zu erklären und sie helfen Politik zu kritisieren, zu optimieren, Gegenargumente zu formulieren und durchzusetzen“ (Alemann1995, S. 11/12). Nun stellt sich die Frage, welches die Vorurteile sind. Diese werden nun näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorurteile, mit der die Politikwissenschaft zu kämpfen hat
- Politikwissenschaft als keine „normale\" Wissenschaft...
- ,,Politikwissenschaft ist eine 'politisierte' Wissenshaft“ (Alemann 1995, S. 15)..\li>
- Politikwissenschaftler werden nicht verstanden...
- ,,Politikwissenschaftlern muss man misstrauen wie den Politikern\"\n(Alemann 1995, S. 18).........
- „Politikwissenschaftler wollen Politiker werden“ (Alemann 1995, S. 19)
- ,,Politikwissenschaftler pflegen ihre Komplexe“ (Alemann 1995, S. 20)..\li>
- Begriffsbestimmung
- Politikwissenschaft als eine sehr alte und zugleich sehr junge Disziplin ...............9
- Exkurs: Warum überhaupt Geschichte?.
- Argumente, die für eine junge Disziplin sprechen.
- Argumente, die für eine alte Disziplin sprechen.....
- Politikwissenschaft als Teil der praktischen Philosophie in Antike und Mittelalter... 11
- Politikwissenschaft seit Beginn der Neuzeit....
- Was macht Politikwissenschaft zur Wissenschaft? - Grundlegende\nVoraussetzungen politikwissenschaftlichen Denkens.....
- Politikwissenschaftliche Grundlagen.
- Ein Profil der Politikwissenschaft.....
- Zukunftsperspektiven für die Politikwissenschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Politikwissenschaft und untersucht die Vorurteile, mit denen sie zu kämpfen hat. Sie analysiert die Gründe für die spezifischen Herausforderungen dieses Fachbereichs, die sich von anderen Wissenschaften unterscheiden. Des Weiteren wird der wissenschaftliche Charakter der Politikwissenschaft erörtert und ein Blick in die Zukunftsperspektiven geworfen.
- Vorurteile gegenüber der Politikwissenschaft
- Begriffsbestimmung und Definition der Politikwissenschaft
- Historische Entwicklung der Politikwissenschaft
- Wissenschaftliche Grundlagen der Politikwissenschaft
- Zukünftige Herausforderungen und Chancen der Politikwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Vorurteile, mit der die Politikwissenschaft zu kämpfen hat
Dieses Kapitel behandelt die gängigen Vorurteile gegenüber der Politikwissenschaft. Es wird analysiert, warum die Politikwissenschaft als keine „normale" Wissenschaft wahrgenommen wird und welche Gründe es für das Vorurteil gibt, dass Politikwissenschaftler in der Politik Karriere machen wollen. Die Arbeit beleuchtet außerdem den Aspekt, dass Politikwissenschaft als eine „politisierte" Wissenschaft betrachtet wird.
Begriffsbestimmung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der Politikwissenschaft. Es wird diskutiert, ob sie als eine junge oder alte Disziplin betrachtet werden kann. Die Arbeit betrachtet die Entwicklung der Politikwissenschaft als Teil der praktischen Philosophie in der Antike und im Mittelalter.
Politikwissenschaft als eine sehr alte und zugleich sehr junge Disziplin
Dieses Kapitel betrachtet die historische Entwicklung der Politikwissenschaft und diskutiert die Argumente, die sowohl für eine junge als auch für eine alte Disziplin sprechen. Es werden die Wurzeln der Politikwissenschaft in der Antike und im Mittelalter untersucht.
Was macht Politikwissenschaft zur Wissenschaft? - Grundlegende Voraussetzungen politikwissenschaftlichen Denkens
Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftlichen Grundlagen der Politikwissenschaft und untersucht die Voraussetzungen für politikwissenschaftliches Denken. Es wird erörtert, was die Politikwissenschaft zu einer Wissenschaft macht und welche spezifischen Methoden und Ansätze sie verwendet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich der Geschichte der Politikwissenschaft und analysiert die Vorurteile, die ihr begegnen. Sie beleuchtet die wissenschaftlichen Grundlagen des Fachbereichs und erörtert die Entwicklung von einer „politisierten“ zu einer etablierten Wissenschaft. Wichtige Themen sind die methodischen Ansätze, die Bedeutung der politischen Bildung und die Zukunftsperspektiven für die Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Politikwissenschaft eine „alte“ oder eine „junge“ Disziplin?
Sie ist beides: Als Teil der praktischen Philosophie (Antike/Mittelalter) ist sie sehr alt, als eigenständige, moderne Sozialwissenschaft jedoch relativ jung.
Mit welchen Vorurteilen hat die Politikwissenschaft zu kämpfen?
Oft wird sie als „politisierte“ Wissenschaft wahrgenommen, oder es wird fälschlicherweise angenommen, dass alle Politikwissenschaftler selbst Politiker werden wollen.
Was ist die Aufgabe von Politikwissenschaftlern?
Sie betrachten Politik wissenschaftlich, helfen zu planen, zu prognostizieren, zu erklären und Politik kritisch zu optimieren.
Warum wird Politikwissenschaft oft nicht als „normale“ Wissenschaft gesehen?
Dies liegt oft an der Vermischung der Welten von Politik und Wissenschaft im öffentlichen Bewusstsein, was zu Misstrauen führen kann.
Welche Rolle spielte die praktische Philosophie für die Politikwissenschaft?
In der Antike und im Mittelalter war die Beschäftigung mit dem Staat und dem richtigen Handeln (Ethik/Politik) ein fester Bestandteil der Philosophie.
Was macht die Politikwissenschaft heute zu einer echten Wissenschaft?
Sie verfügt über methodische Grundlagen, klare Voraussetzungen für wissenschaftliches Denken und ein spezifisches Profil, das sie von der rein praktischen Politik abgrenzt.
- Quote paper
- Alexander Schwalm (Author), 2012, Die Geschichte der Politikwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191288