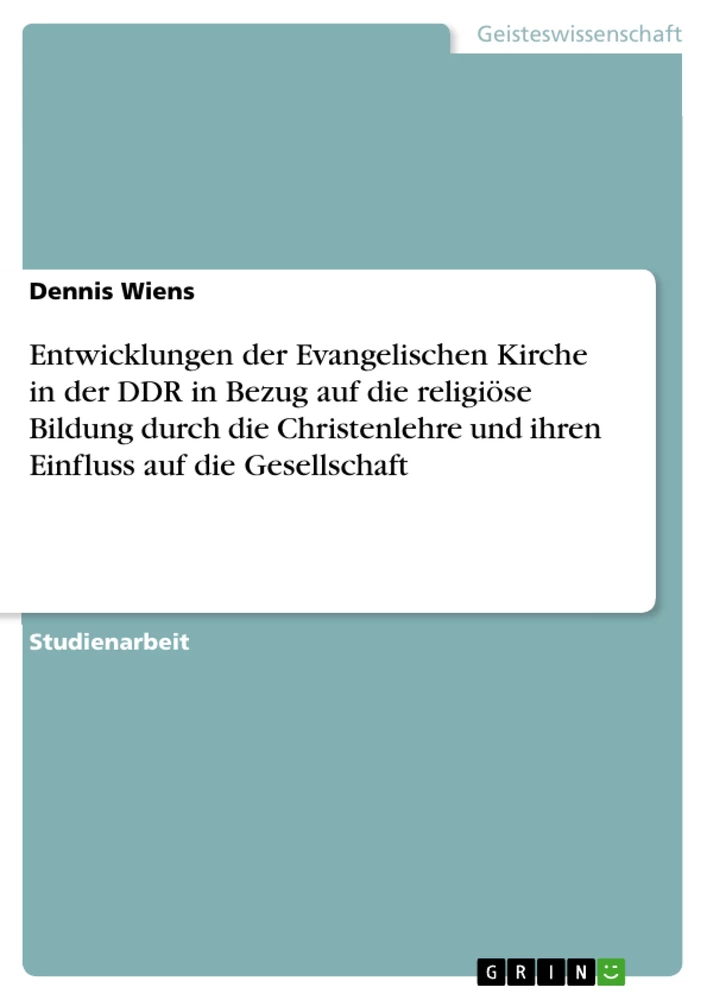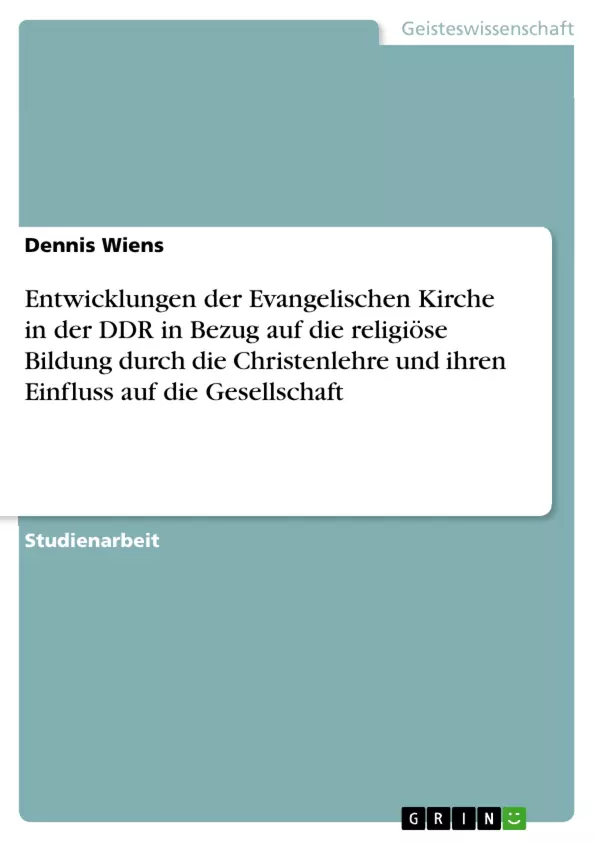Diese Arbeit versucht unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Evangelischen Kirche in der DDR und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Familien die Situation der Kinder, die die Christenlehre in der DDR besuchten deutlich zu machen. Dazu wird folgendermaßen vorgegangen:
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Abkürzungsverzeichnis
3. Ein Überblick
4. Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR
4.1. Junge Gemeinde
4.2. Jugendweihe
5. Kommunistische Erziehung
5.1. Familie
5.2. Freie deutsche Jugend (FDJ)
5.3. Ziele
6. Das Schulwesen
6.1. Religiöse Bildung
6.1.1. Religionsunterricht - Christenlehre
6.1.2. Negative Folgen
6.2. Katechumenat
7. Fazit
8. Verzeichnis der Quellen
9. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abkürzungsverzeichnis
- Ein Überblick
- Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR
- Junge Gemeinde
- Jugendweihe
- Kommunistische Erziehung
- Familie
- Freie deutsche Jugend (FDJ)
- Ziele
- Das Schulwesen
- Religiöse Bildung
- Religionsunterricht - Christenlehre
- Negative Folgen
- Katechumenat
- Religiöse Bildung
- Fazit
- Verzeichnis der Quellen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle und den Einfluss der Christenlehre im Schulwesen der DDR. Ziel ist es, die historische Entwicklung und das Verhältnis zwischen Kirche und Staat im Kontext der kommunistischen Erziehung zu beleuchten.
- Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR
- Die Bedeutung der Jungen Gemeinde und ihrer Unterdrückung
- Einführung und Bedeutung der Jugendweihe
- Einfluss der Christenlehre auf die religiöse Bildung in der DDR
- Schwierigkeiten und Herausforderungen der Christenlehre im Schulwesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung bietet einen kurzen Überblick über das Thema und die Relevanz der Christenlehre im Schulwesen der DDR. Sie stellt die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit dar.
- Ein Überblick: Dieses Kapitel bietet einen chronologischen Überblick über wichtige Ereignisse in der Geschichte der Christenlehre im DDR-Schulsystem, von 1946 bis 1989.
- Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR: Dieses Kapitel untersucht das Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR. Es beleuchtet die Rolle der Jungen Gemeinde als Zielscheibe der Unterdrückung und die Einführung der Jugendweihe als Gegenmaßnahme zur kirchlichen Jugendarbeit.
- Kommunistische Erziehung: Dieses Kapitel untersucht die Strategien der kommunistischen Erziehung im Kontext der DDR, mit Schwerpunkt auf die Rolle der Familie, der FDJ und der Ziele der staatlichen Erziehung.
- Das Schulwesen: Dieses Kapitel analysiert das Schulwesen in der DDR, mit besonderem Fokus auf die religiöse Bildung. Es betrachtet die Auswirkungen der Christenlehre auf den Religionsunterricht und beleuchtet die Herausforderungen der kirchlichen Arbeit in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Christenlehre im Schulwesen der DDR. Zu den wichtigen Schlüsselbegriffen zählen die Beziehungen zwischen Kirche und Staat, die Rolle der Jungen Gemeinde und der Jugendweihe, die kommunistische Erziehung, der Religionsunterricht und die Herausforderungen der kirchlichen Arbeit im Kontext des sozialistischen Schulsystems.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Christenlehre in der DDR?
Die Christenlehre war der kirchliche Religionsunterricht für Kinder in der DDR, der außerhalb des staatlichen Schulsystems organisiert werden musste.
Wie war das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR?
Das Verhältnis war von Spannungen und staatlicher Unterdrückung geprägt, da das sozialistische Regime einen atheistischen Erziehungsauftrag verfolgte.
Welche Rolle spielte die Jugendweihe als Konkurrenz zur Kirche?
Die staatlich eingeführte Jugendweihe diente als sozialistisches Gegenstück zur Konfirmation und wurde massiv gefördert, um den Einfluss der Kirche auf Jugendliche zu brechen.
Was war die „Junge Gemeinde“?
Die Junge Gemeinde war die Jugendorganisation der evangelischen Kirche, die in den 1950er Jahren massiven staatlichen Verfolgungen und Diskriminierungen ausgesetzt war.
Welche negativen Folgen hatte der Besuch der Christenlehre für Kinder?
Kinder, die die Christenlehre besuchten, sahen sich oft Benachteiligungen in der Schule ausgesetzt, wie etwa Schwierigkeiten bei der Zulassung zur Erweiterten Oberschule (EOS) oder zum Studium.
Was versteht man unter „kommunistischer Erziehung“?
Es war das staatliche Ziel, Kinder und Jugendliche im Sinne der marxistisch-leninistischen Ideologie zu formen, wobei Organisationen wie die FDJ eine zentrale Rolle spielten.
- Arbeit zitieren
- Dennis Wiens (Autor:in), 2012, Entwicklungen der Evangelischen Kirche in der DDR in Bezug auf die religiöse Bildung durch die Christenlehre und ihren Einfluss auf die Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191324