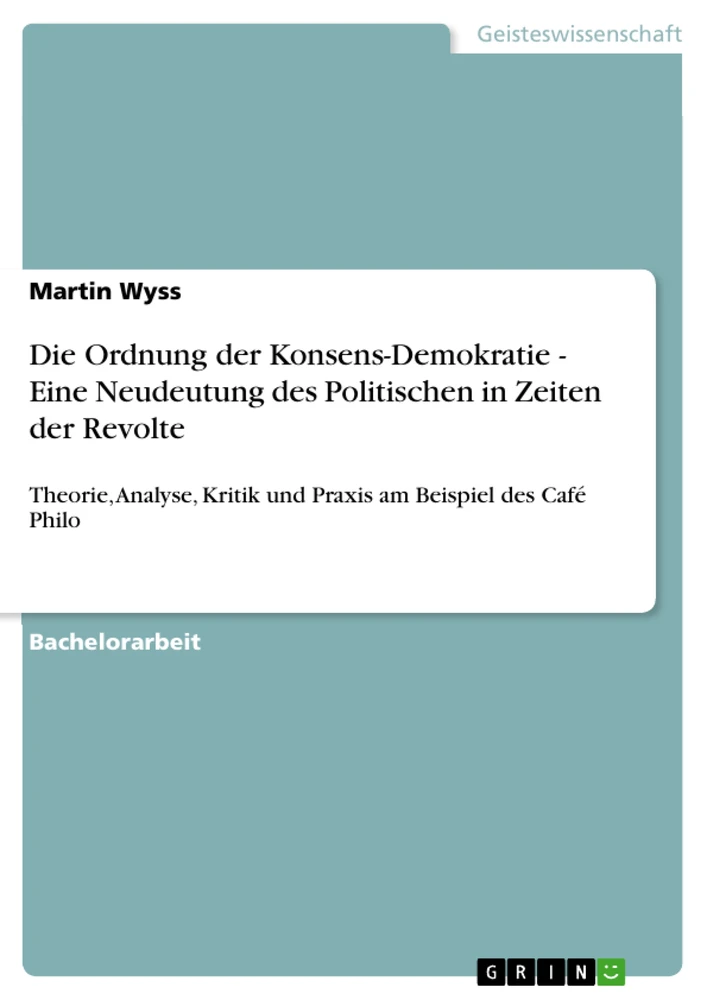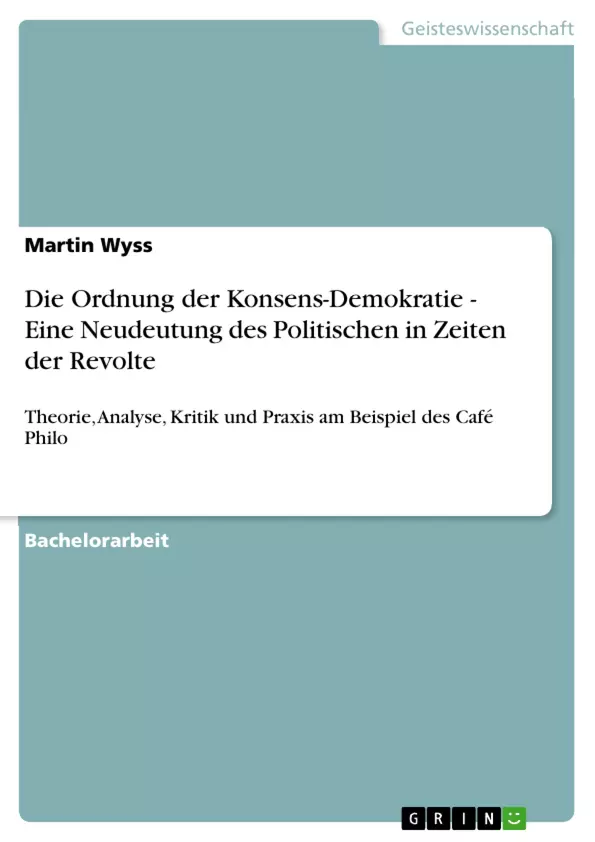Im Anschluss an Jürgen Habermas' Buch über den Strukturwandel der Öffentlichkeit befasst siche diese Arbeit im Kern mit dem jenem Verständnis von Öffentlichkeit zugrundeliegenden politischen Subjekt. Bevor dieses in einem postdemokratischen Sinn analysiert werden kann, soll es zunächst nachgezeichnet und als bürgerliches Konzept entlarvt werden. Dem Habermasschen Demokratieverständnis als Konsens-Demokratie soll die von Rancière herausgearbeitete Funktion des Dissens' entgegengehalten werden. Denn nur mithilfe dessen kann Demokratie im Innersten dynamisch und somit demokratisch bleiben. An diese Kritik anschliessend wird das Café Philo als öffentliche philosophische Debatte eingeführt und ihr in diesem Sinne demokratisches Potenzial aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept bürgerlicher Öffentlichkeit
- Die Refeudalisierung der Politik
- Das Fundament der Habermas'schen Demokratie
- Der Begriff des Politischen
- Das politische Subjekt
- Politik als Unterbrechung der Logik der arche
- Die Bedingung der Möglichkeit des Politischen
- Die Figur des Dritten
- Die Tautologie der politischen Philosophie
- Philosophische Debatte
- Bei Sokrates zum Kaffee
- Résumé
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Konzept der bürgerlichen Öffentlichkeit im Kontext der Refeudalisierung der Politik. Sie untersucht die Entstehung, Entwicklung und den Verfall der modernen bürgerlichen Öffentlichkeit und setzt sich kritisch mit dem Habermas'schen Konzept auseinander. Darüber hinaus wird der Begriff des Politischen neu gefasst, um die Auswirkungen auf die Mechanismen der öffentlichen Meinungsbildung und die Gestaltung demokratischer Diskurse zu beleuchten.
- Die Refeudalisierung der Politik und ihre Auswirkungen auf die bürgerliche Öffentlichkeit
- Kritik am Habermas'schen Konzept der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Der Begriff des Politischen und seine Bedeutung für die demokratische Meinungsbildung
- Die Rolle des politischen Subjekts in der öffentlichen Sphäre
- Die Gestaltung eines dialogischen Modells der politischen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der Seminararbeit ein und setzt den Kontext mit aktuellen Ereignissen und Krisen in Verbindung. Sie stellt die Problematik der Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen dar und verweist auf verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs „Öffentlichkeit“.
- Das Konzept bürgerlicher Öffentlichkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und den Verfall der modernen bürgerlichen Öffentlichkeit im Anschluss an Jürgen Habermas' Strukturwandel der Öffentlichkeit. Es untersucht die Refeudalisierung der Politik und deren Auswirkungen auf die Öffentlichkeit.
- Die Refeudalisierung der Politik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Refeudalisierung der Politik als zentrales Problem für die Habermas'sche Demokratie. Es analysiert die Veränderungen in der politischen Sphäre und ihre Konsequenzen für die öffentliche Meinungsbildung.
- Das Fundament der Habermas'schen Demokratie: In diesem Kapitel wird das Fundament der Habermas'schen Demokratie auf Basis seiner Theorie der bürgerlichen Öffentlichkeit untersucht. Es werden die Grundprinzipien und die Bedeutung des politischen Diskurses beleuchtet.
- Der Begriff des Politischen: Dieses Kapitel stellt eine kritische Analyse des Habermas'schen Begriffs des Politischen dar und führt einen alternativen Begriff ein. Es untersucht die Bedeutung des Politischen für die demokratische Meinungsbildung und die Gestaltung von öffentlichen Diskursen.
- Das politische Subjekt: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des politischen Subjekts in der öffentlichen Sphäre. Es untersucht die Bedingungen und Herausforderungen für die politische Partizipation und die Gestaltung von politischem Handeln.
- Politik als Unterbrechung der Logik der arche: Dieses Kapitel behandelt die politische Unterbrechung als ein zentrales Element des Politischen. Es analysiert, wie Politik die herkömmliche Ordnung und Denkweise in Frage stellt und alternative Perspektiven eröffnet.
- Die Bedingung der Möglichkeit des Politischen: Dieses Kapitel untersucht die Bedingungen, die für die Möglichkeit des Politischen notwendig sind. Es beleuchtet die Bedeutung von Freiheit, Pluralität und dem Streit der Meinungen.
- Die Figur des Dritten: Dieses Kapitel fokussiert auf die Rolle des „Dritten“ im politischen Diskurs. Es analysiert, wie der „Dritte“ als ein Element der politischen Differenz und des politischen Streits fungiert.
- Die Tautologie der politischen Philosophie: Dieses Kapitel reflektiert über die Tautologie der politischen Philosophie. Es analysiert die Paradoxien und Grenzen der politischen Theoriebildung.
- Philosophische Debatte: Dieses Kapitel präsentiert eine philosophische Debatte über die Thematik der Seminararbeit. Es werden verschiedene Perspektiven und Positionen diskutiert.
- Bei Sokrates zum Kaffee: Dieses Kapitel vertieft die philosophische Debatte mit einem konkreten Beispiel. Es analysiert die politische Dimension eines fiktiven Gesprächs mit Sokrates.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie bürgerliche Öffentlichkeit, Refeudalisierung der Politik, Habermas'sches Konzept, politisches Subjekt, politische Unterbrechung, politische Differenz, Tautologie der politischen Philosophie und dem Streit der Meinungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Refeudalisierung der Politik" nach Habermas?
Es beschreibt den Verfall der bürgerlichen Öffentlichkeit, bei dem politische Entscheidungen wieder hinter verschlossenen Türen statt durch öffentlichen Diskurs getroffen werden.
Welche Kritik übt Rancière an der Konsens-Demokratie?
Rancière betont die Funktion des Dissens': Nur durch den Streit und die Unterbrechung der bestehenden Ordnung bleibt eine Demokratie lebendig.
Was ist ein "Café Philo"?
Es ist eine öffentliche philosophische Debatte, die als Modell für demokratisches Potenzial und dialogische Kommunikation eingeführt wird.
Wer ist das "politische Subjekt"?
Die Arbeit analysiert das bürgerliche Konzept des Subjekts und stellt es in den Kontext postdemokratischer Entwicklungen.
Was ist die "Tautologie der politischen Philosophie"?
Ein Kapitel der Arbeit reflektiert über die Paradoxien und Grenzen bei der Bildung politischer Theorien.
- Quote paper
- Martin Wyss (Author), 2011, Die Ordnung der Konsens-Demokratie - Eine Neudeutung des Politischen in Zeiten der Revolte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191351