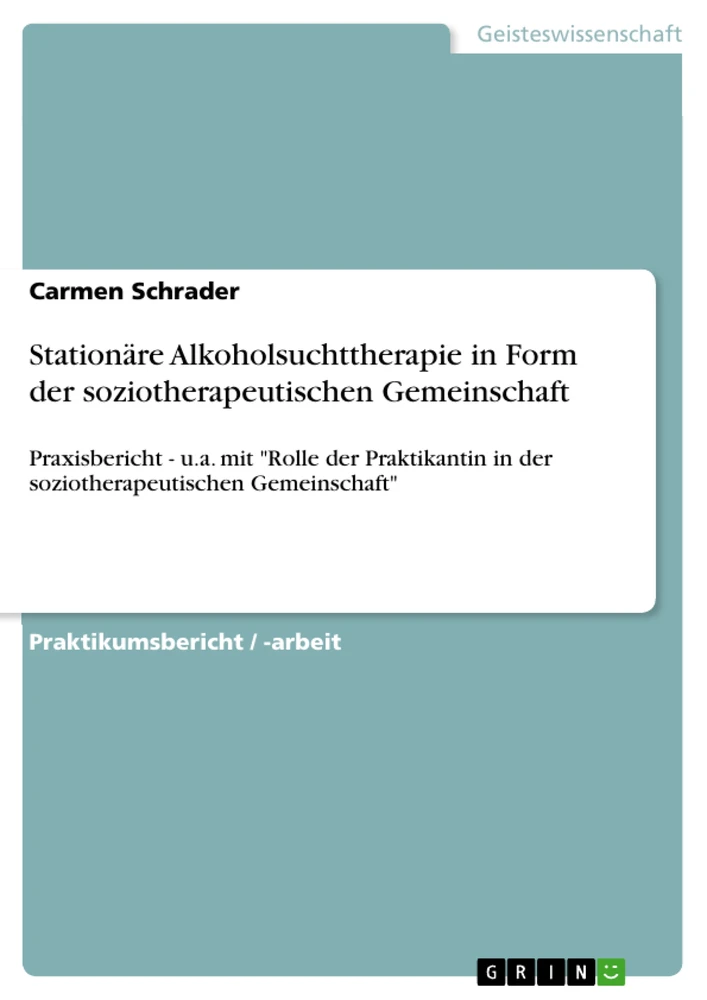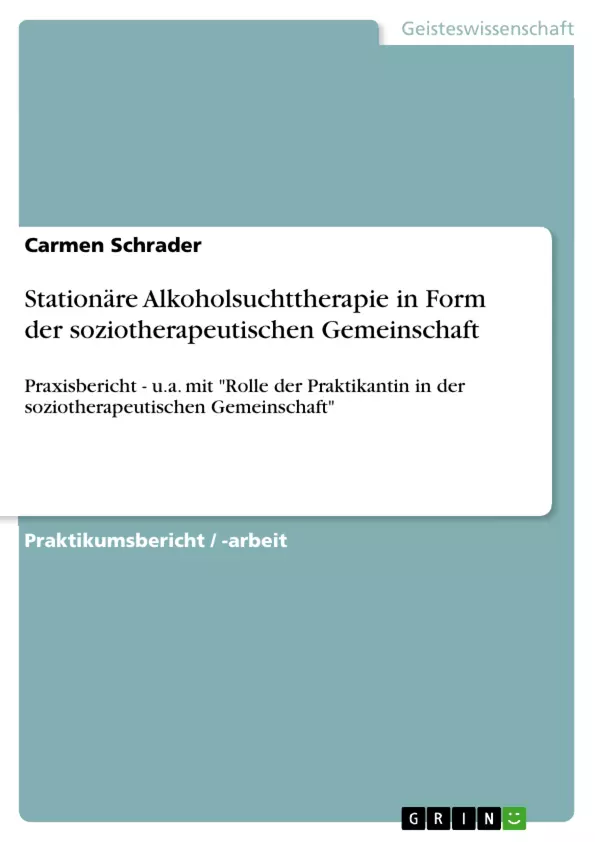Leseprobe:
Alkohol wird getrunken zu geselligen Anlässen, Festen und Feiern, als kleine „Besonderheit“ im Alltag (z.B. Feierabendbier, Wein zur Lieblingsserie, Sekt zum Anstoßen auf den erledigten Frühjahrsputz) oder wenn man Probleme hat und Entspannung sucht. Ob das eigene Trinkverhalten noch als normal gilt, ist schwer einzuschätzen. Solange man in geselliger Runde trinkt, wird einem kaum jemand sagen, dass man übertreibt.
Unsere Trinkkultur bietet leider beste Voraussetzungen für die Entstehung einer Alkoholabhängigkeit. Die Krankheit kommt meist schleichend, oft auch unbewusst. Erst nach mehreren Jahren des regelmäßigen Konsums, wird ein Punkt erreicht, an dem die KonsumentInnen feststellen, dass sie nicht mehr ohne die Droge Alkohol auskommen. Und dann ist es meist zu spät.
In Deutschland leben ungefähr 1,3 Millionen alkoholabhängige Menschen. Weitere zirka 2,0 Millionen Deutsche betreiben Alkoholmissbrauch und zusätzlich 10,4 Millionen werden als Risikokonsumenten gezählt. Die Übergänge der drei genannten Gruppen sind fließend und schwer abgrenzbar. Zudem haben insgesamt knapp 14 Millionen Menschen ein gewagtes bis krankhaftes Verhältnis zum Alkohol. Das wären circa 20 % der erwachsenen Deutschen. Diese Zahlen bestätigen den Eindruck, dass Alkohol in Deutschland ein gesellschaftliches Problem ist und folglich als gängigste Einstiegsdroge gilt.
Wenn jemand alkoholabhängig ist, dann braucht er/sie Hilfe um ein selbstbestimmtes Leben ohne Alkohol zu führen. Doch welche Therapiemöglichkeiten gibt es heutzutage?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Benennung des Handlungsfeldes „Alkoholsuchttherapie“
- 2.1 Stationäre Alkoholsuchttherapie in Form der soziotherapeutischen Gemeinschaft
- 3 Beschreibung der Institution
- 3.1 Rechtliche Grundlagen
- 3.2 Finanzierung
- 3.3 AdressatInnen, Ziele und Angebote
- 3.4 Organisationsstruktur und personelle Ausstattung
- 3.5 Konzept
- 4 Beschreibung der eigenen Tätigkeit
- 4.1 Eigene Aufgaben
- 4.2 Anleitung
- 5 Rolle der Praktikantin in der soziotherapeutischen Gemeinschaft
- 6 Allgemeine Auswertung und Reflexion
- 6.1 Verhältnis zu Kolleginnen, Zusammenarbeit und Interdependenzen
- 6.2 Rückblickende Betrachtung der gesetzten Ziele
- 6.2.1 Instrumentelle Kompetenzen
- 6.2.1 Reflexive Kompetenzen
- 6.2.1 Soziale Kompetenzen
- 6.3 Abschließende Beurteilung eigener Erfolge und Schwierigkeiten
- 7 Fazit
- 8 Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Praxisbericht beleuchtet die stationäre Alkoholsuchttherapie in Form der soziotherapeutischen Gemeinschaft. Er beschreibt die Arbeitsweise einer solchen Einrichtung, die Rolle der Praktikantin innerhalb des Teams und die Herausforderungen, die mit der Arbeit mit alkoholabhängigen Menschen verbunden sind. Der Bericht dient als Reflexion des Praktikums und soll die erlernten Erfahrungen aus Theorie und Praxis in Bezug setzen.
- Soziotherapeutische Gemeinschaft als Therapieform
- Die Rolle der Praktikantin in der stationären Alkoholsuchttherapie
- Herausforderungen und Chancen der Arbeit mit alkoholabhängigen Menschen
- Theorie-Praxis-Transfer im Bereich der Sozialen Arbeit
- Entwicklung professioneller Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Alkoholsucht ein und skizziert die gesellschaftliche Relevanz des Themas. Kapitel 2 beschreibt die stationäre Alkoholsuchttherapie in Form der soziotherapeutischen Gemeinschaft als eine konkrete Therapieform. Kapitel 3 stellt die Institution vor, in der das Praktikum stattfand, und beleuchtet deren rechtliche Grundlagen, Finanzierung, Adressaten, Ziele und Angebote, Organisationsstruktur, personelle Ausstattung sowie das Konzept der Einrichtung. Kapitel 4 beschreibt die eigenen Tätigkeiten der Praktikantin im Sozialdienst der Suchttherapieeinrichtung. Kapitel 5 reflektiert die Rolle der Praktikantin innerhalb der soziotherapeutischen Gemeinschaft und die Herausforderungen und Chancen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Kapitel 6 beinhaltet eine allgemeine Auswertung und Reflexion des Praktikums, wobei das Verhältnis zu den Kolleginnen, die Zusammenarbeit und Interdependenzen sowie die Entwicklung der eigenen Kompetenzen im Vordergrund stehen. Abschließend zieht das Fazit eine persönliche Bilanz des Praktikums und blickt auf die berufliche Zukunft.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Praxisberichts sind: Alkoholsucht, stationäre Alkoholsuchttherapie, soziotherapeutische Gemeinschaft, Suchttherapieeinrichtung, Sozialdienst, Praktikum, Reflexion, Theorie-Praxis-Transfer, professionelle Kompetenzen, Zusammenarbeit, Interdependenzen, Ressourcen, Empowerment, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine soziotherapeutische Gemeinschaft?
Es handelt sich um eine stationäre Therapieform für alkoholsüchtige Menschen, die auf das soziale Miteinander, Alltagsstrukturierung und die Förderung der Selbstbestimmung setzt.
Wie viele Menschen sind in Deutschland von Alkoholproblemen betroffen?
Etwa 1,3 Millionen Menschen gelten als abhängig, weitere 2 Millionen betreiben Missbrauch und über 10 Millionen zeigen einen riskanten Konsum.
Wer finanziert die stationäre Alkoholsuchttherapie?
Die Finanzierung erfolgt in der Regel über die Rentenversicherungsträger oder die Sozialhilfeträger, basierend auf gesetzlichen Grundlagen des SGB.
Welche Rolle spielt der Sozialdienst in der Therapieeinrichtung?
Der Sozialdienst unterstützt die Klienten bei administrativen Angelegenheiten, der Nachsorgeplanung, der beruflichen Reintegration und der psychosozialen Beratung.
Was sind die Ziele einer soziotherapeutischen Behandlung?
Hauptziele sind die Abstinenzsicherung, die psychische Stabilisierung, der Aufbau sozialer Kompetenzen und die Befähigung zu einem eigenverantwortlichen Leben.
- Quote paper
- Carmen Schrader (Author), 2012, Stationäre Alkoholsuchttherapie in Form der soziotherapeutischen Gemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191389