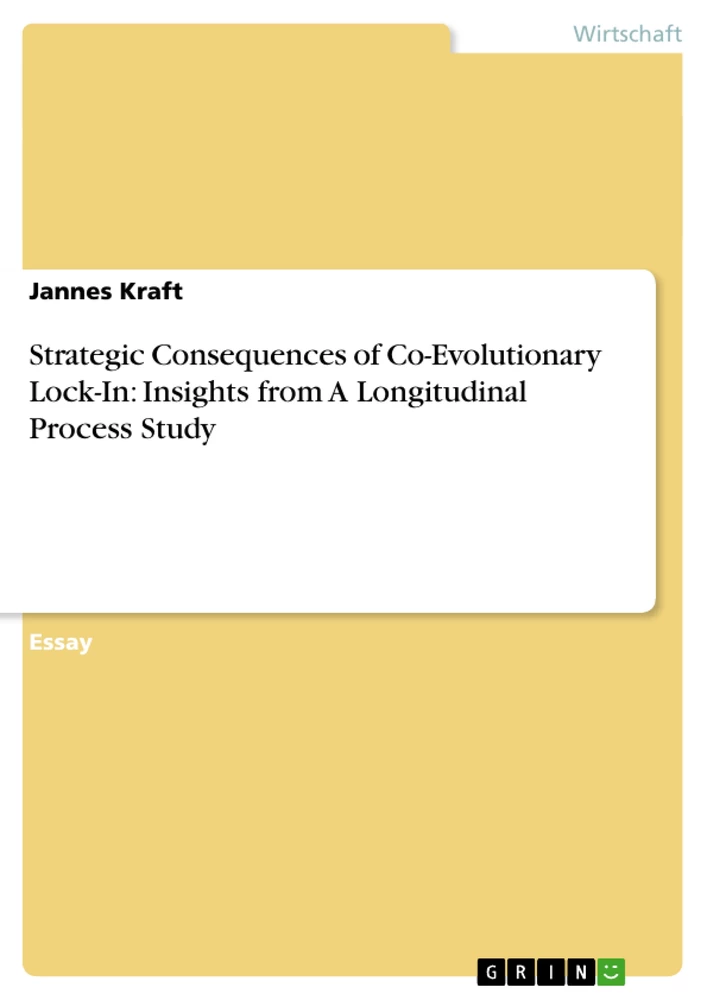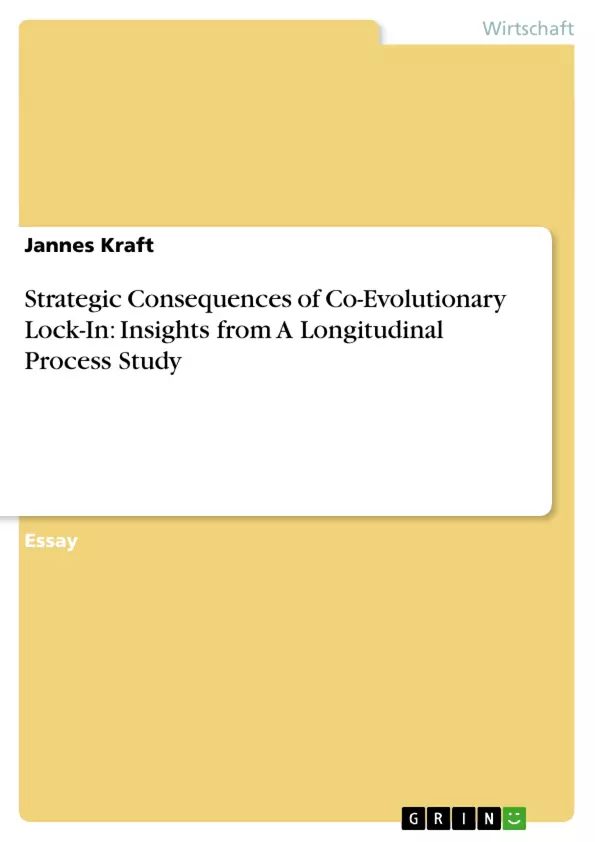In this paper we want to review the article of Burgelman (2008): Strategic Consequences of Co-Evolutionary Lock-In: Insights from A Longitudinal Process Study. Starting by briefly stating the essential insights from this article, we will then continue with a critique on the main statements of Burgelman and his article in general. Finally, we will discuss possible implications of the concept of coevolutionary
lock-in and introduce the case of General Motors as another example where the concept of coevolutionary lock-in might be suitable.
Inhaltsverzeichnis
- Intel und das Phänomen des coevolutionären Lock-ins
- Die Kernaussagen der Studie
- Das interne Ökologie-Modell
- Schlussfolgerung
- Diskussion und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Artikel befasst sich mit dem Phänomen des coevolutionären Lock-ins, das durch die Interaktion von Unternehmensentscheidungen und Marktentwicklungen entsteht. Der Artikel untersucht das Fallbeispiel von Intel unter der Führung von Andy Grove, um zu zeigen, wie ein Unternehmen durch eine enge Fokussierung auf seinen Kerngeschäftsbereich in eine Abhängigkeitssituation geraten kann, die es daran hindert, neue Geschäftsbereiche zu erschließen.
- Das Paradox von Macht und Autonomie
- Die Auswirkungen der Erfolgsspirale auf die strategische Entscheidungsfindung
- Das interne Ökologie-Modell und seine Bedeutung für die strategische Anpassungsfähigkeit
- Die Folgen des coevolutionären Lock-ins und die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen induzierten und autonomen strategischen Prozessen zu schaffen
- Kritik an der Methodik und dem Modell des Autors
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Artikel beginnt mit einer Beschreibung des coevolutionären Lock-ins anhand des Fallbeispiels von Intel. Intel, unter der Führung von Andy Grove, entwickelte sich zu einem dominanten Unternehmen im Mikroprozessorbereich, wurde aber gleichzeitig stark von diesem Marktsegment abhängig. Die enge Fokussierung auf den Mikroprozessormarkt führte zu einer Reihe von Herausforderungen, die im weiteren Verlauf des Artikels näher beleuchtet werden.
- Der Artikel identifiziert mehrere Faktoren, die zum coevolutionären Lock-in von Intel beigetragen haben. Diese Faktoren umfassen das Paradox von Macht und Autonomie, die Auswirkungen des Erfolgs auf die strategische Entscheidungsfindung sowie die begrenzte Aufmerksamkeit für neue Geschäftsbereiche außerhalb des Kerngeschäfts.
- Der Artikel stellt das interne Ökologie-Modell vor, das die strategische Anpassungsfähigkeit von Unternehmen aus der Perspektive der internen Organisation betrachtet. Das interne Ökologie-Modell legt nahe, dass Unternehmen neue Geschäftsbereiche entwickeln und etablierte, aber nicht mehr erfolgreiche Projekte einstellen sollten, um sich an die sich verändernde Umwelt anzupassen. Im Fall von Intel wird jedoch argumentiert, dass das Unternehmen aufgrund seiner Fokussierung auf den Kerngeschäftsbereich keine funktionale interne Ökologie aufgebaut hat, was zu einer Verringerung seiner langfristigen Anpassungsfähigkeit führte.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen coevolutionärer Lock-in, strategische Entscheidungsfindung, interne Ökologie, path dependency, induzierte und autonome strategische Prozesse, Unternehmenserfolg und Anpassungsfähigkeit. Der Artikel untersucht die Auswirkungen der Erfolgsspirale auf die strategische Entscheidungsfindung und die Herausforderungen, die sich für Unternehmen ergeben, wenn sie versuchen, sich von einem engen Fokus auf ihr Kerngeschäft zu lösen. Die Schlüsselbegriffe des Artikels umfassen coevolutionärer Lock-in, interne Ökologie, strategische Inertie, path dependency, induzierte und autonome Strategien sowie Ambidextrous Organization.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein coevolutionärer Lock-in?
Es beschreibt eine Situation, in der ein Unternehmen durch die enge Kopplung seiner Entscheidungen an einen spezifischen Markterfolg (z. B. Mikroprozessoren bei Intel) die Fähigkeit verliert, in andere Bereiche zu diversifizieren.
Welches Fallbeispiel wird in der Studie analysiert?
Die Studie untersucht die strategische Entwicklung von Intel unter der Führung von Andy Grove.
Was besagt das interne Ökologie-Modell?
Das Modell legt nahe, dass Unternehmen intern neue Projekte fördern und erfolglose einstellen sollten, um anpassungsfähig zu bleiben. Ein Lock-in behindert diesen Prozess.
Was ist das Paradox von Macht und Autonomie?
Obwohl ein Unternehmen in seinem Kernmarkt mächtig ist, verliert es die Autonomie, strategisch unabhängig von diesem Markt zu agieren.
Wie wirkt sich die Erfolgsspirale auf Entscheidungen aus?
Großer Erfolg im Kerngeschäft führt oft zu strategischer Trägheit (Inertia), da Ressourcen und Aufmerksamkeit fast ausschließlich dorthin fließen.
- Arbeit zitieren
- Jannes Kraft (Autor:in), 2011, Strategic Consequences of Co-Evolutionary Lock-In: Insights from A Longitudinal Process Study, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191497