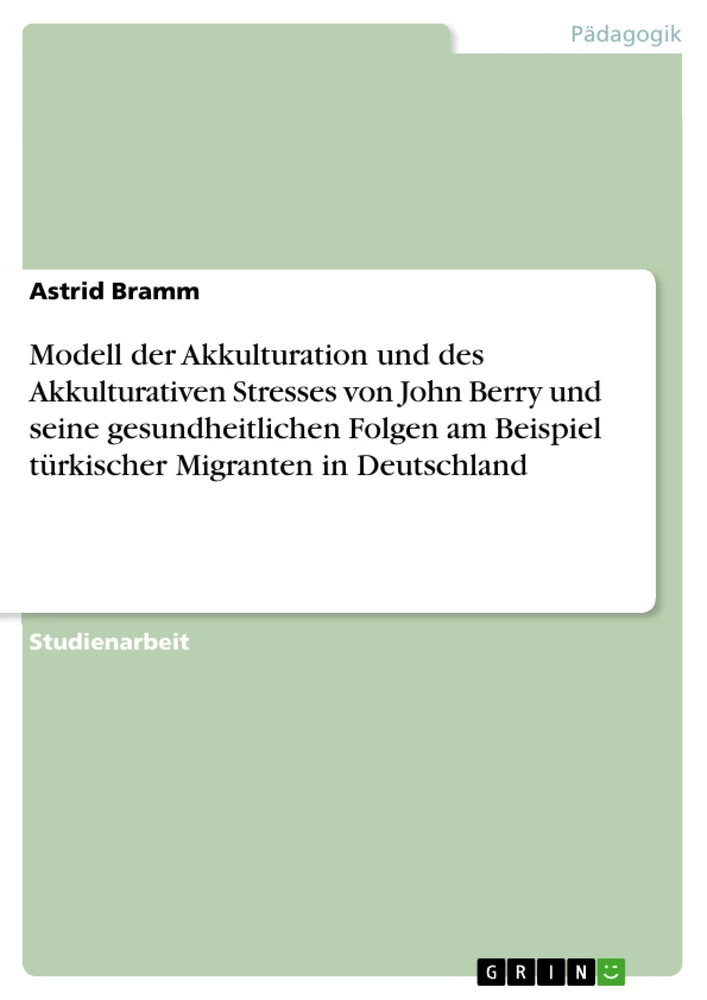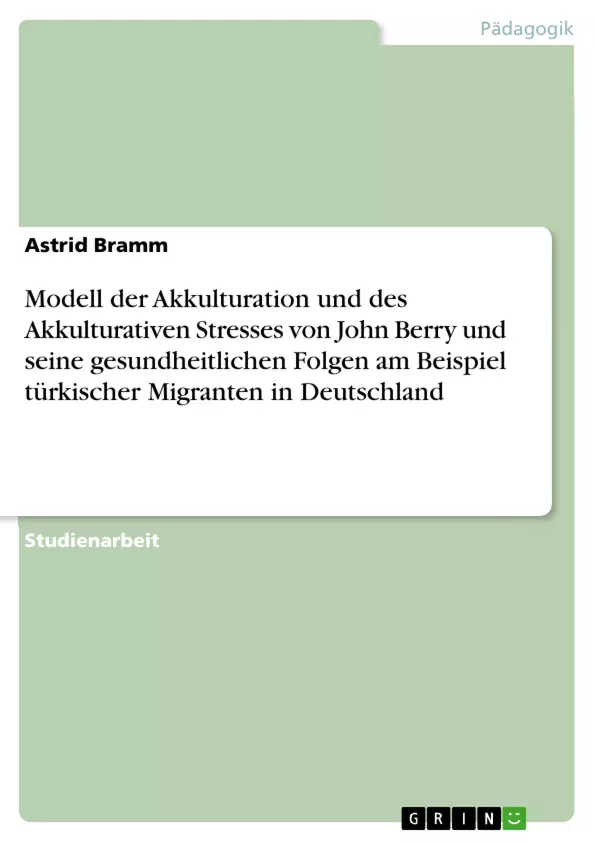Im Zuge meiner Recherchen über den Zusammenhang zwischen Migration, verschiedenen Akkulturationsstrategien und psychischem Stress bei Migranten wurde John Berrys Modell besonders häufig in der Literatur erwähnt und ich beschloss daher, mich mit seinem Modell näher auseinanderzusetzen. Im Laufe meiner Beschäftigung mit psychischem Stress ist mir dabei auch das erschreckende Ausmaß der Krankheitsrate türkischer Mitbürger in Deutschland immer stärker ins Blickfeld gerückt. Daraufhin haben sich mir folgende Fragen gestellt: Was bedeutet Akkulturation?Welche unterschiedlichen Strömungen der theoretischen Modelle über Akkulturation gibt es? Wie kann ich das bekannteste Modell von John Berry in diese einordnen? Wie sieht sein Modell über Akkulturationsstrategien und akkulturativen Stress bei Migranten aus? Welche Auswirkungen hat akkulturativer Stress auch auf die Gesundheit türkischer Migranten in Deutschland? Hat Berrys Ansatz allgemeine Gültigkeit oder wird er auch kritisiert?Dementsprechend kam ich zu meinem Forschungsgegenstand: Das Modell der Akkulturation und des akkulturativen Stresses von John Berry und seine gesundheitlichen Folgen am Beispiel türkischer Migranten in Deutschland. Zunächst möchte ich die Begriffe „Akkulturation“,„Assimilation“ und „Integration voneinander differenzieren, um danach einen Überblick über unterschiedliche Akkulturationsansätze zu geben und anschließend das Vier-Felder-Modell von John Berry in diesen Zusammenhang einzuordnen und zu erklären. Nach einer Eingliederung von Berrys Modell des akkulturativen Stresses in einen Gesamtzusammenhang werde ich auf sein Verständnis von akkulturativem Stress genauer eingehen und sein psychologisches Modell erläutern.
Schließlich versuche ich die Folgen von akkulturativem Stress am Krankheitsbild türkischer Migranten in Deutschland zu untersuchen. Ich differenziere dabei zwischen psychischen und physischen Krankheiten, wobei mir im Laufe meiner Arbeit klar geworden ist, dass der Übergang zwischen beiden fließend verläuft. Ich versuche mit dieser Arbeit einen groben Überblick über Berrys Modell der Akkulturation und die Folgen akkulturativen Stresses zu geben. Dabei versuche ich unwesentliche Details außer Acht zu lassen, da diese den hier gegebenen Rahmen sprengen würden, sondern bemühe mich, die Strukturen und ihre Zusammenhänge so gut wie möglich zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 3. Akkulturationstheorien
- 3.1 Entstehung und Vielfalt von Akkulturationsmodellen
- 3.2 Akkulturationstheorien von John W. Berry
- 4. Psychologische Akkulturation
- 4.1 Einordnung des Akkulturations-Stress-Modells von John W. Berry
- 4.2 Modell des akkulturativen Stresses nach John W. Berry
- 5. Gesundheitliche Folgen von akkulturativem Stress
- 5.1 Physische Erkrankungen der türkischen Migranten
- 5.2 Psychische Erkrankungen der türkischen Migranten
- 6. Schluss: Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Modell der Akkulturation und des akkulturativen Stresses von John Berry und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit türkischer Migranten in Deutschland. Die Arbeit analysiert zunächst den Begriff Akkulturation und differenziert ihn von Assimilation und Integration. Anschließend wird Berrys Modell im Kontext anderer Akkulturationstheorien eingeordnet und erläutert.
- Definition und Abgrenzung von Akkulturation, Assimilation und Integration
- Einordnung und Erklärung des Vier-Felder-Modells von John Berry
- Beschreibung des Modells des akkulturativen Stresses nach John Berry
- Analyse der gesundheitlichen Folgen akkulturativen Stresses bei türkischen Migranten
- Kritische Auseinandersetzung mit Berrys Modell
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage der Arbeit, die sich mit dem Modell der Akkulturation und des akkulturativen Stresses von John Berry und seinen gesundheitlichen Folgen am Beispiel türkischer Migranten in Deutschland auseinandersetzt. Die Autorin erläutert ihren Forschungsansatz und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Begriffsklärung über die Darstellung von Akkulturationstheorien bis hin zur Analyse der gesundheitlichen Folgen und einer kritischen Betrachtung von Berrys Modell reicht. Die Motivation der Autorin, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wird durch die hohe Krankheitsrate türkischer Migranten in Deutschland begründet.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert und differenziert die zentralen Begriffe „Akkulturation“, „Assimilation“ und „Integration“. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur vorgestellt, die den Schwerpunkt auf den Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen und die daraus resultierenden Veränderungen legen. Die Autorin hebt die oft bestehende Verwechslung von Akkulturation und Assimilation hervor und betont den Unterschied zwischen der Angleichung an die Mehrheitskultur (Assimilation) und der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft (Integration). Der akkulturative Stress wird als eine häufige Begleiterscheinung von Akkulturation, besonders bei abrupten Prozessen, identifiziert.
3. Akkulturationstheorien: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Vielfalt der Akkulturationstheorien, die aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen entstanden sind. Es wird die große Bandbreite an Perspektiven und Ansätzen verdeutlicht, wobei die Autorin auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Grundannahmen verschiedener Theorien hinweist. Der Schwerpunkt liegt darauf, den Kontext für die Einordnung und Beschreibung des sozialpsychologischen Modells von John Berry zu schaffen.
Schlüsselwörter
Akkulturation, Assimilation, Integration, akkulturativer Stress, John Berry, Migranten, türkische Migranten, Deutschland, psychische Gesundheit, physische Gesundheit, Migrationsforschung, Kulturkontakt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Akkulturation und akkulturativen Stress bei türkischen Migranten
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Modell der Akkulturation und des akkulturativen Stresses von John Berry und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit türkischer Migranten in Deutschland. Sie analysiert den Begriff Akkulturation, differenziert ihn von Assimilation und Integration und erläutert Berrys Modell im Kontext anderer Akkulturationstheorien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Akkulturation, Assimilation und Integration; Einordnung und Erklärung des Vier-Felder-Modells von John Berry; Beschreibung des Modells des akkulturativen Stresses nach John Berry; Analyse der gesundheitlichen Folgen akkulturativen Stresses bei türkischen Migranten; Kritische Auseinandersetzung mit Berrys Modell.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung, Akkulturationstheorien (inkl. Entstehung und Vielfalt von Akkulturationsmodellen und Berrys Theorie), Psychologische Akkulturation (inkl. Einordnung und Beschreibung von Berrys Modell des akkulturativen Stresses), Gesundheitliche Folgen von akkulturativem Stress (inkl. physische und psychische Erkrankungen türkischer Migranten), und Schluss: Kritik.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse des Modells von John Berry und die Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Gesundheit türkischer Migranten in Deutschland. Die hohe Krankheitsrate dieser Gruppe dient als Motivation für die Arbeit.
Wie werden Akkulturation, Assimilation und Integration definiert und voneinander abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und differenziert diese Begriffe anhand verschiedener Definitionen aus der Literatur. Es wird der Unterschied zwischen der Angleichung an die Mehrheitskultur (Assimilation) und der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft (Integration) hervorgehoben. Akkulturation wird als der Prozess des Kontakts zwischen verschiedenen Kulturen und der daraus resultierenden Veränderungen definiert.
Wie wird Berrys Modell in der Arbeit dargestellt und eingeordnet?
Die Arbeit ordnet Berrys Modell im Kontext anderer Akkulturationstheorien ein und erläutert es detailliert. Das Vier-Felder-Modell und das Modell des akkulturativen Stresses nach Berry werden beschrieben und analysiert.
Welche gesundheitlichen Folgen akkulturativen Stresses werden bei türkischen Migranten untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl physische als auch psychische Erkrankungen türkischer Migranten im Zusammenhang mit akkulturativem Stress.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Akkulturation, Assimilation, Integration, akkulturativer Stress, John Berry, Migranten, türkische Migranten, Deutschland, psychische Gesundheit, physische Gesundheit, Migrationsforschung, Kulturkontakt.
Welche Kritik wird an Berrys Modell geübt?
Das Kapitel "Schluss: Kritik" enthält eine kritische Auseinandersetzung mit Berrys Modell, deren konkrete Inhalte aus dem bereitgestellten Text nicht hervorgehen.
- Quote paper
- M. A. Astrid Bramm (Author), 2008, Modell der Akkulturation und des Akkulturativen Stresses von John Berry und seine gesundheitlichen Folgen am Beispiel türkischer Migranten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191509