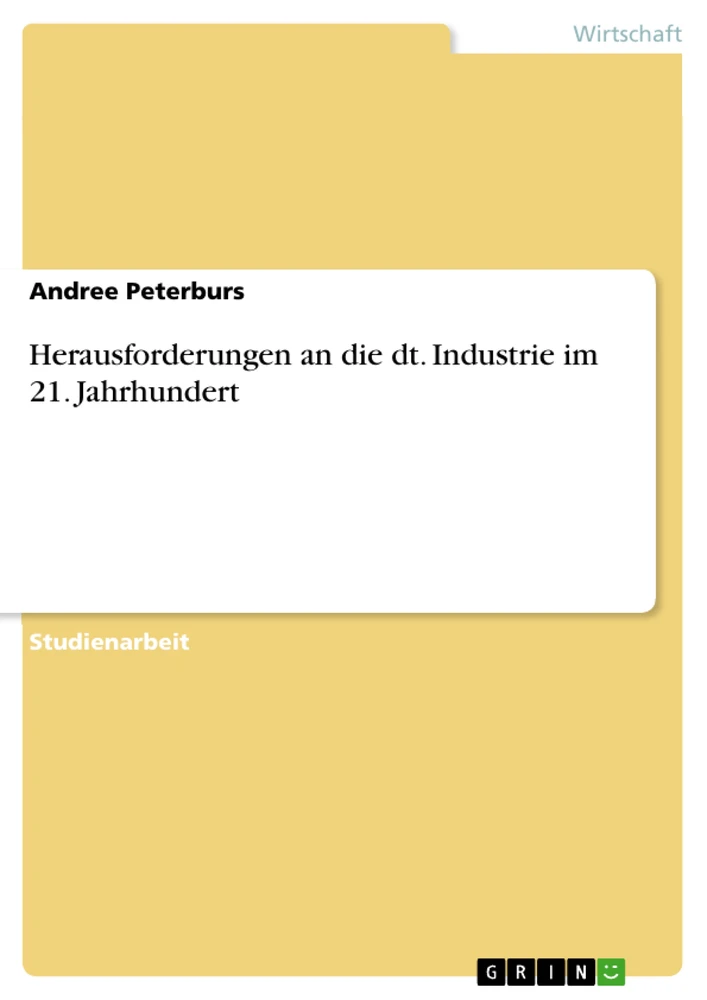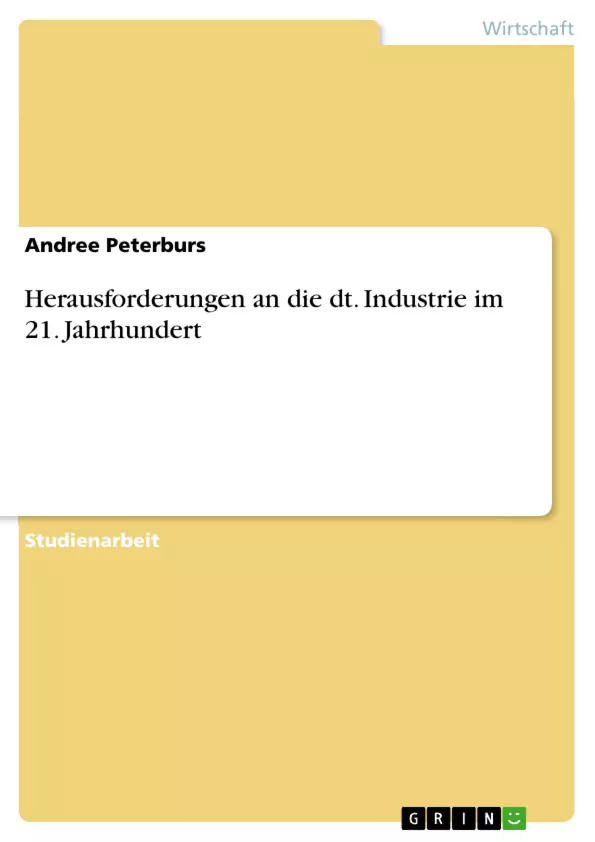Einleitung
Die deutsche Industrie sieht sich im 21. Jahrhundert mit zahlreichen Herausforderungen, wie dem demographischen Wandel, der Globalisierung, dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit, konfrontiert. In der vorliegenden Arbeit gelten die Herausforderungen Klimawandel und Ressourcenknappheit als Gegenstand der Untersuchung. Insbesondere soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die deutsche Industrie durch Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung sich diesen Herausforderungen erfolgreich stellen kann. Zunächst werden die infolge der Industrialisierung entstandenen globalen Umweltprobleme, die grundsätzlichen Ursachen für Verschmutzung und Übernutzung sowie die Folgen eines anthropogenen Klimawandels für die Ökosysteme und die Menschheit aufgezeigt. Im nächsten Schritt erfolgt eine Analyse der dt. Industrie, bei der insbesondere auf die Bedeutung des Außenhandels eingegangen wird, um zu untersuchen, in welcher Ausgangssituation sich die deutsche Industrie befindet, wie sie insgesamt aufgestellt ist und welches Potential vorhanden ist, um den Herausforderungen zu begegnen. Schließlich widmet sich die Arbeit dem Thema Nachhaltigkeit, wobei erst ein theoretisch einführender Abschnitt die Idee einer nachhaltigen Entwicklung beschreibt, um nachfolgend die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in den Unternehmen als Konzept zur Bewältigung der Herausforderungen im 21. Jahrhundert an ausgewählten Beispielen aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine Bestandsaufnahme
- Der Klimawandel und die Ressourcenknappheit
- Die Globalisierung und ihre Folgen
- Die deutsche Industrie
- Charakteristika der deutschen Industrie
- Die Bedeutung des Außenhandels
- Nachhaltigkeit als Herausforderung für das 21. Jahrhundert
- Idee und Begriff von Nachhaltigkeit
- Allgemeine Aspekte einer nachhaltigen Unternehmung
- Ausgewählte Bereiche und Instrumente für eine nachhaltige Unternehmung
- Produktion
- Nachhaltige Industrie- und Gewerbegebiete
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Herausforderungen, denen die deutsche Industrie im 21. Jahrhundert gegenübersteht. Der Fokus liegt dabei auf dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Die Arbeit untersucht, wie die deutsche Industrie durch eine nachhaltige Entwicklung diese Herausforderungen bewältigen kann.
- Die Folgen der Industrialisierung für die Umwelt
- Die Ursachen für Umweltverschmutzung und Übernutzung
- Die Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme und die Menschheit
- Die Bedeutung des Außenhandels für die deutsche Industrie
- Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für die deutsche Industrie vor, insbesondere den Klimawandel und die Ressourcenknappheit. Sie skizziert die Forschungsfrage, wie die deutsche Industrie durch eine nachhaltige Entwicklung diese Herausforderungen bewältigen kann.
- Eine Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel beleuchtet die Umweltprobleme, die durch die Industrialisierung entstanden sind. Es werden die Ursachen für Umweltverschmutzung und Übernutzung sowie die Folgen eines anthropogenen Klimawandels für die Ökosysteme und die Menschheit dargestellt.
- Die deutsche Industrie: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Industrie, insbesondere die Bedeutung des Außenhandels. Es untersucht die Ausgangssituation der deutschen Industrie und ihr Potential, um den Herausforderungen zu begegnen.
- Nachhaltigkeit als Herausforderung für das 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit. Es beschreibt die Idee einer nachhaltigen Entwicklung und zeigt die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in Unternehmen als Konzept zur Bewältigung der Herausforderungen im 21. Jahrhundert an.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Klimawandel, Ressourcenknappheit, Nachhaltigkeit, deutsche Industrie, Außenhandel, Umweltverschmutzung, Übernutzung, Ökosysteme, anthropogener Klimawandel.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Herausforderungen für die deutsche Industrie?
Die Arbeit nennt den Klimawandel, Ressourcenknappheit, Globalisierung und den demographischen Wandel als zentrale Faktoren.
Kann Nachhaltigkeit ein Wettbewerbsvorteil sein?
Ja, die Untersuchung zeigt auf, wie die Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung der deutschen Industrie helfen kann, globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Welche Rolle spielt der Außenhandel?
Der Außenhandel ist für die deutsche Industrie von enormer Bedeutung; die Arbeit analysiert das Potential der deutschen Exportwirtschaft im Kontext globaler Umweltprobleme.
Wie setzen Unternehmen nachhaltige Entwicklung konkret um?
Dies geschieht durch optimierte Produktionsprozesse, nachhaltige Industriegebiete und den Einsatz effizienter Ressourcen-Management-Instrumente.
Was sind die Folgen des anthropogenen Klimawandels für die Wirtschaft?
Die Arbeit beleuchtet die Risiken für Ökosysteme und die Menschheit, die wiederum direkte Auswirkungen auf Lieferketten und Produktionsbedingungen haben.
- Arbeit zitieren
- Andree Peterburs (Autor:in), 2011, Herausforderungen an die dt. Industrie im 21. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191535