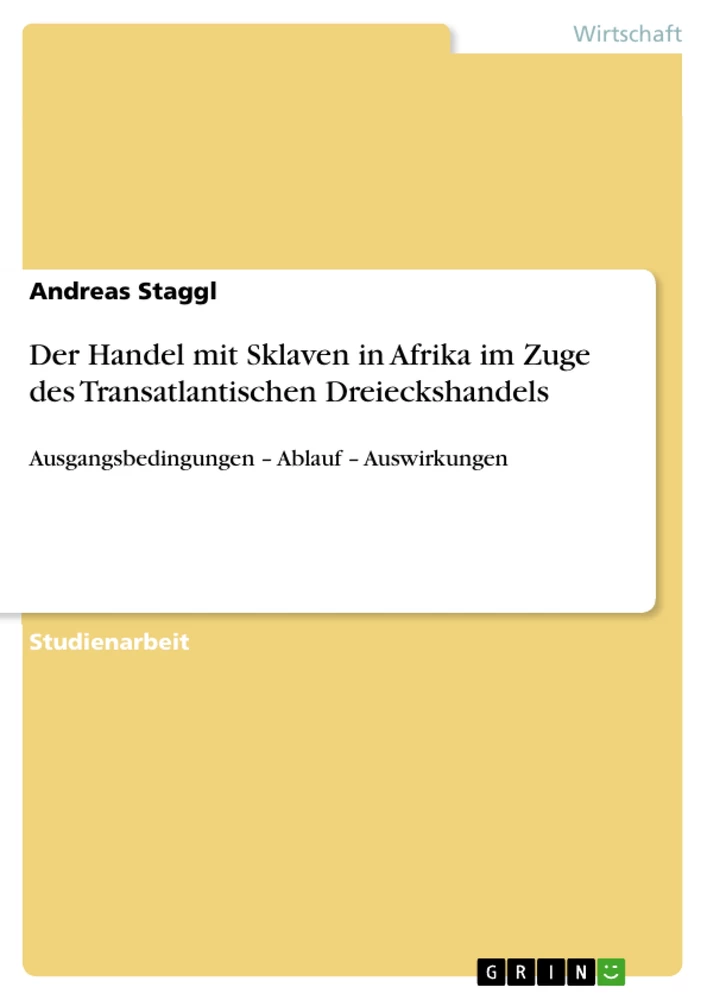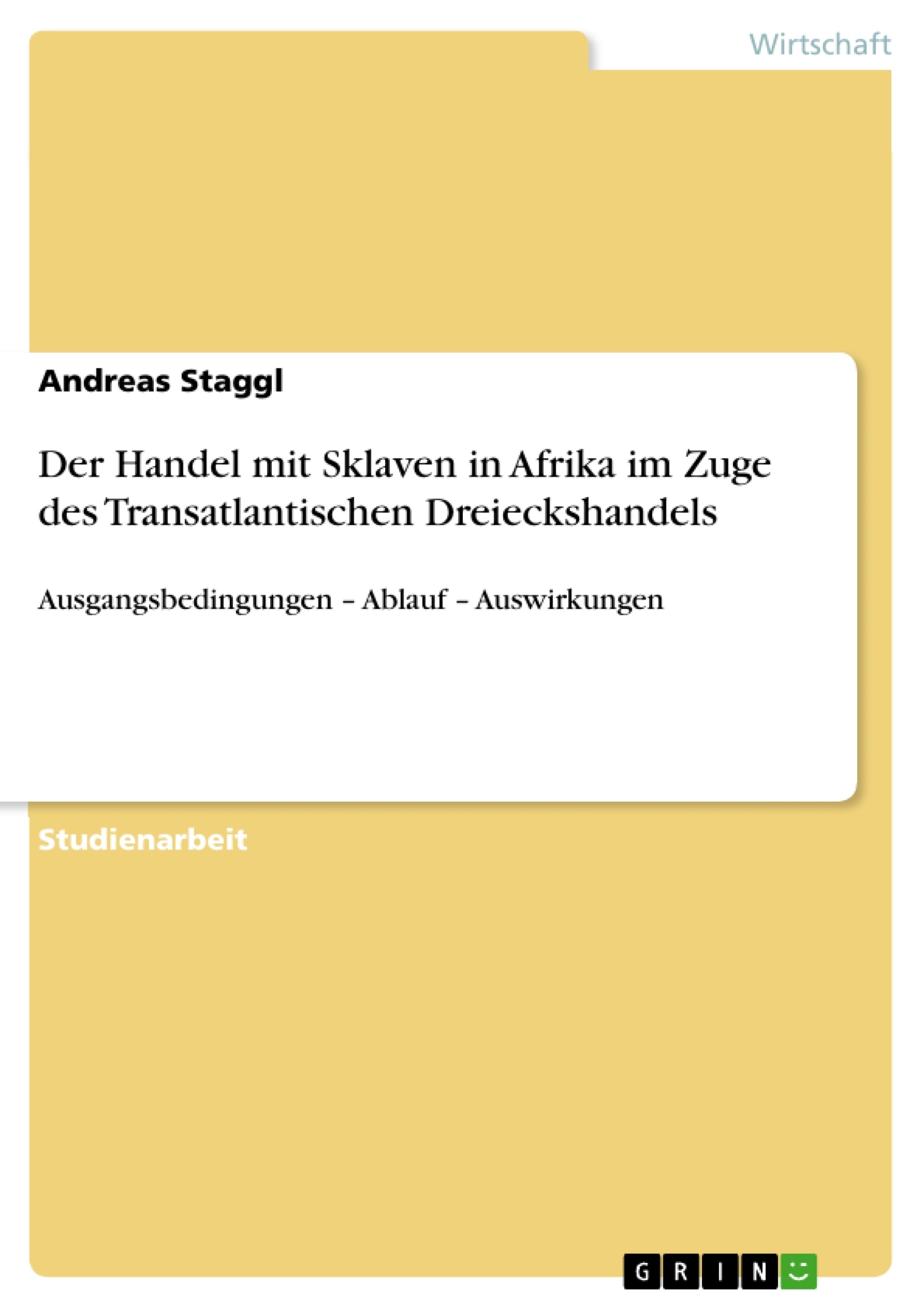Die europäische Eroberung und Kolonialisierung des amerikanischen Doppelkontinents hatte
auch immense Auswirkungen auf einen anderen Erdteil, nämlich auf Afrika. Durch die sich
etablierende Wirtschaftsform der Plantage mit einem hohen Arbeiterpotential und dem
Aussterben großer Teile der indigenen amerikanischen Bevölkerung wurden über
Jahrhunderte Millionen von Schwarzafrikanern nach Amerika verschifft und dort als Sklaven
ausgebeutet. In Folge entwickelte sich der so genannte Transatlantische Dreieckshandel, bei
welchem Waren von Europa nach Afrika, von Afrika nach Amerika und schließlich von
Amerika wieder nach Europa verschifft wurden. Die Schiffe waren dabei nie leer, tauschten
eine Ware gegen die andere und kamen schließlich mit Waren aus Amerika in Europa an und
verkauften diese dort für einen großen Gewinn. Abbildung 1 im Anhang (ist in Downloaddatei enthalten) verdeutlicht das
System des Dreieckshandels.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Station Afrika dieses transatlantischen
Wirtschaftssystems. Insgesamt kamen Schätzungen zu Folge mindestens 10 Millionen
Schwarzafrikaner an der Westküste im Zeitraum zwischen 1451 und 1870 versklavt. Die
europäischen Händler führten aber nur in einigen Fällen selbst Vorstöße in das Landesinnere,
sondern blieben an der Küste. Das Fangen der zukünftigen Sklaven wurde nicht von ihnen
selbst, sondern von afrikanischen Mittelsmännern durchgeführt. Diese erhielten im Austausch
für die Sklaven Waren aus Europa, insbesondere Waffen, Tabak, Schnaps oder Schmuck.
Afrikaner selbst waren also durchaus in den Transatlantischen Sklavenhandel involviert.
Die zentrale Frage dieser Arbeit wird deswegen sein, wie dieser Handel mit afrikanischen
Mittelsmännern zustande kam, wie er ablief und welche Auswirkungen er für die betroffenen
Gebiete hatte. Dabei soll zunächst die afrikanischen Staats- und Machtstrukturen vor dem
Transatlantischen Handel beschrieben werden. Anschließend wird auf das eigentliche
Tauschgeschäft eingegangen. Da sämtliche schriftliche Quellen von Europäern verfasst
wurden, bleibt abzuwarten, wie sehr die Motive der afrikanischen Handelspartner zu eruieren
ist. Genauer kann man jedoch über die Tauschwaren an und für sich sagen. Ebenso lässt sich
über die Auswirkungen des Handels auf die afrikanische Gesellschaft, insbesondere auf die machtpolitischen Gegebenheiten feststellen. Dies sollte auch der letzte Punkt dieser Arbeit
vor einem abrundenden Fazit sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Afrika vor dem Sklavenhandel
- Inner-afrikanische Sklaverei
- Politische Bildungen
- Die Mitwirkung von Afrikanern am Transatlantischen Handel
- Allgemeines
- Ablauf des Sklavenhandels in Afrika
- Auswirkungen des Sklavenhandels
- Allgemeine Auswirkungen
- Politische Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle Afrikas im transatlantischen Sklavenhandel, mit besonderem Fokus auf die Beteiligung afrikanischer Mittelsmänner. Sie untersucht, wie dieser Handel zustande kam, wie er ablief und welche Auswirkungen er auf die betroffenen Gebiete hatte. Dabei wird die Situation in Afrika vor dem transatlantischen Handel beleuchtet, die Rolle afrikanischer Akteure im Handelsprozess erörtert und die Auswirkungen des Handels auf die politische Landkarte und die afrikanische Gesellschaft analysiert.
- Die Rolle afrikanischer Mittelsmänner im transatlantischen Sklavenhandel
- Die Auswirkungen des Sklavenhandels auf die politische Landkarte und die Machtstrukturen in Westafrika
- Die Relevanz von schriftlichen Quellen aus europäischer Perspektive für die Analyse der afrikanischen Beteiligung am Handel
- Die Auswirkung des Sklavenhandels auf die afrikanische Gesellschaft, insbesondere auf ethnische Beziehungen und soziale Strukturen
- Die Relevanz des Themas für das Verständnis der heutigen Konflikte in Afrika
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die europäische Kolonialisierung des amerikanischen Kontinents und die damit verbundene Entwicklung des transatlantischen Dreieckshandels als Ausgangspunkt für die Arbeit dar. Sie erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit und die Relevanz des Themas für die heutige Zeit.
Afrika vor dem Sklavenhandel: Dieses Kapitel beleuchtet die Situation in Afrika vor der Ankunft europäischer Händler. Es wird die Bedeutung der inner-afrikanischen Sklaverei als etabliertes System in der Gesellschaft und die politischen Verhältnisse in Westafrika vor dem Handel mit Sklaven erörtert.
Die Mitwirkung von Afrikanern am Transatlantischen Handel: Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Rolle von Afrikanern im transatlantischen Sklavenhandel. Es wird der Ablauf des Handels in Afrika beschrieben, wobei die Rolle afrikanischer Mittelsmänner und die Tauschwaren im Fokus stehen.
Auswirkungen des Sklavenhandels: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Sklavenhandels auf die afrikanische Gesellschaft. Es wird die Veränderung der politischen Landschaft in Afrika und die Folgen für die Machtstrukturen analysiert. Außerdem werden die Auswirkungen auf ethnische Beziehungen und soziale Strukturen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Transatlantischer Sklavenhandel, Afrika, Sklaverei, inner-afrikanische Sklaverei, afrikanische Mittelsmänner, politische Bildungen, Westafrika, Machtstrukturen, ethnische Beziehungen, Auswirkungen, Quellenkritik, Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Transatlantische Dreieckshandel?
Ein Wirtschaftssystem, bei dem Waren von Europa nach Afrika, Sklaven von Afrika nach Amerika und Rohstoffe von Amerika zurück nach Europa transportiert wurden.
Welche Rolle spielten afrikanische Mittelsmänner im Sklavenhandel?
Afrikanische Mittelsmänner führten das Fangen und den Transport der Sklaven zur Küste durch und tauschten sie dort gegen europäische Waren wie Waffen, Tabak und Schmuck.
Gab es in Afrika bereits vor der Ankunft der Europäer Sklaverei?
Ja, die inner-afrikanische Sklaverei war bereits ein etabliertes System in vielen Gesellschaften, bevor der transatlantische Handel begann.
Wie viele Afrikaner wurden schätzungsweise versklavt?
Schätzungen zufolge wurden zwischen 1451 und 1870 mindestens 10 Millionen Schwarzafrikaner an der Westküste Afrikas versklavt.
Welche politischen Auswirkungen hatte der Sklavenhandel auf Afrika?
Der Handel veränderte die politische Landkarte massiv, beeinflusste Machtstrukturen und führte zur Destabilisierung vieler Regionen sowie zu veränderten ethnischen Beziehungen.
Warum sind europäische Quellen zum Sklavenhandel kritisch zu betrachten?
Da fast alle schriftlichen Quellen von Europäern verfasst wurden, ist es schwierig, die Perspektiven und Motive der afrikanischen Handelspartner objektiv zu rekonstruieren.
- Quote paper
- Andreas Staggl (Author), 2011, Der Handel mit Sklaven in Afrika im Zuge des Transatlantischen Dreieckshandels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191542