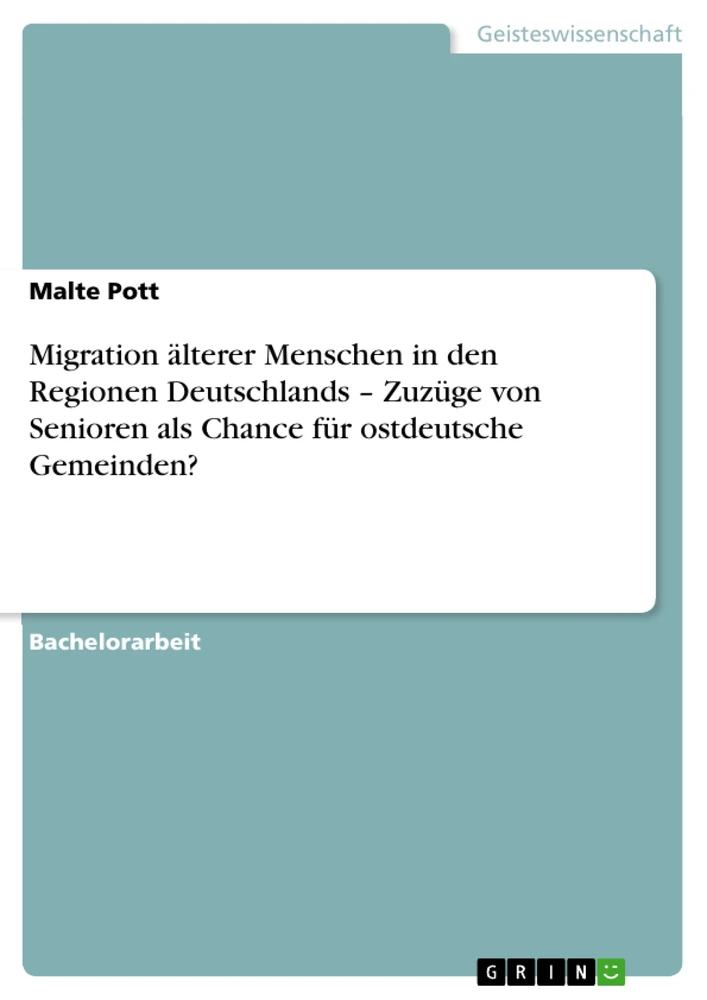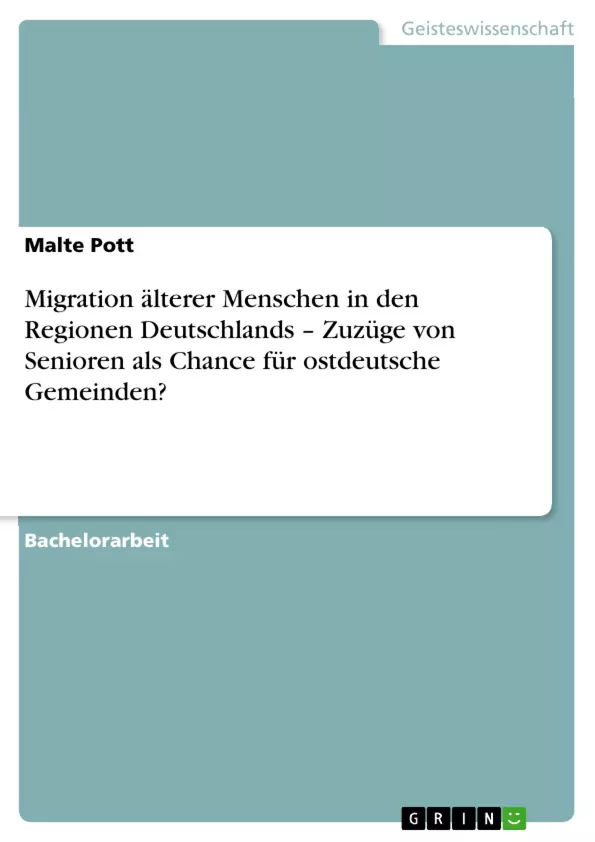Seit Jahren rückt der demografische Wandel immer mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Thema auch zukünftig an Bedeutung zunehmen wird, da sich die Auswirkungen des demografischen Wandels in den nächsten Jahrzehnten in voller Stärke zeigen werden. Die Entwicklungen, die mit dem demografischen Wandel einhergehen, wie z.B. eine niedrige Geburtenrate und einem damit verbundenen Bevölkerungsrückgang, sowie einer zunehmenden Alterung der verbleibenden Bevölkerung sind kein deutsches Phänomen, sondern können in fast allen Industrienationen so beobachtet werden. Die Brisanz dieser Entwicklung liegt darin, dass große Teile des öffentlichen Systems, wie z.B. der Gesundheitssektor, das Rentensystem, oder auch das Angebot von Arbeitskräften, von den Auswirkungen des demografischen Wandels betroffen sind. Insbesondere die neuen Bundesländer sind von dem eingangs angesprochenen Bevölkerungsrückgang betroffen. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands haben die neuen Bundesländer bis zum Jahr 2009 zusammen 12,3% ihrer Einwohner von 1990 verloren (vgl. Eigene Berechnung nach Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie). Dies führt dazu, dass die Existenz einiger ostdeutscher Gemeinden bedroht ist. Daher soll dass Ziel der vorliegenden Arbeit die Klärung der Frage sein, ob der Zuzug von älteren Menschen eine Chance für ostdeutsche Gemeinden darstellt, den Verlust durch Abwanderungen auszugleichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Definition „Ältere Menschen“
- 2.2 Wanderungen
- 2.3 Demografische Alterung
- 3. Empirische Grundlagen
- 3.1 Daten zur Binnenmigration älterer Menschen
- 3.2 Trends der demografischen Alterung
- 3.3 Trends der Binnenmigration
- 4. Gründe für die Binnenmigration älterer Menschen
- 5. Auswirkungen von Migrationsbewegungen für Städte und Gemeinden
- 5.1 Probleme in Städten durch den Verlust von Einwohnern
- 5.2 Vorteile der Gemeinden durch den Zuzug von Senioren
- 6. Bereits durchgeführte Aktivitäten zur Stärkung des Zuzugs von Senioren
- 6.1 Zukünftige finanzielle Lage von Senioren
- 6.2 Bereits existierende Ansätze der Anwerbung von Senioren
- 6.3 Schaffung altersgerechten Wohnraums
- 6.4 Diskussion der Maßnahmen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Migration älterer Menschen in die Regionen Deutschlands, insbesondere mit der Frage, ob der Zuzug von Senioren eine Chance für ostdeutsche Gemeinden darstellt. Die Arbeit analysiert die demografische Entwicklung in Deutschland und die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Ostregionen. Der Fokus liegt dabei auf den Motiven der älteren Menschen, die sie zur Binnenmigration bewegen, sowie auf den potenziellen Auswirkungen des Zuzugs auf die betroffenen Gemeinden.
- Demografischer Wandel und seine Folgen in Deutschland
- Binnenmigration älterer Menschen in Ostdeutschland
- Gründe für die Migration älterer Menschen
- Auswirkungen des Zuzugs von Senioren auf ostdeutsche Gemeinden
- Konzepte zur Stärkung des Zuzugs von Senioren
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Relevanz des Themas der Migration älterer Menschen im Kontext des demografischen Wandels. Sie erläutert die Problematik des Bevölkerungsrückgangs in den ostdeutschen Gemeinden und die Bedeutung der Frage, ob der Zuzug von Senioren eine Chance zur Revitalisierung bietet.
- Kapitel 2: Grundlagen: Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe wie „Ältere Menschen“, erläutert Theorien zur Entstehung von Wanderungen und beschreibt das Phänomen der demografischen Alterung.
- Kapitel 3: Empirische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die empirischen Grundlagen der Arbeit, indem es Daten zur Binnenmigration älterer Menschen, Trends der demografischen Alterung und Trends der Binnenmigration präsentiert.
- Kapitel 4: Gründe für die Binnenmigration älterer Menschen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Motiven, die ältere Menschen zur Migration veranlassen.
- Kapitel 5: Auswirkungen von Migrationsbewegungen für Städte und Gemeinden: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Abwanderung von Bevölkerung aus Städten und Gemeinden und beleuchtet die potenziellen Vorteile des Zuzugs von Senioren.
- Kapitel 6: Bereits durchgeführte Aktivitäten zur Stärkung des Zuzugs von Senioren: Dieses Kapitel stellt bereits bestehende Konzepte und Ansätze zur Stärkung des Zuzugs von Senioren vor und diskutiert die verschiedenen Maßnahmen kritisch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie demografischer Wandel, Binnenmigration, Alterungsprozess, Seniorenmigration, Ostdeutschland, Bevölkerungsrückgang, Zuzug von Senioren, Chancen und Herausforderungen für ostdeutsche Gemeinden, altersgerechter Wohnraum, finanzielle Lage von Senioren, Anwerbung von Senioren.
Häufig gestellte Fragen
Können zuziehende Senioren den Bevölkerungsrückgang in Ostdeutschland stoppen?
Die Arbeit untersucht, ob die Binnenmigration älterer Menschen eine Chance für ostdeutsche Gemeinden darstellt, Verluste durch Abwanderung jüngerer Generationen auszugleichen.
Was sind die Hauptgründe für die Binnenmigration älterer Menschen?
Motive können die Rückkehr in die Heimat, die Nähe zu Familienangehörigen, attraktivere Wohnumfelder oder geringere Lebenshaltungskosten sein.
Welche Vorteile haben Gemeinden durch den Zuzug von Senioren?
Senioren bringen Kaufkraft in die Region, können ehrenamtliches Engagement leisten und helfen, die vorhandene Infrastruktur (z.B. Läden, Ärzte) auszulasten.
Wie stark ist der Bevölkerungsverlust in den neuen Bundesländern?
Seit der Wiedervereinigung bis 2009 haben die neuen Bundesländer im Durchschnitt etwa 12,3% ihrer Einwohner verloren, was die Existenz vieler kleiner Gemeinden bedroht.
Welche Maßnahmen können Gemeinden ergreifen, um Senioren anzulocken?
Wichtige Ansätze sind die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum, eine gute medizinische Versorgung und gezielte Marketingmaßnahmen zur Anwerbung von Rentnern.
Ist die finanzielle Lage der Senioren ein Faktor für die Migration?
Ja, die zukünftige finanzielle Ausstattung der Senioren bestimmt deren Mobilität und die Fähigkeit, in neue Wohnformen oder Regionen zu investieren.
- Citation du texte
- Malte Pott (Auteur), 2011, Migration älterer Menschen in den Regionen Deutschlands – Zuzüge von Senioren als Chance für ostdeutsche Gemeinden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191557