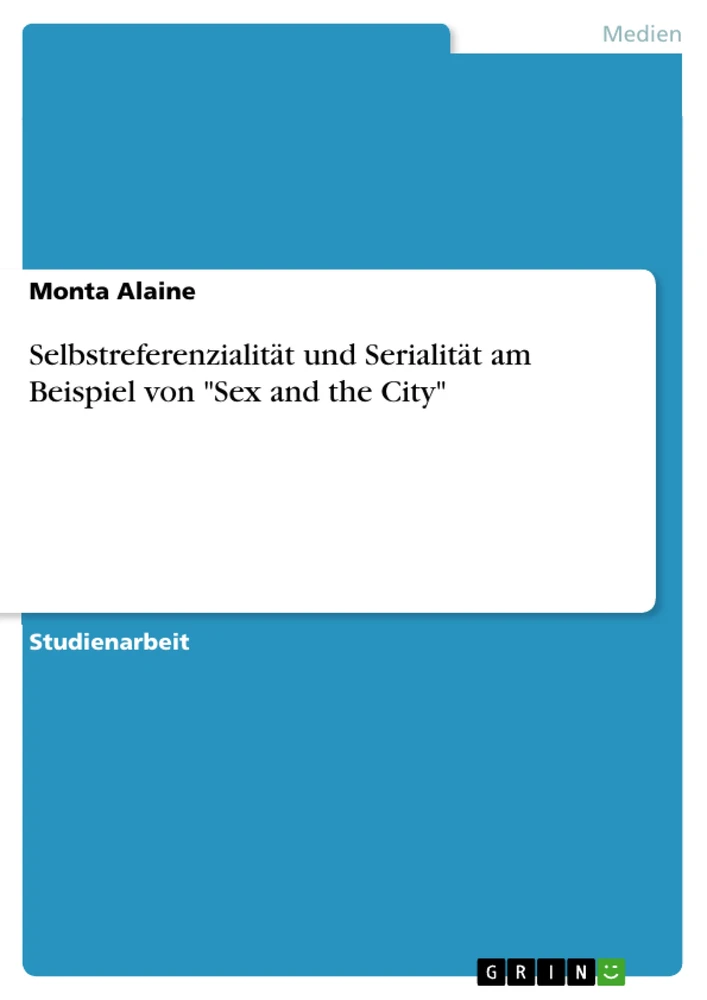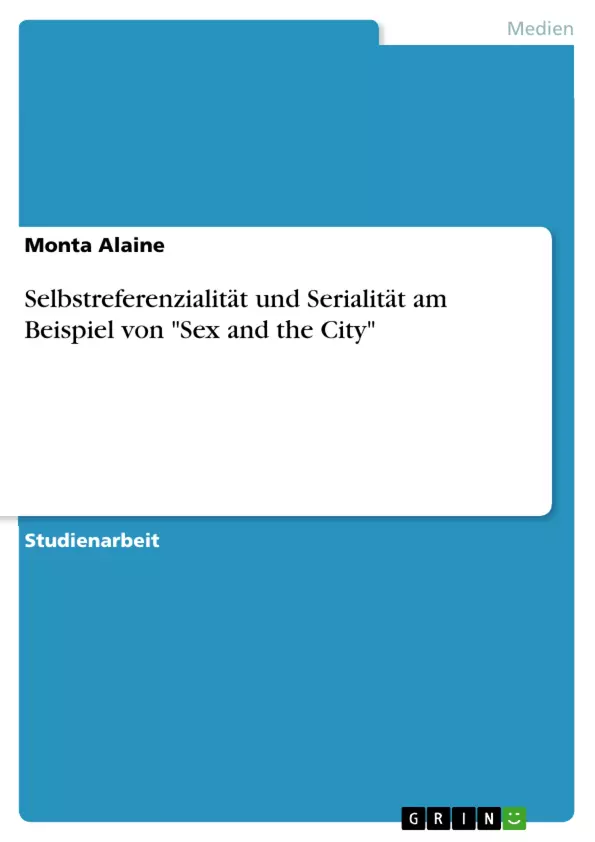„Sex and the City“: So der Name eines der größten TV-Phänomene der ausgehenden Neunziger bzw. Anfang der Zweitausender Jahre. Basierend auf der wöchentlichen Kolumne von Candance Bushnell, die im „New York Observer“ erschien und 1996 als Buch aufgelegt wurde, hatte die Serie rund um Bushnell´s Alter Ego Carrie Bradshaw ihre Anfänge 1998 und fand von Anfang an großen Anklang, gleichwohl wie sie polarisierte. Bis 2004 wurden sechs Staffeln der Serie abgedreht und ob der gewagten und zum heutigen Frauenbild passenden Themen, der sexuellen Offenheit („In-your-face-talk“ ) und nicht zuletzt der daraus resultierenden Komik erfreuten sich die Serie ebenso wie der nach Absetzung der Serie 2008 produzierte Film „Sex and the City“ gerade bei Frauen außergewöhnlicher Beliebtheit.
In der folgenden Arbeit gehe ich vorerst darauf ein, wie in der Serie Similaritäts- bzw. Kontiguitätselemente eingesetzt werden und wie daraus die für die Serie typische Continuity entsteht. Danach möchte ich aufzeigen, wo die Serie metaisierende bzw. selbstreferentielle Tendenzen aufweist und welche Wirkung daraus für den Zuschauer resultiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Popularität der Serie „Sex and the City”, Fragestellung und Ziel der Arbeit
- Continuity in „Sex and the City”
- Begriffsdefinition
- Similarität
- In Thematik, Handlung und Aufbau
- Die Figuren
- Die Stadt
- Kontiguität
- Figurenentwicklung
- Metaisierung und Selbstreferentialität in „Sex and the City”
- Begriffsdefiniton
- Mise en abyme
- Metalepsen
- Illusionsfördernde vs. -brechende Wirkung
- Metaphorische Selbstreferentialität
- „Jules&Mimi“
- Mode/Konsumgesellschaft
- Frau in der Postmoderne/ „3rd Wave Feminism“
- Zusammenfassung der Ergebnisse, Hinweise zur Forschungsliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Fernsehserie „Sex and the City“ und untersucht, wie in der Serie Similaritäts- und Kontiguitätselemente eingesetzt werden und wie daraus die für die Serie typische Continuity entsteht. Darüber hinaus soll analysiert werden, wo die Serie metaisierende bzw. selbstreferentielle Tendenzen aufweist und welche Wirkung daraus für den Zuschauer resultiert.
- Die Rolle von Continuity und Similarität in „Sex and the City“
- Die Bedeutung der Figur Carrie Bradshaw und ihrer Freundinnen
- Die Darstellung von Sexualität und Beziehungen in der Serie
- Die metaisierenden Elemente und ihre Wirkung auf den Zuschauer
- Die Relevanz der Serie im Kontext der Postmoderne und des „3rd Wave Feminism“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Popularität der Serie „Sex and the City“ sowie die Fragestellung und das Ziel der Arbeit.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff der Continuity in „Sex and the City“ und analysiert die beiden Elemente Similarität und Kontiguität. Im Fokus stehen hierbei die wiederkehrenden Handlungsstränge, die Figuren, die Stadt New York und deren Einfluss auf die Entwicklung der Figuren.
Kapitel 3 widmet sich der Metaisierung und Selbstreferentialität in „Sex and the City“ und untersucht die verschiedenen Formen dieser Phänomene in der Serie. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse von Mise en abyme, Metalepsen und der metaphorischen Selbstreferentialität, die in den Themen „Jules&Mimi“, „Mode/Konsumgesellschaft“ und „Frau in der Postmoderne/ „3rd Wave Feminism““ zum Ausdruck kommt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind Continuity, Similarität, Kontiguität, Metaisierung, Selbstreferentialität, „Sex and the City“, Carrie Bradshaw, New York, Postmoderne, „3rd Wave Feminism“ und Figurenentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Continuity in "Sex and the City"?
Continuity bezeichnet den Zusammenhalt der Serie durch wiederkehrende Elemente (Similarität) und die logische Weiterentwicklung von Charakteren und Handlungssträngen (Kontiguität).
Wie zeigt sich Selbstreferenzialität in der Serie?
Die Serie thematisiert oft ihr eigenes Medium oder ihre Entstehung, etwa durch Carries Kolumne, die das Geschehen reflektiert, oder durch filmische Mittel wie die direkte Ansprache des Publikums.
Welche Rolle spielt New York als Schauplatz?
New York fungiert fast als fünfter Hauptcharakter. Die Stadt prägt die Identität der Frauen und dient als Symbol für Freiheit, Konsum und moderne Lebensentwürfe.
Was ist "3rd Wave Feminism" im Kontext der Serie?
Die Serie wird oft mit der dritten Welle des Feminismus assoziiert, da sie sexuelle Selbstbestimmung, weibliche Freundschaft und den Genuss von Mode und Luxus als emanzipatorisch darstellt.
Was bewirkt die Metaisierung beim Zuschauer?
Metaisierende Elemente wie Carries Off-Stimme können die Illusion brechen, aber gleichzeitig eine tiefere emotionale Bindung und Reflexion über die gezeigten Themen fördern.
- Arbeit zitieren
- Monta Alaine (Autor:in), 2010, Selbstreferenzialität und Serialität am Beispiel von "Sex and the City", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191559