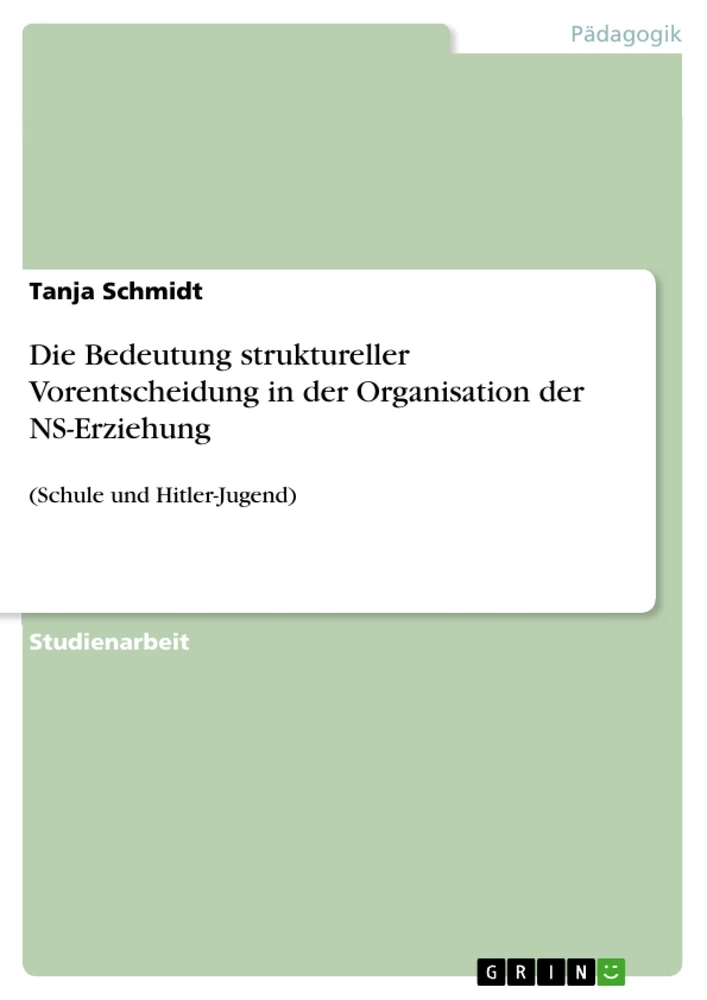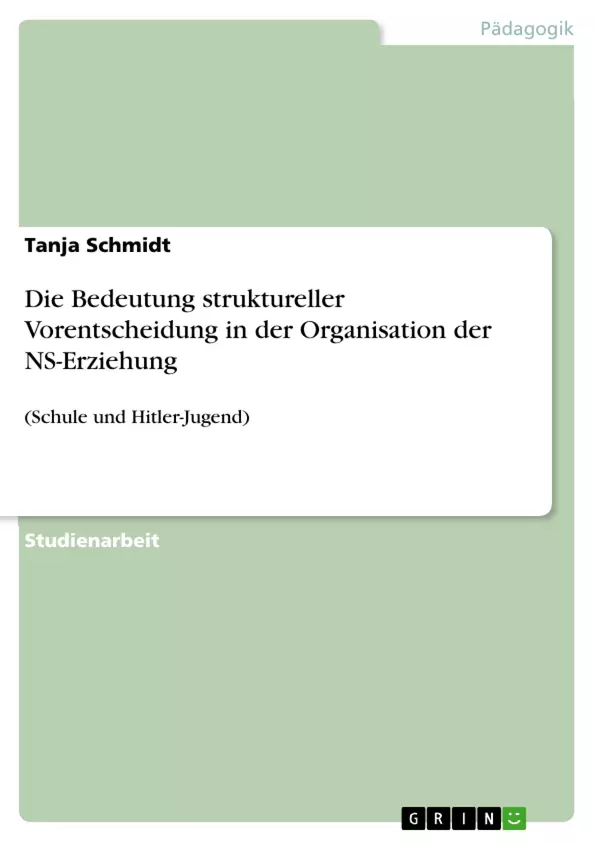Die Autorin stellt die Forschungen von Philip Jackson zum hidden curricula dar.
Was bedeutet es für die Erziehung und die dort tätigen Pädagogen, wenn Erziehungsziele im Verborgenen die eigentlichen konterkarieren? Es ist wichtig für Pädagogen, die eigene Rolle, persönlichen Ziele und was tatsächlich erreicht wird, zu reflektieren, auch um sich vor Selbstüberschätzung zu hüten.
Es geht in der Schule nicht allein um Vermittlung von Wissen, sondern das Leben in Gesellschaft erfordert die Anpassung an Strukturen. Ausgehend von Norbert Elias Überlegungen in seiner Zivilisationstheorie „Vom Zwang zum Selbstzwang“ wird dargestellt, wie die Tendenz zur Selbstdisziplinierung und Anpassung an vorgegebene Strukturen in der Moderne zunimmt, die Gefahr von „Betriebsblindheit“ bis hin zu Manipulation steigt.
Pädagogik bewegt sich so immer auch im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Zwang. Wo erschöpft sich Disziplin in Gehorsam? Wo beginnt eigenständiges Denken, wo wird es begrenzt?
Gehorsam ist manchmal notwendig, um Notfälle oder Katastrophen zu vermeiden, aber kein Erziehungsziel. Pädagogik öffnet neue Wege, wenn sie hilft das Denken zu erweitern und auch ein „Nein“ akzeptiert. Die intellektuelle Entwicklung des Einzelnen hat Vorrang vor Ideen.
Mechtild Gomolla und Frank-Olaf Radtke zeigen anhand der Theorien des Institutionellen Rassismus und Diskriminierung auf, dass im Widerspruch zu demokratischen Grundüberzeugungen stehende Prinzipien in den Strukturen von Organisationen auffindbar sind. Die Grenzen pädagogischen Handelns werden im System Schule deutlich, gleichzeitig ergeht aber auch an Pädagogen die Aufforderung, ihr Handeln zu reflektieren, um Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen und im öffentlichen Diskurs Veränderungen und soziale Chancengleichheit zu ermöglichen.
Anschließend werden Geschichte, Struktur und Vereinnahmung der jungen Menschen der NS-Jugendorganisation Hitler-Jugend dargestellt, die den heimlichen Lehrplan des Gehorsams zum bestimmenden Prinzip erhoben. Zuletzt werden exemplarisch Zeitschriftenbeiträge aus der für die Hitler-Jugend konzipierte NS-Zeitschrift „Hilf mit“ analysiert.
In der NS-Pädagogik wird deutlich, dass Menschen buchstäblich auf der Strecke bleiben, wenn Regeln zum Selbstzweck erhoben werden. Da, wo Pädagogik nicht im Sinne Kants zur Mündigkeit erzieht, wird es gefährlich. Ein System kann manipulieren und diskriminieren – für Pädagogen heißt das: Wachsam und kritisch bleiben!
Inhaltsverzeichnis
- Philip Jackson: The Hidden Curricula – Der heimliche Lehrplan
- Norbert Elias: Zwang zum Selbstzwang
- Institutionelle Diskriminierung durch Strukturen des Schulsystems
- Die Strukturen der Hitler-Jugend (HJ)
- Die HJ: Von der Kampftruppe zur Massenbewegung
- Die Struktur des Führerprinzips in der HJ
- Die Vereinnahmung des Führerprinzips in der HJ
- Die NS-Erziehung
- Die Bedeutung struktureller Vorentscheidung in der Organisations der NS-Erziehung (Schule und Hitler-Jugend)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Bedeutung struktureller Vorentscheidung in der Organisation der NS-Erziehung, insbesondere in der Schule und der Hitler-Jugend. Sie untersucht, wie diese Strukturen zur Unterstützung der NS-Ideologie und zur Erzeugung von Disziplin und Anpassung beitrugen.
- Der Einfluss des „heimlichen Lehrplans“ auf die Bildung von Disziplin und Anpassung
- Die Rolle der Selbstdisziplin und des Zwangs zur Selbstregulation in der Gesellschaft
- Die Funktion der Strukturen in der Hitler-Jugend bei der Förderung von NS-Ideologie und Gleichschaltung
- Die Bedeutung von Anpassungsstrategien im Kontext von Bildungseinrichtungen
- Die Auswirkungen von strukturellen Vorentscheidungen auf die Entwicklung autonomer Persönlichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der heimliche Lehrplan – Philip Jackson zeigt auf, dass es neben dem offiziellen Lehrplan einen „heimlichen“ Lehrplan gibt, der die soziale Ordnung und die Anpassung an die Strukturen der Schule vermittelt. Dieser Lehrplan wird durch die Organisation des Schulbetriebs, Zeitdruck, Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit der Disziplinierung geprägt.
- Kapitel 2: Zwang zum Selbstzwang – Norbert Elias’ Theorie der Zivilisation beleuchtet die Entwicklung von Selbstdisziplin und die zunehmende Regulation des menschlichen Verhaltens durch gesellschaftliche Strukturen. Der Zwang zur Anpassung und Selbstkontrolle wird als Folge der wachsenden Komplexität der Gesellschaft und der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Individuen dargestellt.
- Kapitel 3: Institutionelle Diskriminierung durch Strukturen des Schulsystems – Dieses Kapitel analysiert, wie die Strukturen des Schulsystems zu Diskriminierung und Selektion führen können. Es werden die Auswirkungen von Anpassungsdruck und dem „heimlichen Lehrplan“ auf die Entwicklung individueller Fähigkeiten und die Chancengleichheit betrachtet.
- Kapitel 4: Die Strukturen der Hitler-Jugend (HJ) – Das Kapitel beleuchtet die Organisation der Hitler-Jugend und die Rolle der Strukturen bei der Verbreitung von NS-Ideologie und der Gleichschaltung von Jugendlichen. Es werden die Mechanismen des Führerprinzips, die Rolle von Disziplin und Anpassung und die Vermittlung von NS-Werten anhand der HJ-Strukturen analysiert.
Schlüsselwörter
Der heimliche Lehrplan, Strukturen, NS-Erziehung, Hitler-Jugend, Selbstdisziplin, Anpassung, Zivilisation, Institutionelle Diskriminierung, Führerprinzip, Selektion.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „heimlichen Lehrplan“ (hidden curriculum)?
Der heimliche Lehrplan beschreibt Lerninhalte und soziale Anpassungsprozesse, die nicht offiziell im Lehrplan stehen, aber durch die Strukturen und Organisation des Schulalltags vermittelt werden, wie etwa Gehorsam und Disziplin.
Welche Rolle spielte die Hitler-Jugend in der NS-Pädagogik?
Die Hitler-Jugend erhob den heimlichen Lehrplan des Gehorsams zum bestimmenden Prinzip und diente der ideologischen Vereinnahmung sowie der Gleichschaltung junger Menschen im Sinne des Führerprinzips.
Was bedeutet „Zwang zum Selbstzwang“ nach Norbert Elias?
Nach Elias führt die zunehmende Komplexität der Gesellschaft dazu, dass Individuen äußere Zwänge in innere Selbstdisziplinierung umwandeln, was in der Moderne die Gefahr von Manipulation und Anpassungsdruck erhöht.
Wie äußert sich institutionelle Diskriminierung im Schulsystem?
Institutionelle Diskriminierung zeigt sich darin, dass in den Strukturen von Organisationen Prinzipien verankert sind, die trotz demokratischer Grundüberzeugungen zu Ungerechtigkeiten und mangelnder Chancengleichheit führen.
Warum ist die Reflexion des eigenen Handelns für Pädagogen so wichtig?
Pädagogen müssen ihre Rolle und Ziele reflektieren, um verborgene Erziehungsziele, die den eigentlichen Zielen widersprechen, sichtbar zu machen und sich vor Selbstüberschätzung sowie „Betriebsblindheit“ zu schützen.
- Quote paper
- Tanja Schmidt (Author), 2012, Die Bedeutung struktureller Vorentscheidung in der Organisation der NS-Erziehung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191578