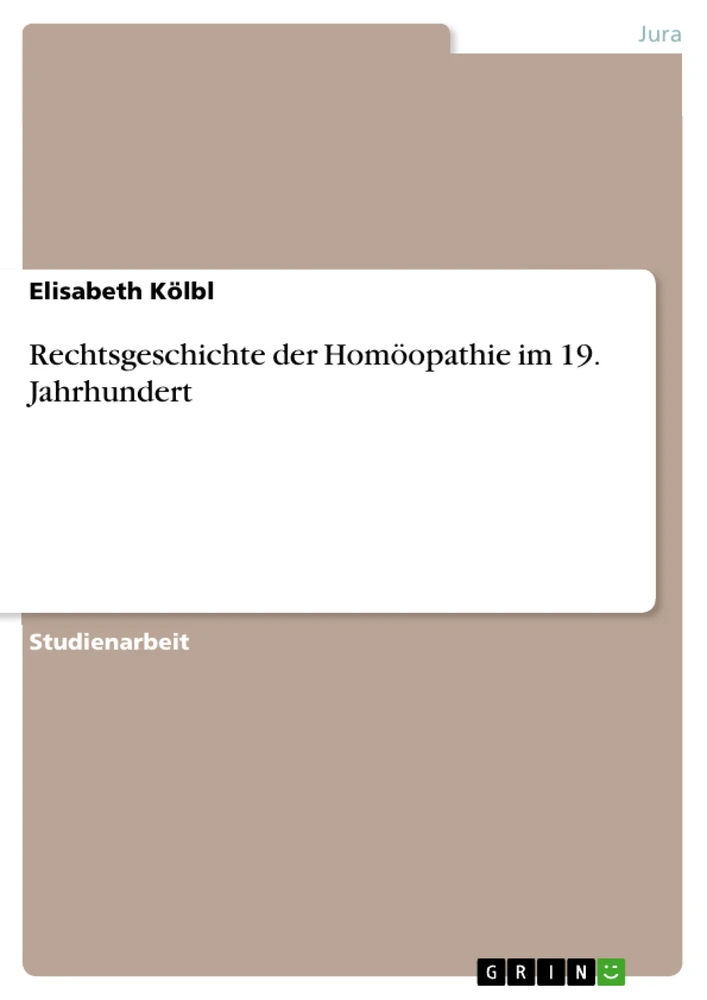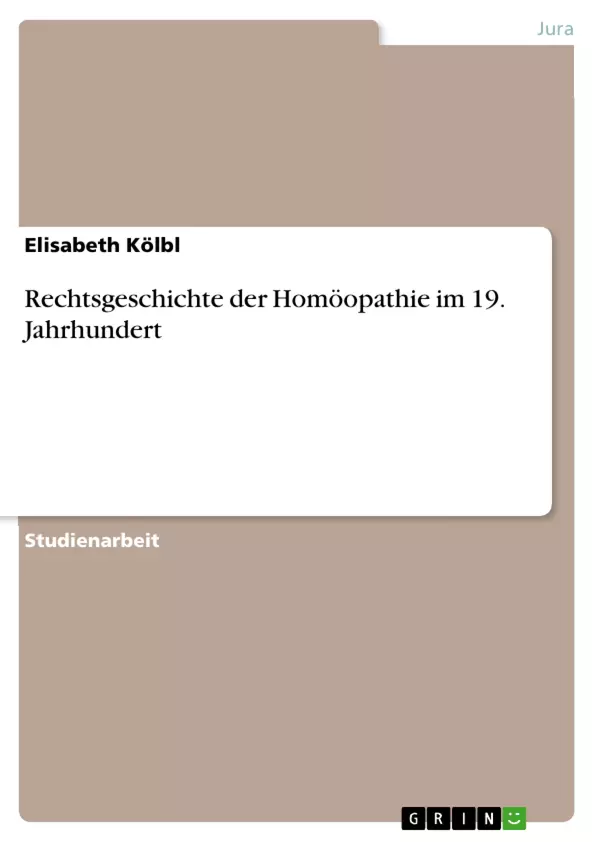Die vorliegende Seminararbeit bietet einen Überblick über die rechtliche Entwicklung der anfänglichen Homöopathie. Nach einer Einleitung über die Entwicklung der Homöopatie thematisiert die wissenschaftliche Arbeit ua das Homöopathieverbot von 1819 bis 1837 und das folgende Recht der Homöopathen zur Selbstdispensation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was versteht man unter Homöopathie?
- Entwicklung der Homöopathie
- Samuel Hahnemann
- Stand der Medizin zur Zeit Hahnemanns
- Anfänge der Homöopathie
- Matthias Marenzeller
- Homöopathieverbot 1819
- Gründe für die Ablehnung der Homöopathie
- Missachtung des Homöopathieverbotes
- Klinischer Versuch - Josephsakademie
- Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Gumpendorf
- Ereignisse von 1833
- Aufhebung des Homöopathieverbotes 1837
- Maßregeln bei Anwendung des homöopathischen Heilverfahrens 1846
- § 354 allgemeines Strafgesetz - unberechtigter Verkauf innerer und äußerer Heilmittel
- Verordnung von 1887 zur missbräuchlichen Selbstdispensation
- Weitere rechtliche Entwicklung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Homöopathie im 19. Jahrhundert zu geben, mit einem Schwerpunkt auf die rechtlichen Aspekte ihrer Geschichte. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, denen die Homöopathie in dieser Zeit begegnete, wie z.B. die Ablehnung durch die etablierte Medizin, die daraus resultierenden Verbote und die allmähliche Akzeptanz und rechtliche Regulierung.
- Die Entstehung der Homöopathie und die zentralen Prinzipien Samuel Hahnemanns
- Die Reaktion der etablierten Medizin auf die Homöopathie und die Gründe für die Ablehnung
- Die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Homöopathie im 19. Jahrhundert, einschließlich Verbote und Aufhebungen
- Die Entwicklung von rechtlichen Regelungen für die Anwendung homöopathischer Heilmethoden
- Die Bedeutung der Homöopathie im Kontext der medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Homöopathie ein und stellt die Frage nach der Akzeptanz dieser Therapieform in der Gesellschaft. Es thematisiert die Skepsis gegenüber der Homöopathie und die damit verbundenen Herausforderungen für ihre Vertreter. - Kapitel 2: Was versteht man unter Homöopathie?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Homöopathie und erläutert das Ähnlichkeitsprinzip (similia similibus curentur), das als Grundlage dieser Therapieform gilt. Die Definition der Österreichischen Gesellschaft für Homöopathische Medizin (ÖGHM) wird vorgestellt und die historischen Wurzeln des Konzepts werden beleuchtet. - Kapitel 3: Entwicklung der Homöopathie
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Homöopathie, wobei es sich auf den Begründer Samuel Hahnemann konzentriert. Der Einfluss der damaligen medizinischen Strömungen und die Rolle von Hahnemanns Selbstversuchen im Entwicklungsprozess der Homöopathie werden dargestellt. - Kapitel 4: Homöopathieverbot 1819
Dieses Kapitel behandelt das Verbot der Homöopathie im Jahr 1819 und analysiert die Gründe für die Ablehnung dieser Therapieform durch die etablierte Medizin. Die Missachtung des Verbotes und die damit verbundenen Ereignisse, wie z.B. der klinische Versuch an der Josephsakademie und die Einsetzung von homöopathischen Ärzten im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, werden detailliert beschrieben. - Kapitel 5: Aufhebung des Homöopathieverbotes 1837
Dieses Kapitel schildert die Aufhebung des Homöopathieverbotes im Jahr 1837 und die damit verbundenen Entwicklungen. Die Bedeutung dieses Ereignisses für die Verbreitung und Akzeptanz der Homöopathie wird hervorgehoben. - Kapitel 6: Maßregeln bei Anwendung des homöopathischen Heilverfahrens 1846
Dieses Kapitel befasst sich mit der Einführung von Regelungen für die Anwendung des homöopathischen Heilverfahrens im Jahr 1846. Die Maßnahmen und Vorschriften, die in diesem Zusammenhang getroffen wurden, werden beleuchtet und in ihren historischen Kontext eingebettet. - Kapitel 7: § 354 allgemeines Strafgesetz - unberechtigter Verkauf innerer und äußerer Heilmittel
Dieses Kapitel analysiert den § 354 des allgemeinen Strafgesetzes, der sich mit dem unberechtigten Verkauf von Heilmitteln befasst. Die Bedeutung dieser Regelung im Zusammenhang mit der Homöopathie und ihre Auswirkungen auf die homöopathische Praxis werden dargestellt. - Kapitel 8: Verordnung von 1887 zur missbräuchlichen Selbstdispensation
Dieses Kapitel behandelt die Verordnung von 1887, die sich mit der missbräuchlichen Selbstdispensation von Heilmitteln befasst. Der Zusammenhang dieser Verordnung mit der Homöopathie und ihre Auswirkungen auf die homöopathische Behandlung werden erläutert. - Kapitel 9: Weitere rechtliche Entwicklung
Dieses Kapitel behandelt die weitere rechtliche Entwicklung der Homöopathie im 19. Jahrhundert. Die wichtigsten Regelungen und Entscheidungen, die die rechtliche Position der Homöopathie prägten, werden zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Homöopathie, Samuel Hahnemann, Ähnlichkeitsprinzip, similia similibus curentur, Medizinrecht, Rechtsgeschichte, Homöopathieverbot, klinische Versuche, Josephsakademie, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Selbstdispensation, Apothekenwesen, Arzneimittelrecht, Österreich.
Häufig gestellte Fragen zur Rechtsgeschichte der Homöopathie
Wer war der Begründer der Homöopathie?
Samuel Hahnemann entwickelte Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts die Homöopathie basierend auf dem Ähnlichkeitsprinzip.
Warum wurde die Homöopathie 1819 verboten?
Die etablierte Schulmedizin lehnte die Methode als unwissenschaftlich ab, zudem gab es Konflikte um das Recht der Ärzte, Arzneien selbst abzugeben (Selbstdispensation).
Wann wurde das Homöopathieverbot wieder aufgehoben?
Im Jahr 1837 wurde das Verbot offiziell aufgehoben, was den Weg für eine rechtliche Regulierung und breitere Anwendung ebnete.
Was bedeutet "Selbstdispensation" im Kontext der Homöopathie?
Es bezeichnet das Recht der homöopathischen Ärzte, ihre speziell zubereiteten Heilmittel direkt an Patienten abzugeben, statt sie über eine Apotheke zu vertreiben.
Was besagte der § 354 des allgemeinen Strafgesetzes?
Dieser Paragraph regelte den unberechtigten Verkauf von Heilmitteln und stellte eine rechtliche Hürde für Homöopathen dar, die ohne staatliche Konzession praktizierten.
- Quote paper
- Elisabeth Kölbl (Author), 2012, Rechtsgeschichte der Homöopathie im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191619