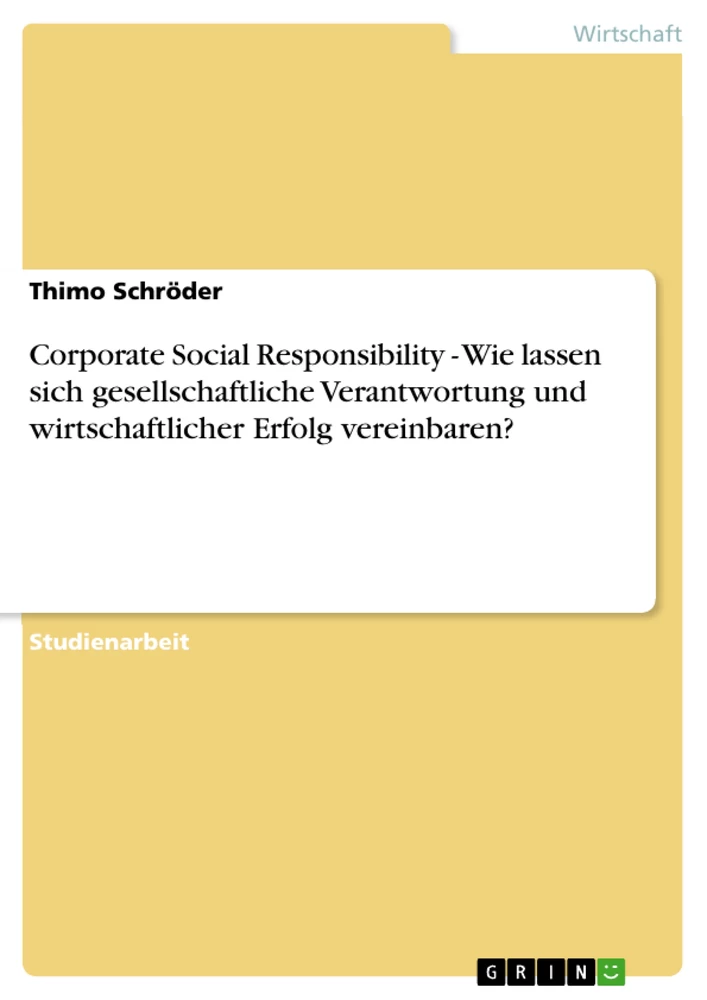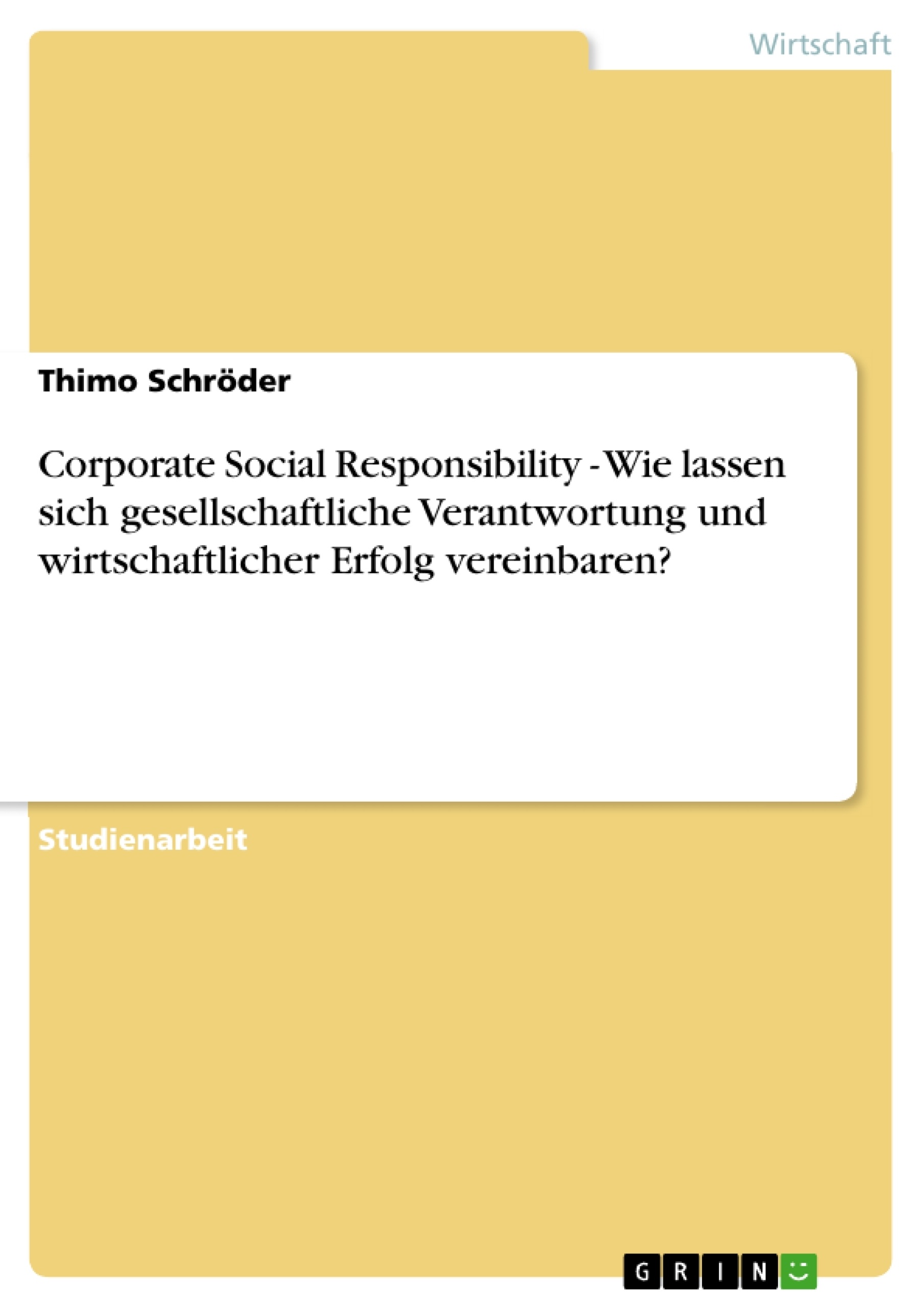Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis……………………………………………...…………………..….2
1. Einleitung………………………………………………………………...……………...…3
2. Corporate Social Responsibility………………………………………...…………......4
2.1 Definition…………………………………………………………...………...……4
2.2 Historische Entwicklung in Europa………………………………...……...……5
3. Interessengruppen…………………………………………………………...…...….…..6
3.1 Stakeholderansatz……………………………………………………..….……..6
3.2 Shareholderansatz…………………………………………………………...…..7
4. Instrumente von CSR………………………………………………………………...…..8
4.1 Nachhaltigkeitsberichterstattung……………………………………………...…8
4.2 Verhaltenskodex..………………………………………………………….....…..9
4.3 Gütesiegel……………………………………………………………………......9
5. Praxisbeispiele…………………………………………………………………………...9
5.1 RWE…………………………………………………………….………………...9
6. Fazit…………………………………………………………………….……………..…....10
Literaturverzeichnis…………………………………………………….…………….…….12
AUSZUG AUS DER EINLEITUNG:
1. Einleitung
„Man kann nicht in die Zukunft schauen,
aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen –
denn Zukunft kann man bauen."
- Antoine de Saint Exupéry
Das Zitat von Antoine de Saint Exupéry hat vor allem im 21. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen. Heutzutage dominieren vor allem wirtschaftlich und gesellschaft¬lich basierende Themen und Skandale die Schlagzeilen der Medien: Börsenkrisen, Bankenskandale, exorbitante Managergehälter, hohe Ge¬winne für Firmen und niedrige Löhne für die Angestellten, wird den Verantwortlichen vorgeworfen. Wirtschaftliche Interessen wie Gewinnorientierung und Eigennutz haben sich als Moralwerte in der Gesellschaft etabliert.
Während Unternehmen enorme Gewinne durch sinkende Lohnkosten in Entwicklungsländern erwirtschaften, der CO2-Ausstoß stetig ansteigt, sich Umweltschäden kontinuierlich ausweiten und der Machtbereich von Unternehmen undefinierbare Aus-maße annimmt, wird der Ruf nach einer nachhaltigen, sozialen und ökologischen Un-ternehmensführung lauter.
So entstanden durch die Globalisierung und die oben erwähnten Nebeneffekte Denkansätze und Vorschläge von Wissenschaftlern, Diskussionen und Gesetze auf politischer Ebene, um den weitreichenden gesellschaftlichen Spätfolgen Einhalt zu gebieten und diese in ihrem Ausmaß einzudämmen. In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff Corporate Social Responsibility entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corporate Social Responsibility
- Definition
- Historische Entwicklung in Europa
- Interessengruppen
- Stakeholderansatz
- Shareholderansatz
- Instrumente von CSR
- Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Verhaltenskodex
- Gütesiegel
- Praxisbeispiele
- RWE
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Frage, ob sich gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg vereinbaren lassen. Im Zentrum steht der Begriff der Corporate Social Responsibility (CSR), welcher im Laufe der Arbeit definiert und historisch eingeordnet wird.
- Definition und Entwicklung von CSR
- Stakeholder- und Shareholderansatz im Kontext von CSR
- Instrumente und Praxisbeispiele von CSR
- Der Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Corporate Social Responsibility
Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe und Abgrenzungen des Begriffs Corporate Social Responsibility. Es werden verschiedene Definitionen und Auffassungen von CSR dargestellt, wobei insbesondere die Definition der EU-Kommission aus dem Jahr 2001 hervorgehoben wird. Außerdem werden sieben grundlegende Prinzipien von CSR vorgestellt, die für Unternehmen bei der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung relevant sind.
Kapitel 2.2: Historische Entwicklung in Europa
Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung von CSR in Europa. Es wird gezeigt, dass die Idee des gesellschaftlichen Engagements in Deutschland bereits im 19. Jahrhundert wurzelt. Der Fokus liegt jedoch auf der Entwicklung des CSR-Konzeptes in der EU, beginnend mit der Veröffentlichung des Grünbuches „Promoting a framework for Corporate Social Responsibility“ im Jahr 2001. Die weiteren Schritte der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung werden erläutert, wobei die Gründung des „European Multi-Stakeholder-Forum“ im Jahr 2002-2004 eine wichtige Rolle spielt. Die Entwicklung des CSR-Konzeptes wird anhand von Abbildung 1 dargestellt.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility, Stakeholderansatz, Shareholderansatz, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Verhaltenskodex, Gütesiegel, Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit, Gesellschaftliche Verantwortung, Unternehmensethik
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen für nachhaltiges Handeln in sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereichen.
Lassen sich Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg vereinbaren?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Unternehmen durch nachhaltige Strategien langfristig Wettbewerbsvorteile erzielen und Risiken minimieren können.
Was ist der Unterschied zwischen Stakeholder- und Shareholder-Ansatz?
Der Shareholder-Ansatz fokussiert auf die Interessen der Eigentümer, während der Stakeholder-Ansatz alle Interessengruppen (Mitarbeiter, Kunden, Umwelt) einbezieht.
Welche Instrumente für CSR gibt es?
Wichtige Instrumente sind Nachhaltigkeitsberichte, Verhaltenskodizes (Codes of Conduct) und Gütesiegel für faire Produktion.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit genannt?
Die Arbeit zieht den Energiekonzern RWE als Praxisbeispiel heran, um die Umsetzung von CSR-Maßnahmen zu verdeutlichen.
- Citation du texte
- Thimo Schröder (Auteur), 2012, Corporate Social Responsibility - Wie lassen sich gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg vereinbaren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191664