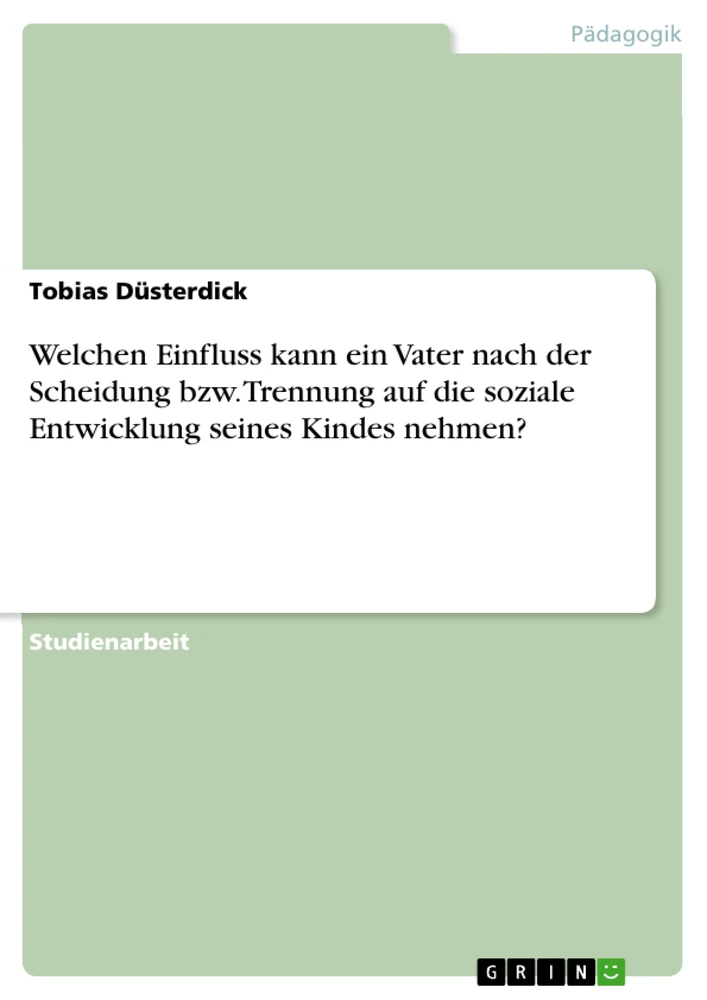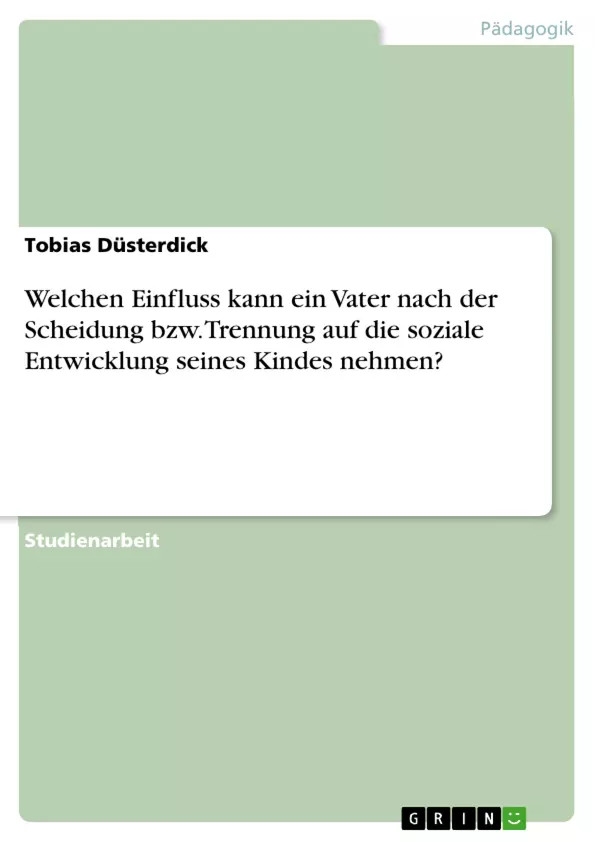Dem jährlichen Verlauf der Scheidungs- und Trennungsrate in Deutschland folgend, stieg die Anzahl derjenigen minderjährigen Personen kontinuierlich an, die von diesen Ereignissen betroffen waren. So wurden beispielsweise im Jahr 2010 145 146 Kinder mit der Scheidung ihrer Eltern konfrontiert. Bei der erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Betrachtung dieser Personengruppe erwies es sich dabei stets als auffällig, dass die betroffenen Kinder auf die Trennung ihrer Eltern höchst unterschiedlich reagieren.1 Trotz der intensiven Forschung der letzten 20 Jahre konnte kein Konsens darüber erzielt werden, welche Rolle der Vater in Bezug auf die Scheidungs- und Trennungsfolgen bei den betroffenen Kindern inne hat. Das spiegelt sich an den heterogenen Untersuchungsergebnissen in diesem Kontext deutlich wieder. Deswegen dient die vorliegende Arbeit dazu, eine eigene Stellung zu diesem Problemfeld zu beziehen. Sie trägt den Titel Eine differenzierte Auseinandersetzung über den Einfluss der verringerten Verfügbarkeit von Vätern in Folge von Scheidung oder Trennung auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz ihrer Söhne.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familie, Ehe, eheähnliche Gemeinschaft, Scheidung und Trennung
- Soziale Kompetenz
- Der Einfluss des Vaters auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz seines Sohnes
- Der direkte Einfluss des Vaters auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz
- Der indirekte Einfluss des Vaters auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz
- Mögliche Folgen der Trennung auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz
- Geschlechtsspezfische Folgen von Trennung bei männlichen Kindern
- Mögliche zeitliche Verlaufsformen der Folgen
- Zusammenhang zwischen möglichen Folgen und dem Einfluss des Vaters
- Der direkte Einfluss des Vaters nach der Trennung oder Scheidung
- Der indirekte Einfluss des Vaters nach der Trennung oder Scheidung
- Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren
- Personale Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes
- Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren innerhalb der Triade Mutter-Vater-Kind
- Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren außerhalb der Triade Mutter-Vater-Kind
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Trennung oder Scheidung von Eltern auf die soziale Kompetenz ihrer Söhne. Der Fokus liegt insbesondere auf der Rolle des Vaters und dessen verringerter Verfügbarkeit nach einer Trennung. Die Arbeit untersucht, welche direkten und indirekten Auswirkungen diese Veränderung auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz von Jungen hat.
- Die Bedeutung der Familie und der Vater-Sohn-Beziehung für die Entwicklung der sozialen Kompetenz
- Die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf die Vater-Sohn-Beziehung
- Mögliche negative Folgen von Trennung und Scheidung für die soziale Kompetenz von Jungen
- Resilienzfaktoren, die den negativen Auswirkungen der Trennung entgegenwirken können
- Der Einfluss von rechtlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Normen auf die Verfügbarkeit von Vätern nach einer Trennung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den systemtheoretischen Ansatz und stellt die Familie als ein soziales System dar. Es werden die Begriffe Ehe, eheähnliche Gemeinschaft, Scheidung und Trennung definiert und rechtliche Regelungen zum Sorgerecht und der Verfügbarkeit von Vätern nach einer Trennung beleuchtet. Das zweite Kapitel definiert und operationalisiert den Begriff der sozialen Kompetenz und grenzt ihn von sozialen Kompetenzdefiziten und sozialen Fertigkeiten ab. Zudem werden die Faktoren beleuchtet, die die individuelle Ausprägung der sozialen Kompetenz beeinflussen.
Im dritten Kapitel wird der direkte und indirekte Einfluss eines konstant verfügbaren Vaters auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz seines Sohnes anhand von Beispielen dargestellt. Die Kapitel 4 und 5 beleuchten die möglichen negativen Folgen von Trennung und Scheidung für die soziale Kompetenz von Jungen und analysieren den Einfluss des Vaters auf diese Folgen. In Kapitel 6 werden Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung behandelt.
Schlüsselwörter
Soziale Kompetenz, Vater-Sohn-Beziehung, Trennung, Scheidung, Resilienz, Vulnerabilität, Familienrecht, systemtheoretischer Ansatz, Entwicklungspsychologie
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst eine Scheidung die soziale Kompetenz von Söhnen?
Die Arbeit untersucht, wie die verringerte Verfügbarkeit des Vaters direkte und indirekte Auswirkungen auf die Entwicklung sozialer Fertigkeiten und das Verhalten von Jungen hat.
Welche Rolle spielt der Vater als Vorbild?
Der Vater hat einen direkten Einfluss durch Interaktion und einen indirekten Einfluss durch die Gestaltung des familiären Systems, was für die Identitätsbildung des Sohnes entscheidend ist.
Was sind Resilienzfaktoren in diesem Kontext?
Resilienzfaktoren sind Schutzmechanismen wie eine stabile Mutter-Kind-Beziehung, personale Stärken des Kindes oder ein unterstützendes soziales Umfeld außerhalb der Familie.
Gibt es geschlechtsspezifische Folgen bei Trennungen?
Ja, die Untersuchung legt einen Fokus auf männliche Kinder, da diese oft spezifisch auf das Fehlen einer männlichen Bezugsperson reagieren.
Wie wirkt sich das Sorgerecht auf die Vater-Kind-Beziehung aus?
Rechtliche Rahmenbedingungen bestimmen die Zeit und Qualität der Verfügbarkeit des Vaters, was wiederum die soziale Entwicklung des Kindes maßgeblich prägt.
- Quote paper
- Tobias Düsterdick (Author), 2012, Welchen Einfluss kann ein Vater nach der Scheidung bzw. Trennung auf die soziale Entwicklung seines Kindes nehmen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191667