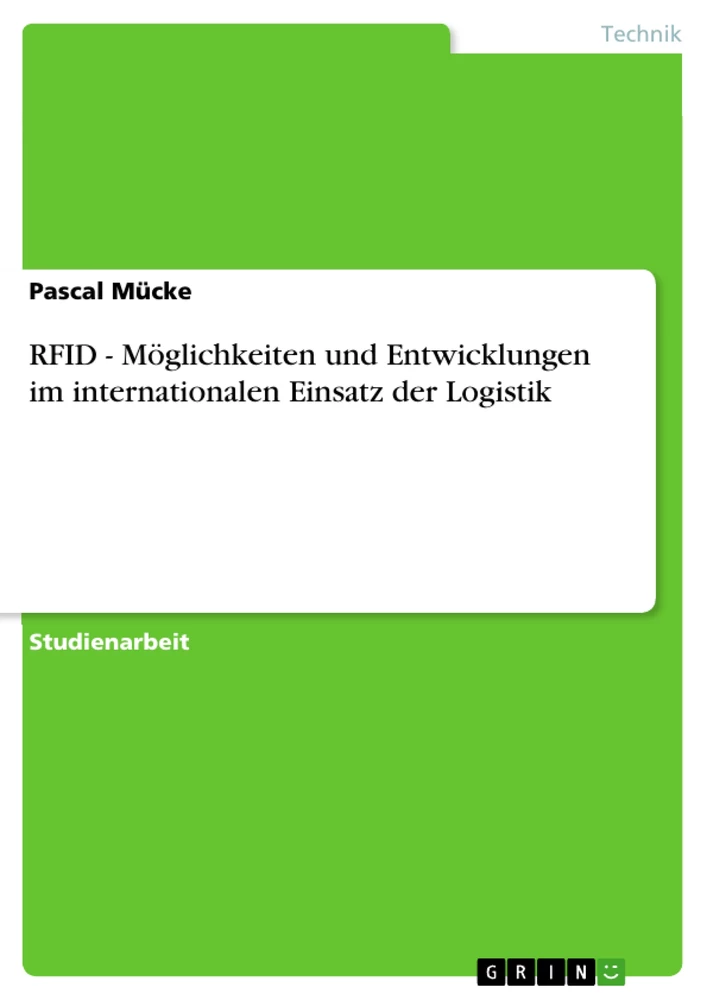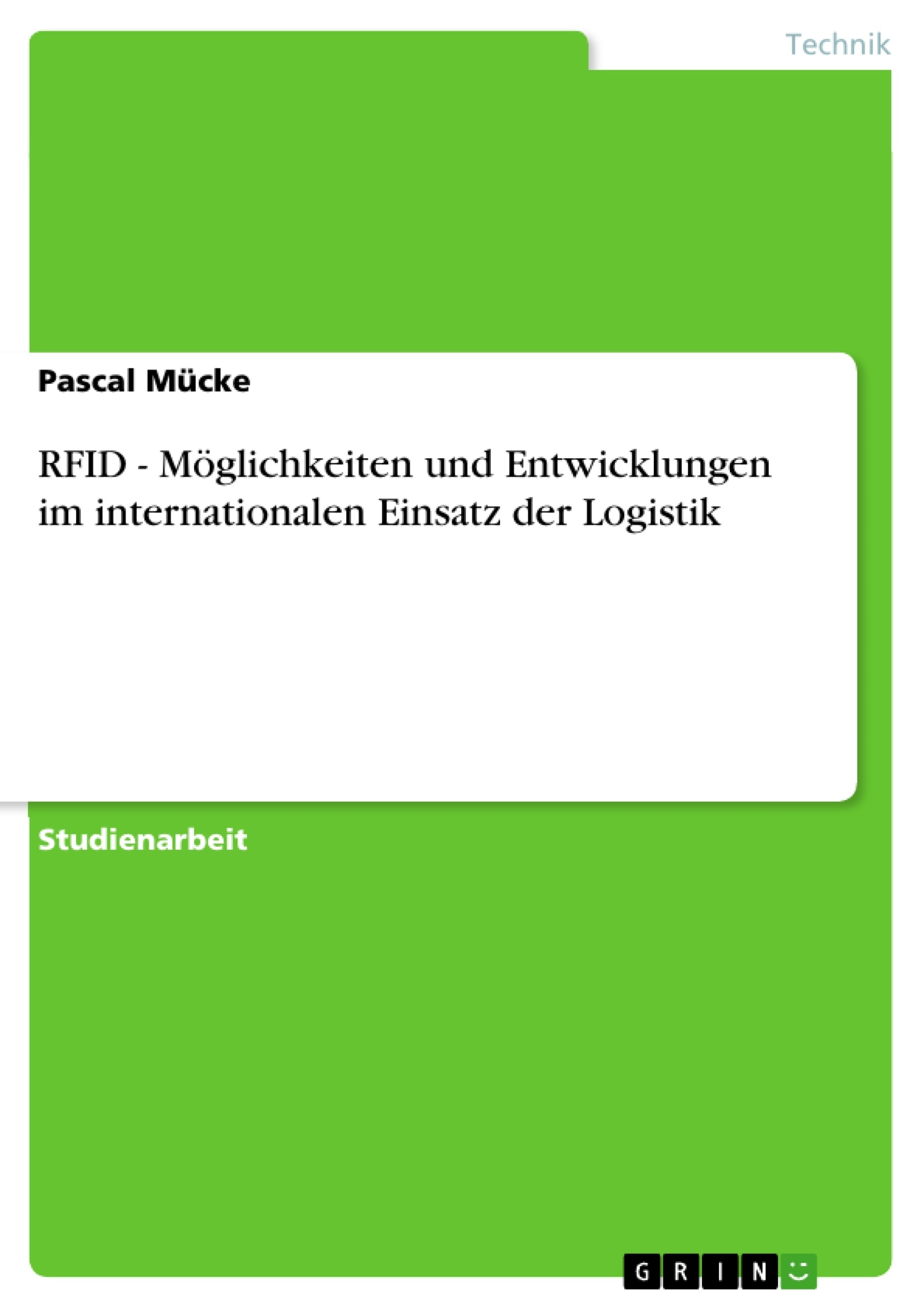Das Wirtschaften im 21. Jahrhundert findet zunehmend auf globaler Ebene statt. Für Verbraucher ist es heute eine Selbstverständlichkeit eine große Auswahl an Konsumgütern unterschiedlichster Herkunft in den Geschäften vorzufinden. Konsumenten erwarten aufgefüllte Regale und ein vollständiges Sortiment. Wir alle können dies alltäglich in unserem Umfeld beobachten. Nur wenige fragen sich, auf welche Art und Weise diese Güter überhaupt in die Geschäfte gelangen. Im Hintergrund steht oft eine komplexe logistische Prozesskette, deren Planung, Koordination und Kontrolle enormen Aufwand für die beteiligten Unternehmen darstellt.
Die Logistik von Waren und Informationen hat innerhalb der Gesellschaft einen essentiellen Teil des täglichen Lebens eingenommen und bestimmt als unternehmensübergreifende Dienstleistung die Taktrate unserer Wirtschaft. Unternehmen und Privatpersonen existieren in starker Abhängigkeit mit dem interdependenten System der Logistik. Wachsende geographische Distanzen und vielschichtige Arbeitsteilung führen dazu, dass die Logistik als Querschnittsfunktion einen steigenden Anteil an der Wertschöpfungskette einnimmt. Verbraucher wie Unternehmen profitieren gleichsam von Einsparpotentialen in diesem Bereich. Transport- und Logistikdienstleister stehen hier in der Pflicht höchsten Anforderungen zu genügen. Die Effizienz von Informations- und Güterflüssen muss demnach vor dem Hintergrund neu auftauchender Technologien ständig neu hinterfragt werden.
Die Motivation dieser Arbeit ist es, die sich durch Radio Frequency Identification Technik, kurz RFID, ergebenden Optimierungspotentiale und Anwendungsmöglichkeiten zu analysieren.
Die RFID-Technologie begleitet uns schon seit Jahren verdeckt in unserem Alltag und findet in der Praxis immer mehr sinnvolle Anwendungen. Als sogenanntes Automated Identification (AUTO-ID) Verfahren wird es neben dem weit verbreiteten Barcode als verbessertes Warenidentifikationssystem mit hohem Potential gehandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Logistik
- Begriffsdefinition
- Schlüsselanforderungen des Logistikservice
- Logistikkosten
- Theoretische Grundlagen der RFID-Technologie
- Prinzipielle Funktionsweise
- Systemkomponenten
- Transponder
- Lesegeräte (Reader)
- Differenzierungsmerkmale
- Energieversorgung
- Speicherfähigkeit
- Frequenzbereiche
- Transponder-Bauformen
- Reader-Bauformen
- Standardisierung
- Global Standards-1
- EPCglobal Network
- Frequenzbereiche
- RFID versus Barcode
- Gefahren und Risiken
- Datensicherheit und Datenschutz bei RFID Systemen
- Entkoppelung von menschlicher Führung
- Einsatzmöglichkeiten der RFID-Technik
- Transaktionskostenminimierung
- Intralogistische Prozesse
- Wareneingang
- Inventur und Bestandsführung
- Produktionssteuerung
- Kommissionierung
- Supply Chain Management
- Bullwhipeffekt
- Das Internet der Dinge
- Erweiterung der EDI-Verfahren
- Efficient Customer Response (ECR)
- Vendor Managed Inventory
- Cross-Docking
- Praktische Referenz - DHL Innovation Center
- Einflussfaktoren und Ausblick
- Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsaspekte
- Nutzenpotentiale
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Prozessmodifikation und Integration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der RFID-Technologie und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Logistik. Ziel ist es, die Funktionsweise der Technologie zu erläutern, ihre Einsatzgebiete in der Intralogistik und dem Supply Chain Management zu beleuchten und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen aufzuzeigen.
- Funktionsweise und Funktionsweise der RFID-Technologie
- Einsatzgebiete in der Intralogistik und im Supply Chain Management
- Nutzen und Wirtschaftlichkeit von RFID-Systemen
- Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von RFID
- Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Trends im Bereich der RFID-Technologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Motivation und Zielsetzung der Arbeit dar. Es bietet eine kurze Einführung in das Thema RFID und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Logistik: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Begriffe und Konzepte der Logistik und behandelt Schlüsselanforderungen sowie die Bedeutung von Logistikkosten.
- Theoretische Grundlagen der RFID-Technologie: In diesem Kapitel wird die Funktionsweise der RFID-Technologie im Detail erklärt. Es werden die Systemkomponenten, Differenzierungsmerkmale, Standardisierung und die Vorteile von RFID im Vergleich zu Barcodes erläutert. Außerdem werden potenzielle Gefahren und Risiken beleuchtet, wie z. B. Datensicherheit und Datenschutz.
- Einsatzmöglichkeiten der RFID-Technik: Dieses Kapitel widmet sich den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der RFID-Technologie in der Logistik. Es werden verschiedene Szenarien vorgestellt, wie z. B. die Transaktionskostenminimierung, die Optimierung von intralogistischen Prozessen und die Verbesserung des Supply Chain Managements.
- Einflussfaktoren und Ausblick: Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Einflussfaktoren und zukünftigen Entwicklungen im Bereich der RFID-Technologie. Es analysiert die Nutzenpotentiale, die Wirtschaftlichkeit und die Auswirkungen auf bestehende Prozesse.
Schlüsselwörter
RFID, Logistik, Intralogistik, Supply Chain Management, Transaktionskosten, Datensicherheit, Datenschutz, Standardisierung, EPCglobal Network, Bullwhipeffekt, Internet der Dinge, EDI, ECR, Vendor Managed Inventory, Cross-Docking, Wirtschaftlichkeit, Prozessmodifikation, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist RFID und wie funktioniert es?
RFID steht für Radio Frequency Identification. Es nutzt Radiowellen, um Daten kontaktlos von einem Transponder (Tag) an ein Lesegerät zu übertragen.
Welche Vorteile bietet RFID gegenüber dem Barcode?
RFID ermöglicht Pulkerfassung (viele Tags gleichzeitig), benötigt keinen direkten Sichtkontakt und die Daten auf den Tags können oft verändert oder ergänzt werden.
Wo wird RFID in der Logistik eingesetzt?
Typische Einsatzgebiete sind die Bestandsführung, Inventur, Produktionssteuerung, Kommissionierung sowie die Verfolgung von Waren in der gesamten Supply Chain.
Welche Risiken gibt es beim Einsatz von RFID?
Herausforderungen liegen vor allem im Datenschutz, der Datensicherheit und den hohen Implementierungskosten für Infrastruktur und Transponder.
Was ist der EPC (Electronic Product Code)?
Der EPC ist ein globaler Standard zur eindeutigen Identifizierung von Produkten, der oft in Kombination mit RFID-Technik im EPCglobal Network genutzt wird.
- Arbeit zitieren
- Pascal Mücke (Autor:in), 2012, RFID - Möglichkeiten und Entwicklungen im internationalen Einsatz der Logistik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191690