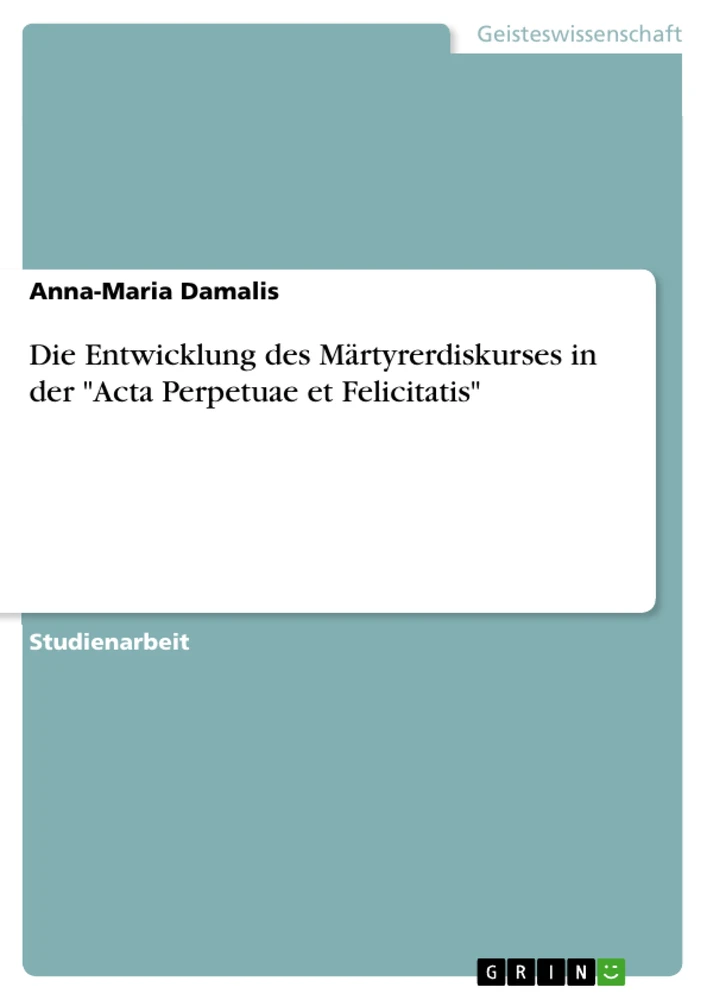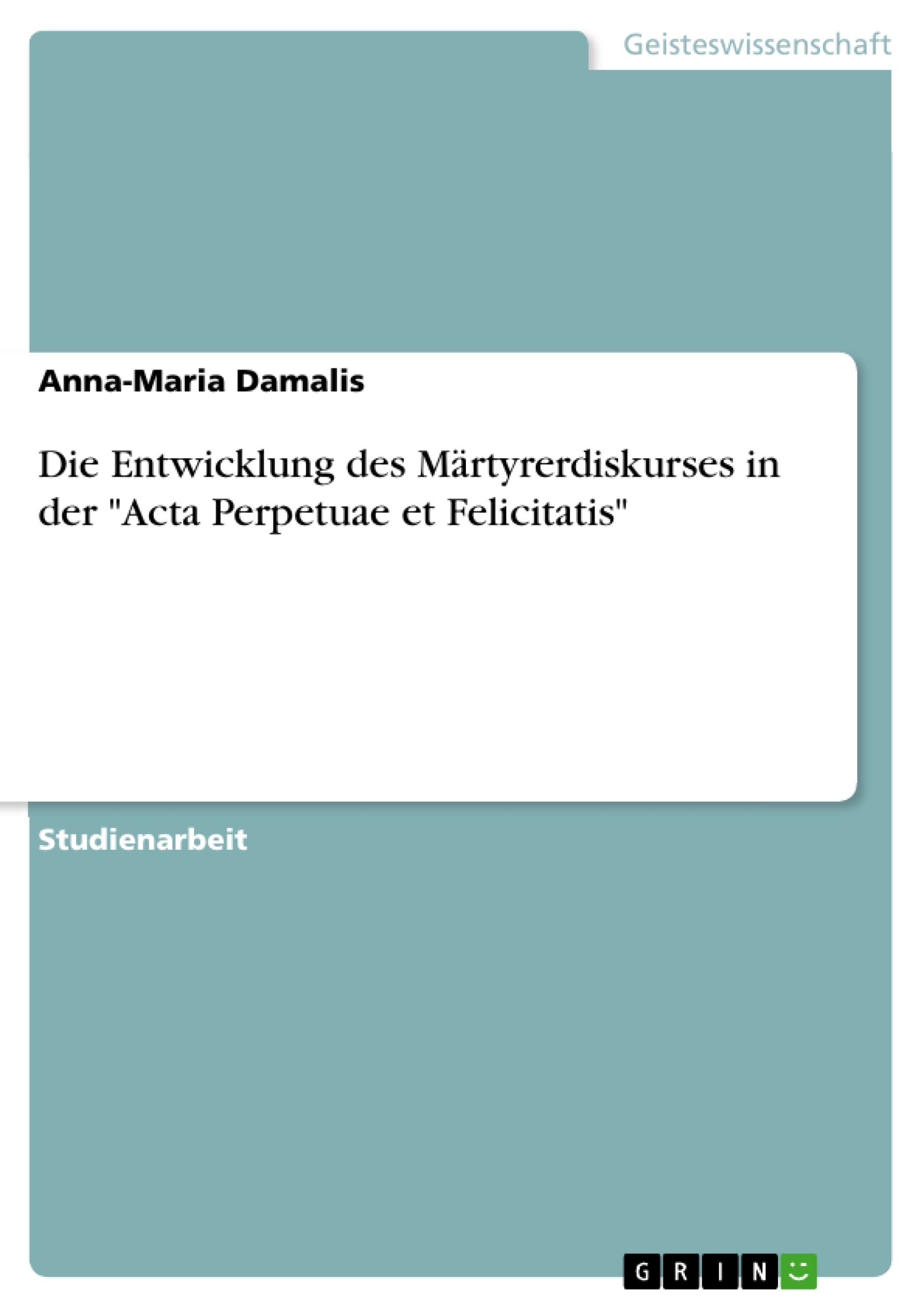Die Acta haben im Gegensatz zur Passio bis heute kaum Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs um die Märtyrerliteratur gefunden. Zurückzuführen ist dieses Phänomen partiell sicherlich – auch wenn nicht eindeutig belegbar - auf deren zeitliche Nachordnung und Abhängigkeit der Passio gegenüber. Auch wird den Acta häufig der Anspruch auf literarische Qualität abgesprochen, obwohl diese wahrscheinlich nicht im Fokus der Verfasser gestanden haben mag. Viel mehr orientierten sich diese und auch andere Märtyrerschriften an dem Vulgärlatein ihrer größten Zielgruppe – den niederen sozialen Schichten. Des Weiteren bemerken Poccetti et al.: „Das Paradox ‚im Niederen’ gerade den Grund für das ‚Erhabene’ zu finden, begründet in der christlichen Kultur die Rhetorik der Antirhetorik. Schließlich ist es gerade die allgemeine Anpassung an einen sermo humilis, die die Haltung des christlichen Autors charakterisiert, mag er nun wenig oder hoch gebildet sein, da […] das Thema der Rettung an sich erhaben ist.“ Die zwei geläufigen Formen der Acta sind Cornelius Van Beek zu verdanken, der 1936 als Erster und Letzter die Mühen der Editierung auf sich genommen hat. Alle anderen Kommentare beziehen sich auf Van Beeks Fassungen, allerdings ist zu bemerken, dass bis heute kein ausführlicher Textkommentar existiert.
Die Verkennung dieser Werke der Märtyrerliteratur findet zu Lasten der wissenschaftlichen Erkenntnis statt. „Durch die Adaption an die Bedürfnisse und Gegebenheiten in der Kirche … wurden die meisten der Texte (immer wieder) überarbeitet und so verändert.“ Daher bieten sich solche Alternativfassungen geradezu an, in der vergleichenden Perspektive als Hilfsmittel bei der Rekonstruktion der Entwicklung des Märtyrerdiskurses und der Kirche im Allgemeinen zu fungieren. Und eben diese Linie soll nun im Weiteren verfolgt werden, um die Motive, die hinter diesen Überarbeitungen der Passio stehen, zum Vorschein zu bringen. Hierbei sollen drei zentrale Textstellen besondere Beachtung finden: die erste Vision Perpetuas, das Verhör Perpetuas vor Gericht und die Hinrichtungsszene mit Schlussformel, bei der allerdings nur noch besonders exemplarische Passagen herausgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkungen
- II. Grundsätzliche Unterschiede zur Passio
- III. Perpetuas Vision von der Leiter
- IV. Das Verhör Perpetuas
- V. Martyrium und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung des Märtyrerdiskurses anhand der Acta Perpetuae et Felicitatis und vergleicht diese mit der Passio. Sie analysiert die Unterschiede in den Texten und identifiziert die Motive für diese Veränderungen.
- Entwicklung des Märtyrerdiskurses
- Vergleich der Acta mit der Passio
- Motive der Textänderungen
- Die Bedeutung von Zeit und Ort
- Die Rolle der Märtyrerakten in der Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Vorbemerkungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten der Acta Perpetuae et Felicitatis und stellt sie in den Kontext der Märtyrerliteratur.
- II. Grundsätzliche Unterschiede zur Passio: Dieses Kapitel vergleicht die Acta mit der Passio und beleuchtet die Unterschiede in Bezug auf Zeit, Ort, Personen und Textlänge.
- III. Perpetuas Vision von der Leiter: Dieses Kapitel analysiert die erste Vision der Perpetua, die in der Passio und den Acta unterschiedlich dargestellt wird.
- IV. Das Verhör Perpetuas: Dieses Kapitel beleuchtet die Verhörung Perpetuas vor Gericht und zeigt die Unterschiede in der Darstellung durch die Passio und die Acta.
Schlüsselwörter
Märtyrerdiskurs, Acta Perpetuae et Felicitatis, Passio, Märtyrerliteratur, Vergleichende Textanalyse, Christentum, Frühe Kirche, Rhetorik, Antirhetorik, Sermo Humilis, Identifikationsmerkmale, Märtyrerkalender.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen der 'Acta' und der 'Passio' Perpetuae?
Die Acta ist eine spätere Überarbeitung der ursprünglichen Passio, die oft an die Bedürfnisse der Kirche angepasst und in der Rhetorik verändert wurde.
Warum wurde die Märtyrerliteratur oft überarbeitet?
Überarbeitungen dienten dazu, die Texte für liturgische Zwecke (z. B. Märtyrerkalender) zu optimieren oder theologische Akzente der jeweiligen Zeit zu setzen.
Was bedeutet 'Sermo Humilis' in der christlichen Literatur?
Es bezeichnet einen einfachen Schreibstil (Vulgärlatein), der sich gezielt an die niederen sozialen Schichten richtete, um die Heilsbotschaft verständlich zu machen.
Welche Bedeutung hat Perpetuas Vision von der Leiter?
Die Vision ist eine zentrale Textstelle, die den Aufstieg zum Martyrium symbolisiert; die Arbeit vergleicht, wie diese Szene in Acta und Passio unterschiedlich dargestellt wird.
Wer edierte die Acta Perpetuae et Felicitatis maßgeblich?
Cornelius Van Beek unternahm 1936 die wichtige Arbeit der Editierung der zwei geläufigen Formen der Acta.
- Arbeit zitieren
- Anna-Maria Damalis (Autor:in), 2006, Die Entwicklung des Märtyrerdiskurses in der "Acta Perpetuae et Felicitatis", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191787