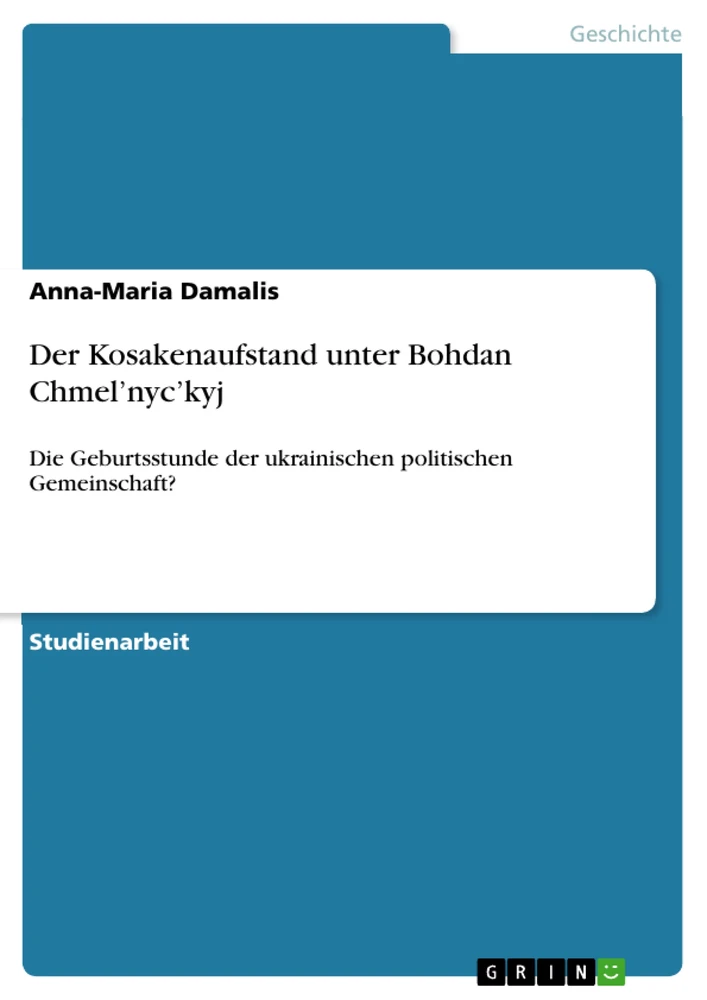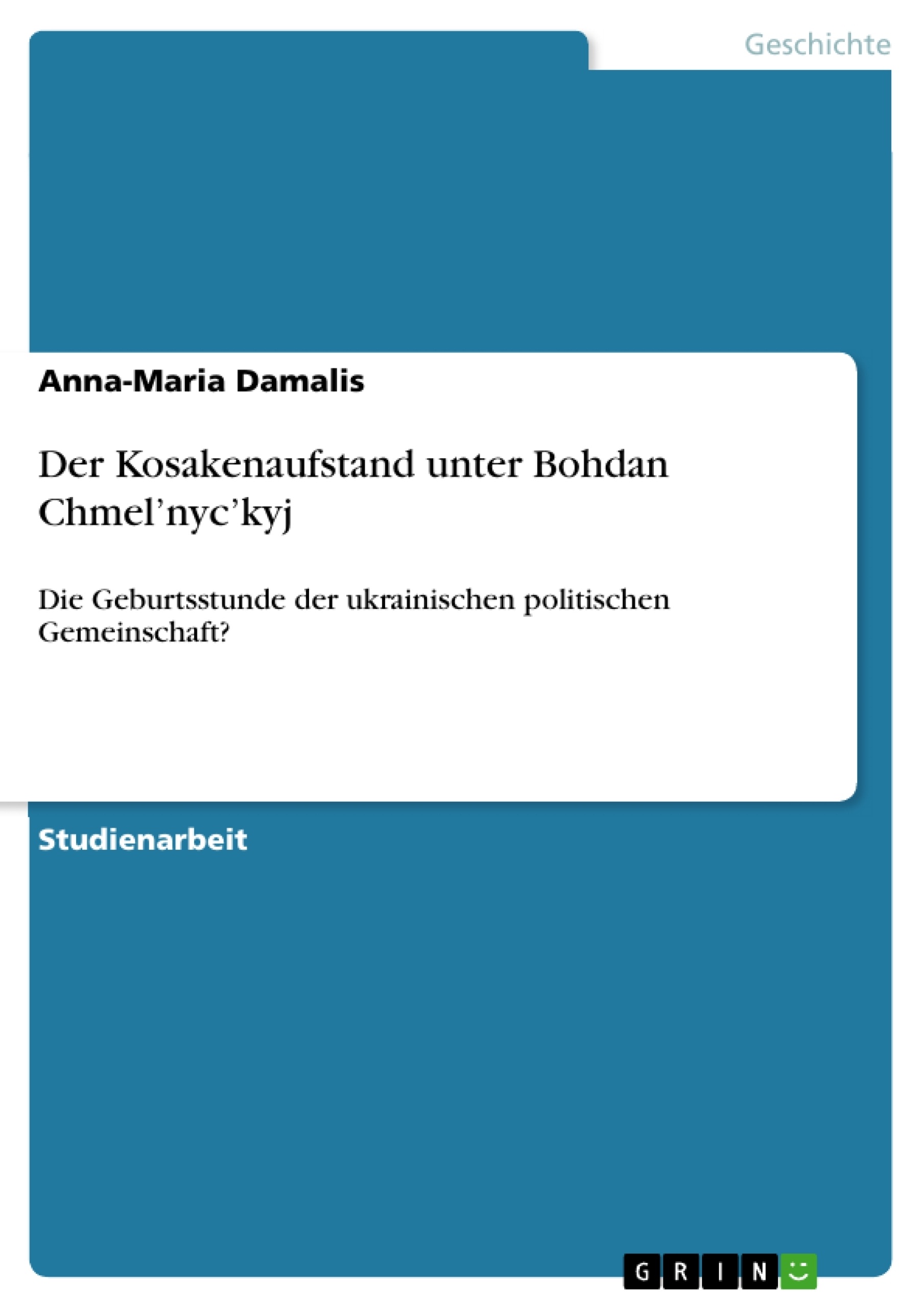I. Einleitung
Im Jahr 1648 entfachte der Kosakenführer Bohdan Chmel’nyc’kyj einen der größten Aufstände der frühneuzeitlichen osteuropäischen Geschichte. Fast zehn Jahre sollte sich dieser Aufstand hinziehen und den weiteren Verlauf der Geschichte Osteuropas maßgeblich prägen. Der Aufstand markiert den Zeitpunkt des beginnenden Machtverfalls des polnischen-litauischen Reiches, den Eintritt des Zarenreichs in das Spiel um die westlich von ihm gelegenen Gebiete und das Erscheinen eines geographisch definierten kosakisch-ukrainischen Raums. Seiner historischen Bedeutsamkeit entsprechend hat dieses Jahrzehnt besondere Aufmerksamkeit der osteuropäischen wie der westlichen Historiographie erfahren. Die Forschungsarbeiten zeichnen sich durch eine Vielzahl von Kontroversen aus und stehen nicht selten in Zusammenhang mit politischer Instrumentalisierung. Für ukrainische Historiker schien die Maxime zu gelten, die ukrainische Eigenstaatlichkeit für diese Zeit nachzuweisen und so spätere Unabhängigkeitsbestrebungen zu legitimieren. Russische und dann sowjetische Forscher fanden in dieser Periode Argumente für die Einordnung der Ukraine in den russischen bzw. sowjetischen Staatsverband. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor diese Diskussion nicht an Brisanz.
Mit der Politisierung, so kritisiert Kumke, ging eine stark dualistische Sichtweise einher, die in der ukrainischen und westlichen Forschung dazu führte, dass die Kosaken als abgeschlossenes Phänomen betrachtet wurden. Dieses wurde mit den Attributen „Freiheitsstreben“ und „demokratisch organsiert“ versehen und so als Antagonismus zur polnischen Feudalherrschaft und russischen Despotie konzipiert. Der Aufstand Chmel’nyc’kyjs wurde sodann mit der Gründung eines Kosakenstaates gleichgesetzt, dem dieselben Merkmale zugeschrieben wurden. Problematisch erscheinen diese aufgrund der verwendeten modernen Terminologien. Das Diktum der demokratisch organisierten Kosaken eignet sich nur bedingt, um eine Gemeinschaft zu beschreiben, die weder mit dem Mehrheitsprinzip vertraut war und noch einen abstrakten Begriff von individueller Freiheit entwickelt hatte. Staatliche Züge können in dem von den Kosaken beherrschten Gebiet durchaus ausgemacht werden, doch um einen Staat im Sinne Webers handelte es sich nicht...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangsbedingungen des Chmel'nyc’kyj-Aufstands
- Kosakische Gruppen im 16. und 17. Jahrhundert
- Kosaken, ukrainische Grenzgesellschaft und das polnisch-litauische Reich
- Zusammenfassung: Gründe für den Chmel'nyc'kyj-Aufstand
- Der Verlauf des Chmel'nyc'kyj-Aufstands
- Die drei wichtigsten Verträge des Aufstands im Vergleich
- Der Vertrag von Zboriv
- Das Abkommen von Perejaslav
- Der Vertrag von Hadjač
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung einer kosakisch-ukrainischen politischen Gemeinschaft während des Aufstands unter Bohdan Chmel'nyc'kyj (1648-1659). Sie befasst sich mit der Frage, inwieweit die unterschiedlichen Akteure, insbesondere die Kosakengruppen, ein „Gemeinschaftshandeln“ entwickelten und ob dies bereits 1648 existierte oder im Verlauf des Aufstands entstand.
- Die gesellschaftlichen Bedingungen vor dem Aufstand und die Gründe für dessen Ausbruch
- Die Rolle der Kosaken im polnisch-litauischen Reich und in der ukrainischen Grenzgesellschaft
- Die drei wichtigsten Verträge des Aufstands: Zboriv, Perejaslav und Hadjač
- Die Analyse der partizipierenden Gruppen und ihrer Agenden
- Die Frage nach der Existenz einer kosakisch-ukrainischen politischen Gemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die historische Bedeutung des Chmel'nyc'kyj-Aufstands und die Forschungsdebatte, die sich mit dem Aufstand und der Frage der ukrainischen Eigenstaatlichkeit beschäftigt. Es werden kritische Punkte zur dualistischen Sichtweise der Kosaken und zur Verwendung moderner Terminologien aufgezeigt.
- Das zweite Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Bedingungen vor dem Aufstand, die zum Ausbruch führten. Es werden die verschiedenen kosakischen Gruppen, ihre Beziehungen zum polnisch-litauischen Reich und die Gründe für den Aufstand beleuchtet.
- Das dritte Kapitel beleuchtet den Verlauf des Aufstands.
- Das vierte Kapitel analysiert und vergleicht die drei wichtigsten Verträge des Aufstands: Zboriv, Perejaslav und Hadjač. Dabei werden die beteiligten Akteure, die Vertragsinhalte und die jeweiligen Interessen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Schwerpunkte dieser Arbeit sind: Kosaken, Bohdan Chmel'nyc'kyj, Ukrainische Geschichte, Polnisch-Litauisches Reich, Zarenreich, politische Gemeinschaft, Staatsbildung, Verträge, Zboriv, Perejaslav, Hadjač, Forschungsdebatte, historiographische Kontroversen.
- Quote paper
- Anna-Maria Damalis (Author), 2011, Der Kosakenaufstand unter Bohdan Chmel’nyc’kyj, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191795