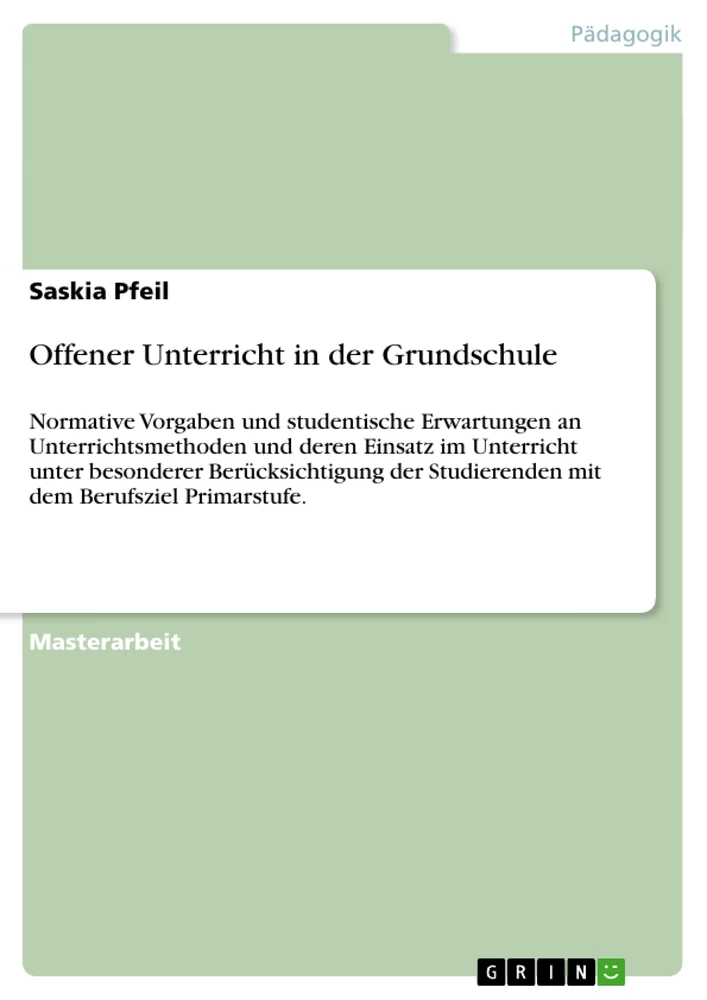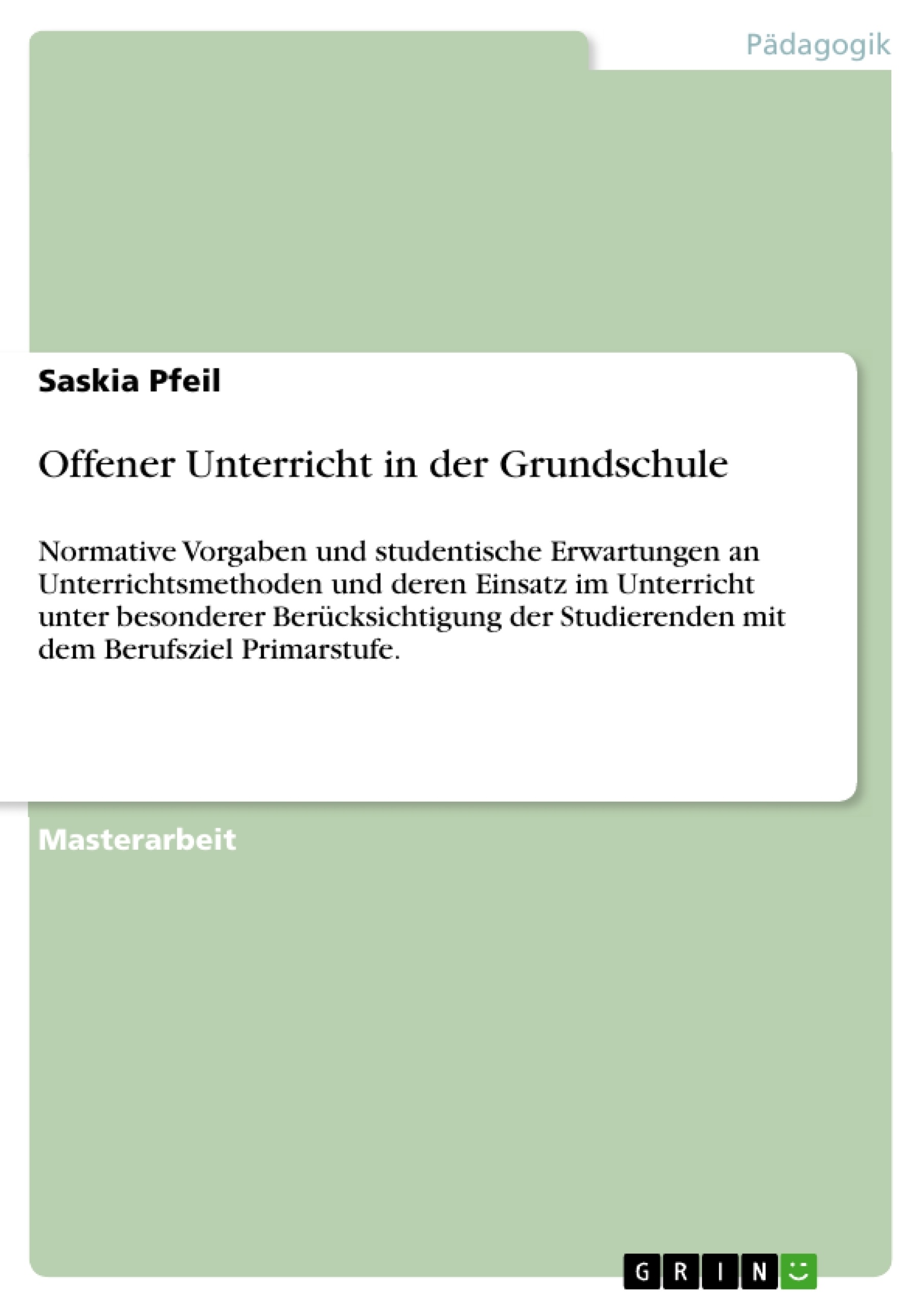Die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler ist einem ständigen Wechsel unterzogen und erfordert immer wieder aufs Neue eine Anpassung an die veränderte Berufs- und Arbeitswelt sowie die gesamte Umwelt. Auf Grund dessen wird auch in den aktuellen Diskussionen immer häufiger über notwendige innerschulische als auch außerschulische Veränderungen gesprochen - von einer „Öffnung der Schule“. Diese sollen den Schülerinnen und Schülern im täglichen Unterrichtsalltag die Chance bieten, sich durch Mitbestimmungs- und Gestaltungsprozesse besser auf die Lebenswelt vorbereiten zu können. Auch der Aspekt der Heterogenität spielt eine bedeutende Rolle, denn schließlich handelt es sich um individuelle Lernerinnen und Lerner, die auf unterschiedliche Weisen gefordert bzw. gefördert werden müssen. Im Rahmen meines Studiums wurde ich in verschiedenen Praktika immer wieder ansatzweise mit Formen des offenen Unterrichts konfrontiert. Was genau eine offene Unterrichtsgestaltung auszeichnet und ob diese den Vorgaben des Bildungssystems in Rheinland-Pfalz gerecht wird, soll in der folgenden Masterarbeit zum Thema „Offener Unterricht in der Grundschule. Normative Vorgaben und studentische Erwartungen an Unterrichtsmethoden und deren Einsatz im Unterricht unter besonderer Berücksichtigung der Studierenden mit dem Berufsziel Primarstufe.“ dargelegt und näher erläutert werden. Wenn ständig auf mehr Selbstständigkeit und Individualität im Unterricht gepocht wird, muss in diesem Zusammenhang geklärt werden, was angehende Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer über die Konzepte offenen Unterrichts wissen und was sie von deren Einsatz halten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsablauf
- 2.1 Problembenennung und Operationalisierung
- 2.2 Empirische Forschungsmethoden
- 2.3 Fragebogen und Durchführung
- 2.4 Datenanalyse und Auswertung
- 3 Bildungssystem und Primarstufe in Rheinland-Pfalz
- 3.1 Strukturell-normativer Rahmen
- 3.2 Inhaltlich-pädagogischer Rahmen
- 3.3 Primarstufe in Rheinland-Pfalz
- 4 Konzepte offenen Unterrichts
- 4.1 Begründungsaspekte und Lehrerrolle
- 4.2 Wahldifferenzierter Unterricht
- 4.3 Tages- und Wochenplanarbeit
- 4.4 Projektarbeit
- 5 Studierendenbefragung
- 5.1 Problembenennung und Operationalisierung
- 5.2 Hypothesen und Arbeitsthesen
- 5.3 Auswahl und Anwendung der Forschungsmethode
- 5.4 Stichproben- und Ergebnisdarstellung
- 6 Schluss
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Einsatz offener Unterrichtsformen in der Grundschule, insbesondere im Hinblick auf die normative Vorgaben des Bildungssystems in Rheinland-Pfalz und die Erwartungen von Studierenden mit dem Berufsziel Primarstufe. Die Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des offenen Unterrichts, analysiert die relevanten Vorgaben und analysiert die Einstellungen und Erwartungen von angehenden Grundschullehrern.
- Die Herausforderungen und Chancen des offenen Unterrichts im Kontext der heutigen Bildungslandschaft
- Der Einfluss von normativen Vorgaben des Bildungssystems auf die Praxis des offenen Unterrichts
- Die Erwartungen und Einstellungen von Studierenden an den offenen Unterricht und deren praktische Implementierung
- Die Analyse und Bewertung verschiedener Konzepte offenen Unterrichts, wie z.B. Wahldifferenzierter Unterricht, Tages- und Wochenplanarbeit sowie Projektarbeit
- Die Ergebnisse einer empirischen Studierendenbefragung zum Thema offener Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema des offenen Unterrichts und beleuchtet die Notwendigkeit von Veränderungen im Bildungssystem angesichts der sich wandelnden Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern. Anschließend wird der Forschungsablauf detailliert dargestellt, wobei der Fokus auf der Problembenennung, der Operationalisierung und den empirischen Forschungsmethoden liegt. Die Arbeit beleuchtet dann das Bildungssystem und die Primarstufe in Rheinland-Pfalz, um den normativen Rahmen des offenen Unterrichts zu verdeutlichen. Daraufhin werden verschiedene Konzepte des offenen Unterrichts vorgestellt und deren Begründungsaspekte sowie die Rolle der Lehrkraft im offenen Unterricht untersucht. Die Studierendenbefragung bildet den Kern der Arbeit und dient dazu, die Erwartungen und Einstellungen von angehenden Grundschullehrern zum Thema offener Unterricht zu analysieren.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Primarstufe, Bildungssystem Rheinland-Pfalz, Studierendenbefragung, Unterrichtsmethoden, Erwartungen, Normative Vorgaben, Wahldifferenzierter Unterricht, Tages- und Wochenplanarbeit, Projektarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet offenen Unterricht aus?
Offener Unterricht fördert Selbstständigkeit und Mitbestimmung durch Methoden wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit oder Projektunterricht.
Welche Rolle spielt die Heterogenität im offenen Unterricht?
Da Schüler unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, ermöglicht die Öffnung eine individuelle Förderung und Forderung jedes einzelnen Kindes.
Was sind normative Vorgaben für die Grundschule in Rheinland-Pfalz?
Es handelt sich um gesetzliche und pädagogische Rahmenbedingungen, die festlegen, welche Kompetenzen Schüler erreichen sollen und wie Unterricht gestaltet werden darf.
Was ist der Unterschied zwischen Tages- und Wochenplanarbeit?
Bei der Tagesplanarbeit werden Aufgaben für einen Tag festgelegt, während die Wochenplanarbeit den Schülern über eine ganze Woche hinweg Zeitmanagement abverlangt.
Wie stehen Lehramtsstudierende zum offenen Unterricht?
Studierende haben oft hohe Erwartungen an diese Methoden, müssen aber erst lernen, wie man die Balance zwischen Freiheit und notwendiger Struktur hält.
- Quote paper
- Saskia Pfeil (Author), 2011, Offener Unterricht in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191809