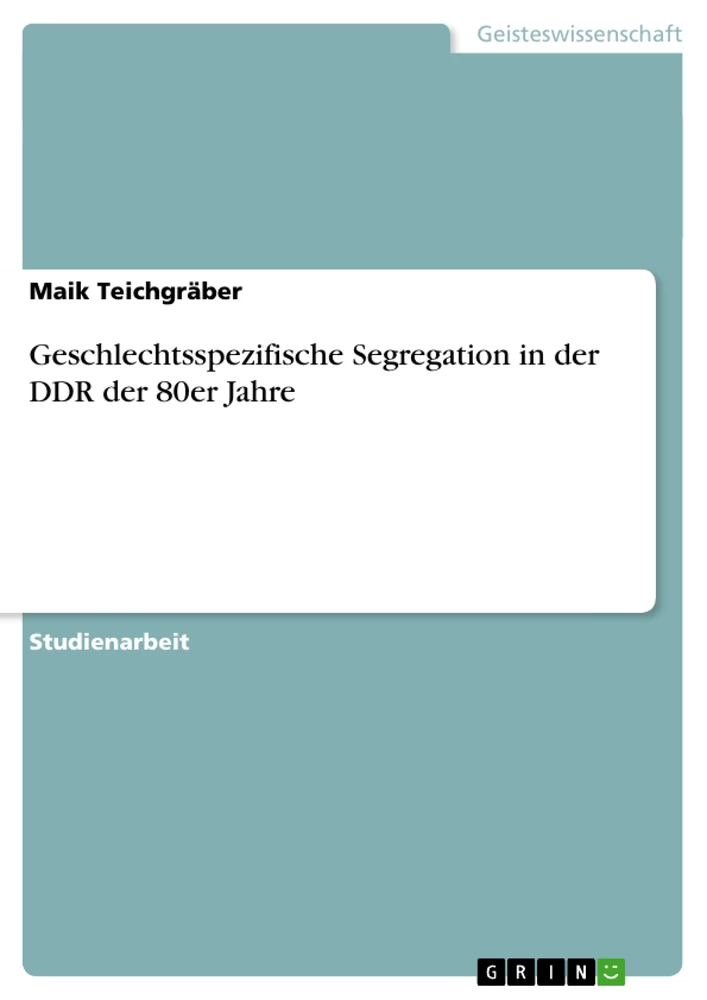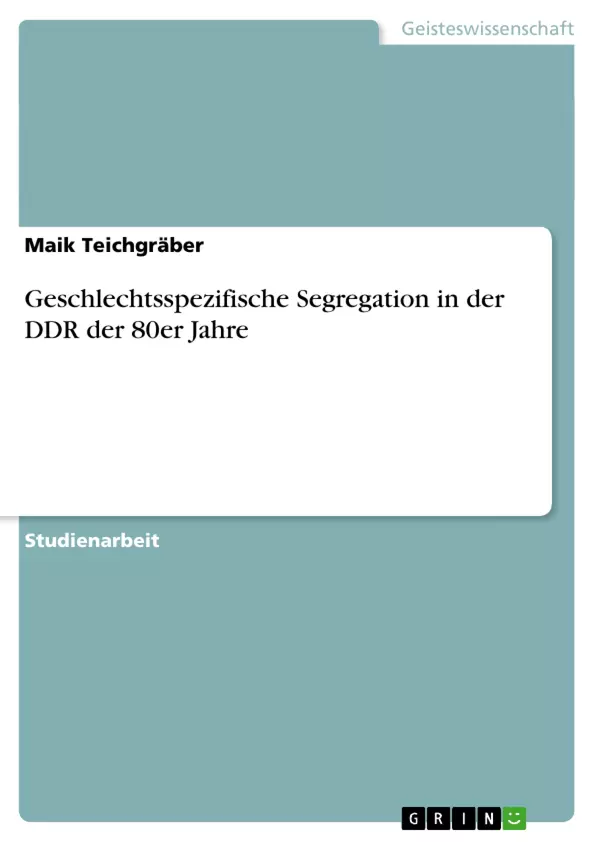Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 hat sich für die Bevölkerung der ehemaligen DDR die Situation des Arbeitslebens drastisch verändert. Die Hoffnung auf versprochene „blühenden Landschaften“ und ausreichend sichere Arbeitsplätze wurde schon bald gebremst und aufgegeben. Hohe Erwerbslosenquoten in den neuen Bundesländern, allein im März 2003 betrug diese laut Bundsanstalt für Arbeit 19,6 %, zeugen von rapiden Veränderungen innerhalb sozialer und ökonomischer Prozesse.
Besonders stark von dieser „...radikalen Restrukturierung und andauernden Arbeitsmarktkrise in Ostdeutschland [...] , welche die sich in den 1990er Jahren in Westdeutschland vollziehenden Wandlungsprozesse in ihrer Dramatik bei weitem übertraf...“, wurden die Frauen in Mitleidenschaft gezogen-
Die folgende Hausarbeit soll sich mit der Frage beschäftigen wie es zu einer solch nachhaltigen Entwicklung für die weibliche Bevölkerung der ehemaligen DDR kommen konnte. Den Mittelpunkt meiner Ausführungen wird dabei die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes bilden, aus der man Rückschlüsse und Gründe für eine erklärende Antwort finden kann. Besonders interessant und aussagekräftig stellt sich dabei der Zeitraum der 80er Jahre dar, indem „...91 Prozent aller Frauen berufstätig waren...“.
Susanne Diemer beschreibt in ihrem Aufsatz zum Problem weiblicher Erwerbstätigkeit die Situation der Frauen der DDR in den späten Achtzigern wie folgt: „...Im Zentrum sozialistischer Gleichberechtigungspolitik steht die Integration der Frauen in das Erwerbsleben. Kein anderer Aspekt der Gleichberechtigung, wie etwa die politische Partizipation von Frauen oder die Frage der familialen Arbeitsteilung fand, und findet sowohl theoretisch als auch praktisch vergleichbare Betrachtung. ...“.
Im Folgenden wird nach einer Begriffsklärung und der damit verbundenen historischen Einordnung des Problems, die geschlechtliche Arbeitsmarktteilung der DDR betrachtet. Beginnend mit einem kurzen Überblick, der die ökonomisch – soziale Entwicklung der „Nachkriegs – DDR“ bis zum Ende der Siebziger Jahre zugrunde legt, wird anschließend der Erwerbsverlauf der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik in den Achtzigern mit Hilfe empirischer Studien ausgewertet und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Begriffsklärung und historische Einordnung des Problems
- 2.2. Die Entwicklung der Arbeitsmarktsegregation der DDR von 1949 bis zum Ende der 70er Jahre
- 2.2.1. Ausgangsbedingungen und Wachstumskonstellationen
- 2.2.2. Beschäftigungsstruktur in der DDR von 1949 bis zum Ende der 70er Jahre
- 2.3. Die Situation des weiblichen Werktätigen in den 80er Jahren
- 2.4. Geschlechtsspezifische Segregation im Erwerbsverlauf im Kontext der familialen Entwicklung
- 2.5. Die Fluktuation Werktätiger der DDR der 80er Jahre als Ausdruck sozialer Konflikte
- 2.5.1. Der Begriff der Fluktuation in den 80er Jahren
- 2.5.2. Analyse der wichtigsten Fluktuationserscheinungen
- 2.5.2.1. Die betrieblichen Bedingungen, die die Werktätigen der DDR zu Beginn der 80er Jahre zur Fluktuation veranlasst haben
- 2.5.2.2. Ideelle Bedingungen der Arbeit als Ursachen der Fluktuation
- 2.5.2.3. Materielle Bedingungen der Arbeit als Ursachen der Fluktuation
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes in der DDR, insbesondere in den 1980er Jahren, und deren Auswirkungen auf die weibliche Bevölkerung nach der Wiedervereinigung. Ziel ist es, die Ursachen für die anhaltende Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu beleuchten.
- Geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegregation in der DDR
- Die Rolle der familialen Entwicklung
- Fluktuation von Werktätigen als Ausdruck sozialer Konflikte
- Ökonomisch-soziale Entwicklung der DDR bis Ende der 70er Jahre
- Situation der Frauen im Erwerbsleben in den 80er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den drastischen Wandel der Arbeitsmarktsituation in der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung, insbesondere die hohen Erwerbslosenquoten und die besonders starke Betroffenheit von Frauen. Die Arbeit konzentriert sich auf die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes in den 1980er Jahren als zentralen Aspekt zur Erklärung dieser Entwicklung. Es wird eine Begriffsklärung und historische Einordnung des Problems angekündigt, gefolgt von einer Analyse des Erwerbsverlaufs der Bevölkerung in den 1980er Jahren mithilfe empirischer Studien. Schließlich wird die Fluktuation von Werktätigen als Ursache sozialer Ungleichheiten untersucht.
2.1. Begriffsklärung und historische Einordnung des Problems: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Segregation und untersucht die geschlechtsspezifische Arbeitsmarktteilung als zentralen Aspekt der Geschlechterbeziehung. Es wird die historische Entwicklung dieser Arbeitsteilung beleuchtet, beginnend mit der industriellen Revolution und der damit verbundenen Veränderung der Familienstrukturen und Arbeitsverhältnisse. Es wird herausgestellt, wie sich geschlechtsspezifische Berufe herausbildeten und Frauen unter ungünstigen Bedingungen arbeiteten, mit niedrigeren Löhnen und längerer Arbeitszeit. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation.
2.2. Die Entwicklung der Arbeitsmarktsegregation der DDR von 1949 bis zum Ende der 70er Jahre: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Arbeitsmarktsegregation in der DDR von 1949 bis zum Ende der 1970er Jahre. Es betrachtet die Ausgangsbedingungen und Wachstumskonstellationen sowie die Beschäftigungsstruktur. Hier werden die sozioökonomischen Faktoren untersucht, welche die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in diesem Zeitraum prägten und die Grundlage für die Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten legten. Der Fokus liegt auf der Erfassung der grundlegenden Strukturen und Tendenzen der Arbeitsmarktsegregation im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der DDR.
2.3. Die Situation des weiblichen Werktätigen in den 80er Jahren: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Situation weiblicher Werktätiger in den 1980er Jahren in der DDR. Es untersucht die Arbeitsbedingungen, den Zugang zu bestimmten Berufen und die Rolle von Frauen im Kontext der sozialistischen Gleichberechtigungspolitik. Die Analyse konzentriert sich auf die Widersprüche zwischen der offiziellen Ideologie und der Realität der Arbeitswelt für Frauen. Empirische Daten und Studien werden wahrscheinlich herangezogen, um die Situation der Frauen im Detail darzustellen.
2.4. Geschlechtsspezifische Segregation im Erwerbsverlauf im Kontext der familialen Entwicklung: Dieser Abschnitt analysiert die geschlechtsspezifische Segregation im Erwerbsverlauf im Zusammenhang mit der familialen Entwicklung. Es wird untersucht, wie die Grenzen zwischen Frauen und Männern im Erwerbsleben gezogen und reproduziert werden. Der Fokus liegt auf den Interaktionen zwischen den beruflichen und familiären Rollen und wie diese zur Aufrechterhaltung der geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation beitragen. Die Analyse beleuchtet die sozialen und kulturellen Faktoren, die diese Muster prägen.
2.5. Die Fluktuation Werktätiger der DDR der 80er Jahre als Ausdruck sozialer Konflikte: Dieses Kapitel untersucht die Fluktuation von Werktätigen in den 1980er Jahren als Ausdruck sozialer Konflikte. Es wird analysiert, wie betriebliche, ideelle und materielle Bedingungen die Arbeitskräfte zur Fluktuation veranlassten. Die Analyse deckt wahrscheinlich die Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Werktätigen und den realen Arbeitsbedingungen auf und zeigt die Verbindung zwischen Fluktuation und sozialen Ungleichheiten.
Schlüsselwörter
Arbeitsmarktsegregation, DDR, Frauen, Geschlecht, Erwerbstätigkeit, Familie, Fluktuation, soziale Konflikte, 1980er Jahre, Sozialismus, Wiedervereinigung, Ostdeutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegregation in der DDR
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes in der DDR, insbesondere in den 1980er Jahren, und deren Auswirkungen auf die weibliche Bevölkerung nach der Wiedervereinigung. Ein zentrales Ziel ist die Analyse der Ursachen für die anhaltende Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegregation in der DDR, die Rolle der familialen Entwicklung, die Fluktuation von Werktätigen als Ausdruck sozialer Konflikte, die ökonomisch-soziale Entwicklung der DDR bis Ende der 70er Jahre und die Situation der Frauen im Erwerbsleben in den 80er Jahren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit mehreren Unterkapiteln (Begriffsklärung, Entwicklung der Segregation bis Ende der 70er, Situation der Frauen in den 80ern, Segregation und familiäre Entwicklung, Fluktuation als Ausdruck sozialer Konflikte) und einen Schluss. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den drastischen Wandel der Arbeitsmarktsituation in der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung, fokussiert auf die hohe Arbeitslosenquote bei Frauen und kündigt die Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation in den 1980er Jahren als zentralen Erklärungsansatz an.
Was beinhaltet Kapitel 2.1 (Begriffsklärung und historische Einordnung des Problems)?
Kapitel 2.1 definiert den Begriff der Segregation und untersucht die geschlechtsspezifische Arbeitsmarktteilung im historischen Kontext, beginnend mit der industriellen Revolution und den damit verbundenen Veränderungen von Familienstrukturen und Arbeitsverhältnissen. Es werden geschlechtsspezifische Berufe und die ungünstigen Arbeitsbedingungen für Frauen beleuchtet.
Worauf konzentriert sich Kapitel 2.2 (Entwicklung der Arbeitsmarktsegregation der DDR von 1949 bis zum Ende der 70er Jahre)?
Kapitel 2.2 analysiert die Entwicklung der Arbeitsmarktsegregation in der DDR von 1949 bis Ende der 70er Jahre, indem es die Ausgangsbedingungen, Wachstumskonstellationen und die Beschäftigungsstruktur untersucht. Es werden die sozioökonomischen Faktoren betrachtet, die die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung prägten.
Was ist der Inhalt von Kapitel 2.3 (Die Situation des weiblichen Werktätigen in den 80er Jahren)?
Kapitel 2.3 widmet sich der Situation weiblicher Werktätiger in den 1980er Jahren. Es untersucht Arbeitsbedingungen, den Zugang zu Berufen und die Rolle von Frauen im Kontext der sozialistischen Gleichberechtigungspolitik, wobei die Widersprüche zwischen Ideologie und Realität im Fokus stehen.
Was wird in Kapitel 2.4 (Geschlechtsspezifische Segregation im Erwerbsverlauf im Kontext der familialen Entwicklung) analysiert?
Kapitel 2.4 analysiert die geschlechtsspezifische Segregation im Erwerbsverlauf im Zusammenhang mit der familiären Entwicklung. Es untersucht die Interaktionen zwischen beruflichen und familiären Rollen und wie diese zur Aufrechterhaltung der geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation beitragen.
Was ist der Gegenstand von Kapitel 2.5 (Die Fluktuation Werktätiger der DDR der 80er Jahre als Ausdruck sozialer Konflikte)?
Kapitel 2.5 untersucht die Fluktuation von Werktätigen in den 1980er Jahren als Ausdruck sozialer Konflikte. Es analysiert betriebliche, ideelle und materielle Bedingungen, die zur Fluktuation führten, und deckt die Diskrepanzen zwischen Erwartungen und realen Arbeitsbedingungen auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Arbeitsmarktsegregation, DDR, Frauen, Geschlecht, Erwerbstätigkeit, Familie, Fluktuation, soziale Konflikte, 1980er Jahre, Sozialismus, Wiedervereinigung, Ostdeutschland.
- Quote paper
- Maik Teichgräber (Author), 2003, Geschlechtsspezifische Segregation in der DDR der 80er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19185